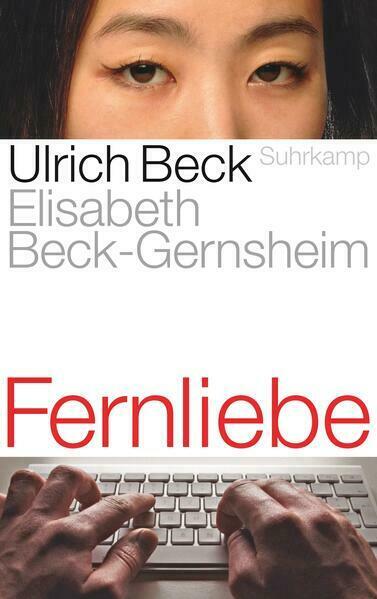Wenn Liebe die ganze Welt umspannt
Andreas Kremla in FALTER 41/2011 vom 12.10.2011 (S. 42)
Soziologie: Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim
singen ein Lied für die globalisierte Liebe
Beziehungen haben es ihnen angetan. Seit 20 Jahren beschäftigt sich das Soziologenpaar Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim mit Ich-du-wir-Fragen. Jetzt nehmen sie die weite Welt der globalisierten Familie unter die Lupe.
Mail Order Brides (Frauen, die Männer sich aus dem Katalog aussuchen) gelten nicht als Anwärterinnen auf ein erfülltes Eheleben. Hoch seien Enttäuschungsfaktor und Scheidungsrate, bescheinigt die soziologische Literatur. Doch: "Wer wurde hier befragt?" Wer in Frauenhäusern auf Feldstudie geht, wird kaum Heiratsmigrantinnen finden, die ihr kleines Glück in einem Land mit größerem Bruttonationalprodukt gefunden haben, kritisiert das Forscherpaar.
Als "methodologischen Nationalismus" fassen sie die verengte Vorgehensweise in einen Begriff. Ob türkische Arbeiter in Deutschland, Pakistani in Großbritannien oder philippinische Nannys in den USA: Gemessen werde immer am Maßstab des reichen, westlichen Ziellandes.
Wer die Methodik anderer hinterfragt, sollte auf eine saubere eigene Vorgehensweise achten. Die Autorenfamilie Beck definiert von Anfang an ihre "Weltfamilie". Entlang dieses Begriffs entsteht eine gute Balance aus fundierter Recherche und plastischer Darstellung in leicht lesbarer Sprache.
Dabei geht es nicht nur um die Frage, welches Fest im Dezember gefeiert werden soll, Weihnachten oder Chanukka, sondern auch darum, wie man miteinander umgeht – wie im Fall einer mit einem Inder verheirateten Engländerin, die am Morgen nach der Hochzeit plötzlich von ihrem Schwager herumkommandiert wird. "Ob die Liebenden oder die Familienmitglieder es wollen oder nicht, sie werden im Binnenraum des eigenen Lebens mit der Welt konfrontiert", fassen die Globalisierungsbeobachter das Wesen der Mehr-Kulturen-Familie zusammen.
Beispiele dafür finden sich überall: etwa bei jordanischen Männern, die israelische Frauen nur in einem dritten Land heiraten können. Für sie und andere Leidensgenossen sind Partner-Reiseagenturen mit pragmatischer statt romantischer Ausrichtung entstanden. Tausende Paare verdanken ihnen nicht die sonst übliche Anbahnung einer Beziehung, sondern die legale Ankunft einer bereits bestehenden Verbindung im Ehehafen.
Die andere Seite des Begriffs "Weltfamilie" bilden jene, die von der Globalisierung getrennt werden: Jobnomaden etwa, denen ihre Karriereleiter wichtiger ist als das traute Heim.
"In dieser Perspektive ist Fernliebe die Restliebe", befinden die Autoren. Und sie haben noch Unromantischeres zu bieten: "EU-Waisen" heißen jene Kinder im Osten Europas, deren Eltern ihr berufliches Glück im reicheren Westen suchen. Mit "Care Drain" zitieren Beck und Beck-Gernsheim einen Begriff für den Abfluss von Kinderversorgungskapazitäten aus Schwellenländern wie den Philippinen: Hier sind viele Mütter nicht mit der Aufzucht der eigenen Kinder beschäftigt, sondern als Nannys von Babys in den USA.
Hinter der internationalen Familienschau steckt viel Erfahrung. Mit ihrem Buch über veränderte Beziehungs- und Familienkulturen, "Das ganz normale Chaos der Liebe", landeten die beiden Soziologieprofessoren aus Deutschland schon 1990 einen Bestseller.
2004 wagte sich Elisabeth Beck-Gernsheim mit "Wir und die anderen" hinaus in die fremde Welt der Kopftuchträgerinnen und Zwangsverheirateten. Ulrich Beck, einer der Fixsterne seiner Disziplin, zeichnet verantwortlich für so breitenwirksam gewordene Worte wie "Risikogesellschaft" oder "zweite Moderne". Gerade in der Erfahrenheit der Autoren und ihrer Breitenwirkung wurzelt aber auch ein Schwachpunkt des Buches: Versierten Lesern klingen manche Gedanken allzu.
"Was kommt nach der Familie?", fragte Beck-Gernsheim bereits 1998. Jetzt liegt die Antwort vor. Und sie fällt teilweise auch optimistisch aus: Den scheelen Blicken ihrer Kollegen auf Heiratsmigrantinnen zum Trotz sehen Beck & Beck in ihrer Weltfamilie Chancen gerade auch für Frauen. Denn diese migrieren meist von "Ost" nach "West": von restriktiven, patriarchalischen zu relativ freien, theoretisch gleichberechtigten Lebensstrukturen.
Wer hier sicher sein Glück findet, ist der am Migrationsdiskurs interessierte Leser: Er bekommt nicht nur eine Vielzahl von Stimmen zum Thema referiert, sondern auch eine kritische Analyse dazu – und damit das Gefühl, mittendrin zu stehen in einer angeregten Diskussion über die Zukunft der Liebe. Zur Kulturgeschichte von Beziehungen und Familie tragen Beck und Beck-Gernsheim ein topaktuelles Stück Zeitgeschichte bei.