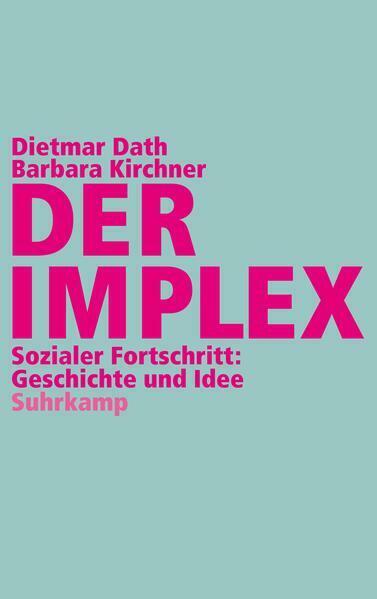Madonna passt nicht rein, und was der Rassist am Klo denkt, ist egal
Klaus Nüchtern in FALTER 17/2012 vom 25.04.2012 (S. 30)
Das Buch hat über 800 Seiten und zitiert etwa ebenso viele Gewährsleute und Gegner: von Adorno, Althusser und Albert Ayler bis iek, Zuse und Stefan Zweig; von Bayes, Bayle und Beuys bis Wittgenstein, Wollstonecraft und Westerwelle; von Debord, Deleuze und Derrida bis Trotzki, Turing und Tolkien. Dietmar Dath und Barbara Kirchner haben sich nicht nur durch die Klassiker der Aufklärung oder durch die 43 blauen Bände von Marx und Engels, sondern auch durch allerhand wissenschaftliche, schöngeistige und Science-Fiction-Literatur gearbeitet. Worum's in ihrem "Roman in Begriffen" geht, macht der Untertitel deutlicher als der vom französischen Lyriker und Philosophen Paul Valéry geborgte Begriff "Implex": "Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee".
Es ist ein ebenso ambitioniertes wie anmaßendes Projekt, dem der Rezensent der SZ gerne den Alternativtitel "Wie wir doch noch den Kommunismus retten können" verpasst hätte. Apropos Rezensenten. Die waren schnell zur Stelle, je flotter, umso forscher: Wo die taz die Simplifizierungen des Buches kritisierte und das "hochstaplerische Imponiergehabe" geißelte, da stieß sich auch die Zeit am Stil dieser "kalaschnikowhaften Selbstermächtigungsprosa" und hielt den Verfassern vor, "trotz aller Klassendefinitionen keinen wirklichen Begriff von Gesellschaft" zu haben.
Zugegeben, so angeberisch muss man die eigene G'scheit- und Belesenheit echt nicht vor sich hertragen; und die zwänglerische Neigung, auch noch mindestens zwei Parenthesen ins Dickicht der hydrahaften Syntax zu kleschen, trägt zur Selbstermächtigung der Leser wenig bei.
Abseits davon kann die Lektüre dieses Hybrids aus Manifest, Exegese und geistesgeschichtlichem Schnellsiedekurs aber richtig Spaß machen und schöne Funde zutage fördern. Wer an der Polemik gegen Richard Rorty, den "prime mover des Neopragmatismus", den sich die Autoren nun einmal zum Liebling unter ihren nicht ganz so finsteren Feinden erkoren haben, kein Interesse hat, der wird sich vielleicht für den Hinweis darauf erwärmen, dass die Aufklärung mit Meinungsfreiheit – nehmt das, poster dieser Welt! – gerade nicht bloße "Meinung" meinte und keineswegs die Lizenz zum Labern erteilen wollte.
Auch das Plädoyer für die Treue – "die größte (und tragischste) Errungenschaft des bürgerlichen Widerwillens gegen das Naturwüchsige" – mag manche überraschen. Außerdem finden sich alle paar Seiten lang witzige Passagen wie etwa jene über "Popgrößen wie Madonna", von der es heißt: "So viele Widersprüche, wie diese Frau sich aufgeladen hat, passen in keine Geschichte der Emanzipation, egal wessen, egal wovon."
Wessen ist im Übrigen klar: natürlich aller Menschen! Weswegen die Autoren den Universalismus und das Naturrecht auch dort hochhalten, wo diese ihre (historisch) blinden Flecken haben.
Wovon: Unterdrückung, Heteronomie, Leid: "Wir sind gleichsam runde Klötze, die irgendwer in eckige Öffnungen gehauen hat oder umgekehrt." Das soll ein Ende haben.
Trotz eines gewissen Hangs zu einer (oft auch sehr unterhaltsamen) pennälerhaften Präpotenz ist "Der Implex" insgesamt ein probates Antidot gegen das nervtötende "Kritikmodell der Entlarvung (auf Lehrer-Neudeutsch: ,Hinterfragen')", das hinter jeder Sache "zwanghaft eine wesenhaft andere, wahre, von der phänomenalen nur verdeckte freilegen muss".
"Pure Vernunft darf niemals siegen", sangen Tocotronic. Im Unterschied zu den Ärzten und deren Transformationsutopie "Welt, in der alle Menschen Mädchen wären", werden sie im "Implex" nicht bemüht. Sie haben aber insofern Recht, als Vernunft nur eine der menschlichen Wesenskräfte darstellt und sich vernünftigerweise an ihren Zuständigkeitsbereich hält. Man muss auch gar nicht alles wissen: "Was der Rassist auf dem Klo denkt, ist uns egal. Ans Verhalten der Leute kommt man, wenn man nicht Telepath ist, einfach leichter ran als an ihre mental erlebten Verhaltensdispositionen."
Dass man aus einem Sein kein Sollen ableiten kann, wusste schon (der vielfach zitierte) David Hume. Der Mensch hat aber neben dem Sein auch ein Wollen, das dies Sein verändern kann, damit der Reichtum allen zugute komme, denn: "Reichtum schafft immer Spielraum für Schönheit, Größe und Güte." Ein schlichter Satz, gewiss, aber allemal wert, wieder einmal aufs Kissen gestickt zu werden.