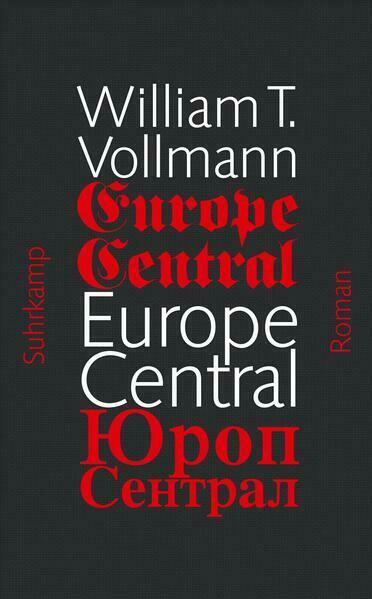"Europe Central": auf der Höhe der Zeit
Tobias Heyl in FALTER 17/2013 vom 24.04.2013 (S. 29)
William T. Vollmann zählt zu den bedeutendsten amerikanischen Romanciers. Trotzdem ist er außerhalb des englischen Sprachraums fast unbekannt. Kein Wunder: Das Werk des 52-Jährigen sperrt sich schon angesichts seines Umfangs gegen eine Übersetzung.
"Rising Up and Rising Down" etwa, eine monumentale Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt aus dem Jahr 2004, bringt es in sieben Bänden auf 3300 Seiten. In diesem Jahr erscheint der fünfte von sieben geplanten Bänden über die amerikanische Landschaft, dazu kommen Romane, Erzählungen, Reportagen und Gedichte. Wo soll man da anfangen?
Der Suhrkamp Verlag hat in den letzten Jahren mit der Übersetzung von einigen vergleichsweise schmalen Bänden den deutschsprachigen Lesern einen ersten Eindruck von Vollmanns Obsessionen und einen Einblick in seine Arbeitsweise gegeben. Auch außerhalb von "Rising Up and Rising Down" beschäftigt ihn das Thema der Gewalt, in "Huren für Gloria" etwa, Teil einer Trilogie über die Prostitution, die in den düstersten Gegenden von San Francisco spielt, oder in seiner frühen autobiografischen Reportage über den Afghanistankrieg, in dem er als etwas blauäugiger junger Mann auf der Seite der Mudschaheddin gegen die Rote Armee kämpfen wollte.
Schon in diesen Büchern lässt sich Vollmanns Technik ganz gut studieren: Er ist ein bildreicher, ja eleganter Erzähler, der den Stoff seiner Geschichten bis ins letzte Detail recherchiert und sich ansonsten wenig um die Gattungsgrenze zwischen fiction und non-fiction schert.
Und nun also, in diesem Frühjahr, der erste ganz große Vollmann in deutscher Übersetzung: "Europe Central", im Original 2005 erschienen. Der Titel spielt mit mindestens zwei Bedeutungen: mit dem geografischen Begriff und mit dem Bild einer Telefonzentrale, in der alle Leitungen der europäischen Geschichte zusammenlaufen.
Diese beiden semantischen Felder überlagern einander, denn eben in Zentraleuropa, in Polen, in der Ukraine und in Russland erreichten die Gewaltexzesse des Krieges und der Ermordung der Juden ihren Höhepunkt, kosteten die Reinheitsobsessionen der Nationalsozialisten und der Kommunisten Millionen Menschen das Leben. Wie soll daraus ein Roman entstehen?
Vollmanns Held heißt Schostakowitsch. Das Leben des russischen Komponisten zieht sich als roter Faden durch den Roman, es verkörpert die ganze Tragik des 20. Jahrhunderts. Einen ganzen Teil seiner Lebensenergie muss er darauf verwenden, in der Diktatur zu überleben, als Künstler wie als Bürger. Immer wieder sieht er sich zu jenen Kompromissen gezwungen, mit denen sich die Nachgeborenen in ihrer moralischen Urteilsfreudigkeit so schwer tun.
Vollmann dichtet ihm eine Affäre mit Elena Konstantinowskaja an, die eigentlich mit dem Filmregisseur Roman Karmen verheiratet war – im Anhang gesteht er ganz offen, dass die Quellen dafür nur spärliche Belege liefern.
Dieser kleine Eingriff aber nutzt dem Roman ungemein, der nun auch eine Dreiecksgeschichte erzählt und außerdem eine Nebenfigur einführt, die das 20. Jahrhundert jenseits von Krieg und Genozid repräsentiert: die neue Frau, die niemanden mehr als sich selbst über ihr Leben entscheiden lässt.
Und noch über den Stoff hinaus lässt sich eine innere Verbindung zwischen Dmitri Schostakowitsch und William T. Vollmann ausmachen: Beide pflegen einen Hang zum Gigantismus und die völlige Unabhängigkeit vom künstlerischen Mainstream.
Soweit das einem Romancier möglich ist, verwendet Vollmann Techniken, die von Schostakowitsch vertraut sind: Zitate, jähe Sprünge der Tonlagen, unvermittelte Wechsel von der großen zur kleinen Form – und wieder zurück.
"Europe Central" folgt einer strengen Ordnung, die man so streng eher in einer Komposition als in einem Roman vermuten würde. Der beginnt mit einer Ouvertüre – eine Telefonzentrale irgendwo in Rumänien, man versteht Gesprächsfetzen, Meldungen aus einer Schlacht. Dann setzen zwei Erzählstränge ein, ein deutscher und ein sowjetischer, wobei freilich ein Geheimnis bleibt, wer da wirklich spricht: Aus Andeutungen lässt sich allenfalls darauf schließen, dass es sich um hohe Offiziere, Geheimdienstler oder Funktionäre handelt.
Jedes Kapitel ist als Erzählung einer Episode in sich abgeschlossen, nimmt dann aber paarweise auf ein anderes Bezug. So spiegelt sich General Paulus, der Verlierer von Stalingrad, in General Wlassow, der in der deutschen Gefangenschaft die Seiten wechselte und mit seiner Russischen Befreiungsarmee gegen Stalin kämpfen wollte.
Mit seinen 36 sehr unterschiedlich langen Kapiteln erinnert "Europe Central" – ein letztes Mal sei diese Analogie bemüht – an die freien Satzfolgen bei Schostakowitsch. "Europe Central", so heißt es an einer Stelle ausdrücklich, ist das 8. Streichquartett Op. 110 mit seinen drei Largos: 1960 in Dresden komponiert, in jener Stadt, die vom Luftkrieg vielleicht am schlimmsten getroffen wurde und wo General Paulus seine letzten Jahre verbrachte, den Opfern von Faschismus und Gewalt gewidmet, gespickt mit musikalischen Anspielungen und Zitaten. In diesen 20 Minuten verdichtet sich das ganze Jahrhundert. Wie sich die Kapitel in "Europe Central" wechselseitig spiegeln, so spiegelt der Roman als Ganzes Schostakowitschs 8. Streichquartett.
Und, so fragt man sich natürlich nach so viel Beschreibung, lohnt ein solcher konzeptioneller Aufwand die Lektüre? "Europe Central" bringt als Epochenroman jenes 20. Jahrhundert der Gewalt, das wir bis heute mit uns herumtragen, in eine literarische Form auf der Höhe der Zeit.
Da tritt kein allwissender Erzähler auf, der Erklärungen auch dann noch parat hält, wo es ehrlicherweise nichts zu erklären gibt. Da setzt sich ein literarischer Kosmos aus genau recherchierten Fakten und Zitaten zusammen, die sich im Anhang überprüfen lassen, die aber fern von der Öde des bloß Dokumentarischen so kunstvoll kombiniert und arrangiert werden, dass sie zu einem zweiten, literarischen Leben erwachen.
Mit diesen Arrangements demonstriert Vollmann aber auch, wie schwer bisweilen die Grenze zwischen Fakten und Fantasie zu erkennen ist – und dass es manchmal vielleicht sogar nötig ist, die Fantasie zu Hilfe zu nehmen, um die Erinnerung an die Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu bewahren.
Mit Schostakowitsch durchs 20. Jahrhundert
Klaus Nüchtern in FALTER 17/2013 vom 24.04.2013 (S. 28)
Die Schriftsteller Clemens J. Setz und William T. Vollmann im Gespräch über das Gute, das Böse, Dostojewski, Gandhi und das Telefon
Die Präsentation von William T. Vollmanns Roman "Europe Central" fand am 14. April im Babylon-Kino in Berlin statt. Die Lesung des US-amerikanischen Autors wurde von seinem Verlagskollegen, dem österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz, moderiert. Setz ist einer der wenigen im deutschsprachigen Raum, die mit dem abertausende Seiten umfassenden Werk Vollmanns vertraut sind. Die beiden führten während der Präsentation auch ein Gespräch, dessen Mitschnitt der Suhrkamp Verlag dem Falter freundlicherweise zur Verfügung stellte und von dem wir hier einen Ausschnitt abdrucken.
Clemens J. Setz: Irgendwo bei Dostojewski findet sich die Stelle, dass die vielleicht einzige Möglichkeit menschlichen Zusammenseins darin besteht, zu sagen: Wenn irgendwo ein Verbrechen geschieht, dann bin auch ich schuld daran.
William T. Vollmann: Ja, das stammt aus den "Brüdern Karamasow". Wenn jemand in Timbuktu einen Mord begeht, dann soll ich ihn auf mich nehmen. Wenn es einem nichts ausmacht, verrückt zu werden, liegt in dieser Vorstellung auch ein gewisser Trost – so wie auch in Gandhis Worten, denen zufolge man dem Verlangen nach Resultaten tunlichst nicht nachgeben sollte. Solange wir versuchen, nach Maßgabe unserer Kräfte das Beste zu tun, entbindet uns das zwar nicht von unserer Verantwortung, aber es hilft uns.
Eine der Geschichten in meinem Roman handelt von dem SS-Mann Kurt Gerstein, der alles getan hat, um die Welt vor der "Endlösung" zu warnen, damit aber gescheitert ist. Er hat sich und seine Familie damit in große Gefahr gebracht. Ich kann nur hoffen, dass ich an seiner Stelle ähnlichen Mut aufgebracht hätte – auch wenn es eine nutzlose Entscheidung war. Ein anderes, ganz kurzes Kapitel erzählt davon, wie Schostakowitsch während der Blockade von Leningrad einem kleinen Kind, das vor Hunger kaum noch gehen kann, Brot gibt; worauf er sich schuldig fühlt, weil er das Brot seinen eigenen Kindern vorenthalten hat. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, aber ich würde mich mit einem Satz meines besten Freundes trösten wollen: "Welche Entscheidung du auch fällst, sie ist auf jeden Fall falsch."
Setz: Apropos Gandhi: Es gibt da den berühmten Rat, den er den Juden nach der "Kristallnacht" gegeben hat, nämlich ihr Schicksal als gottverhängt zu begreifen und
Vollmann:
unter Gesängen und Gebeten in die Gaskammern zu wandern, ja. Ich bevorzuge Gewalt.
Setz: Ihr Roman beginnt mit diesem "plumpen schwarzen Telefon", das mit einem Tintenfisch verglichen wird. Welche Bedeutung spielt die Kommunikationstechnologie inmitten der Ära des Todes und der Zerstörung, die Sie beschreiben?
Vollmann: Verzögerungsfreie Kommunikation macht vieles möglich. Denken Sie bloß einmal an die schlimmsten römischen Imperatoren und wie viel Zeit es diese gekostet hat, auch nur irgendjemanden zu mobilisieren. Heutzutage kann sich jede Kraft, ob sie nun gut oder böse ist, augenblicklich verstärken. In diesem Moment könnte jemand auf einen Knopf drücken, einen Raketenangriff starten und die Wirklichkeit, in der wir leben, innerhalb von zehn Minuten grundlegend verändern. Das Telefon ist die perfekte Metapher für jenes Zentraleuropa der autoritären Kontrolle, das ich in meinem Roman beschreibe.
Setz: Wir sollten noch erwähnen, dass "Europe Central" ein Fachbegriff und mit "Central" die Vermittlung gemeint ist.
Vollmann: Genau – weswegen es auch nicht "Central Europe", sondern "Europe Central" heißt.
Setz: Ich war unglaublich beeindruckt von Dimitri Schostakowitsch. Ich glaube wirklich, dass er ein Held ist. Sehen Sie das auch so?
Vollmann: Er war kein makelloser Mensch, hat ein bisschen mit dem Regime kollaboriert, um seine sogenannte "formalistische" Musik komponieren, seine Familie und manchmal auch seine Freunde schützen zu können. Dass er so lange überlebt hat, diese großartige Musik geschrieben und anderen ein paar Wohltaten erwiesen hat, ohne sich selbst zu sehr zu kompromittieren – davor habe ich großen Respekt.
Setz: Gegen Ende des Buches kommt Schostakowitschs Sohn von der Schule heim und gesteht seinem Vater widerstrebend, dass er dessen Schaffen im Musikunterricht denunziert hat. Worauf ihm Schostakowitsch einen Klaps auf den Kopf gibt und lächelt. Als ich das las, hatte ich Tränen in den Augen. Er hätte es einfach nicht besser machen können. Hätte er gezeigt, dass er verärgert ist oder traurig
Vollmann: Es muss ihn schon traurig gemacht haben.
Setz:
wäre der Sohn noch deprimierter gewesen.
Vollmann: Nun, um zu überleben, musste Schostakowitsch andere denunzieren. Er wollte sich wohl selbst vergeben, dass er sie unter Zwang verraten hatte. Und die beste Möglichkeit dafür besteht eben darin, dass man auch anderen vergibt, wenn diese in eine solche Situation geraten.
Setz: Ich finde, Ihre literarische Beschreibung des 8. Streichquartetts, Op. 110 ist so herausragend, dass ihr allenfalls die Beschreibung der fiktiven Kompositionen von Adrian Leverkühn in Thomas Manns "Doktor Faustus" vergleichbar ist. Sie konnten das aber nicht erfinden. Verstehen Sie eigentlich was von Musiktheorie? Spielen Sie ein Instrument?
Vollmann: Als Kind hatte ich für drei oder vier Jahre Klavierunterricht, war aber nicht gut genug, um weiterzumachen. Also habe ich mit ein paar Musikwissenschaftlern gesprochen und habe einige Einträge über Schostakowitsch in Enzyklopädien nachgelesen.
Setz: In Ihrem Roman denkt Schostakowitsch von seiner Geliebten, seiner Frau und seinem Sohn in musikalischen Termini. Das ist ziemlich komisch, wahr und falsch zugleich. Niemand lacht wirklich "pizzicato", aber wenn man sich im Kopf von Schostakowitsch befindet, ist es plausibel.
Vollmann: Ich bin überzeugt davon, dass Schostakowitsch ähnlich empfunden hat. Wenn man einer bestimmten Arbeit nachgeht, dann laufen die Mechanismen dieser Arbeit im Bewusstsein weiter. Wäre ich Komponist, dann könnte ich gar nicht anders, als in musikalischen Analogien zu denken.
Setz: Meine Lieblingsfigur ist Elena Konstantinowskaja, die bei Ihnen die unvergessene Geliebte von Schostakowitsch ist, obwohl Sie im Nachwort schreiben, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Was weiß man überhaupt über sie?
Vollmann: Schostakowitsch und sie hatten eine sehr kurze Affäre. Ursprünglich hätte Opus 40 ihr gewidmet sein sollen. Dann wurde sie allerdings verhaftet und für etwa ein Jahr in den Gulag geschickt. Niemand weiß, warum sie wieder entlassen wurde. Sie kam schließlich nach Spanien, wo sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet wurde und den Regisseur Roman Karmen heiratete. Den Rest habe ich erfunden.
Setz: Was mir an ihr so gefallen hat, ist
ihre Unaufgeregtheit: "Okay
ja dann
na gut." Sie wissen schon, die Art von Verhalten, das Frauen an den Tag legen, wenn sie Männer in den Wahnsinn treiben wollen.
Vollmann: Das ist richtig. Elena ist vollkommen undurchschaubar. Sie ist eine Metapher für Europa, jeder findet sie attraktiv, und niemand kann sie halten.
Setz: In Ihrem Buch "Imperial" wird eine stark verweste Leiche aufgefunden, die nicht identifiziert werden kann. Das Kapitel heißt: "Still a mystery". Darin schreiben Sie auch über die Bedeutung der Ahnungslosigkeit für Ihr Schreiben. Davon scheinen Sie sich immer noch ein Stück bewahren zu wollen?
Vollmann: Thoreau hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass uns das Wissen nicht in die Quere kommt. Ich fand immer, dass er damit vollkommen Recht hat. Sie alle, die Sie hier sitzen, sind Zeugen meiner Anmaßung, über Ihr Land in einer Zeit zu schreiben, in der ich noch nicht einmal auf der Welt war. Was sollte ich also sein, wenn nicht ahnungslos?! Und allein meine Ahnungslosigkeit ist meine Rettung, erlaubt es mir überhaupt erst, es wenigstens zu versuchen. Würde ich von meinen Figuren sagen, dass sie eindeutig gut oder eindeutig böse sind, dann hätte ich auch meine Ahnungslosigkeit verloren und wäre außerstande, Ihnen auch nur irgendetwas zu erzählen.