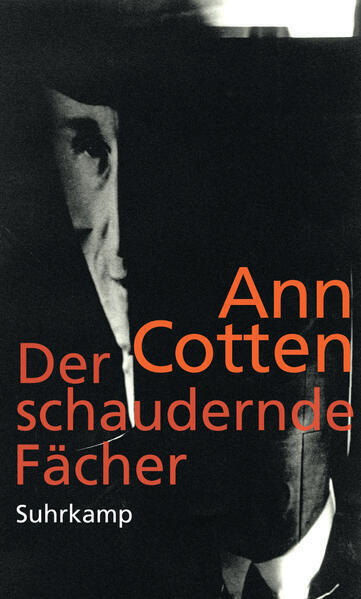Remixing die gute alte Himmelsmacht
Nicole Streitler-Kastberger in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 17)
In ihren Erzählungen "Der schaudernde Fächer" seziert Ann Cotten auf sprachmächtige Weise die Liebe
Man konnte es nach Ann Cottens vor drei Jahren erschienenen "Florida-Räumen" schon erahnen: Der Shootingstar der deutschsprachigen Lyrik ("Fremdwörterbuchsonette", 2007), "das großartig-amerikanisch-österreichische Landei aus Iowa" (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), würde über kurz oder lang auf die Prosaschiene wechseln. Ob das mit Markt- oder Verlagszwängen zu tun hat oder aber mit dem Wunsch der Autorin, sich langsam, aber beharrlich an den Roman heranzupirschen, sei dahingestellt.
Schon die erwähnten "Florida-Räume" reichten jedenfalls in Hinblick auf Umfang und Gattungshybridität an die lange Form der Prosa heran, der eben erschienene Erzählband "Der schaudernde Fächer" tut dies noch deutlicher. Erreicht der Umfang locker den eines marktgängigen Romans, so ist der erzählerische Bogen hier freilich noch auf die Kurzstrecke gespannt.
Die Autorin selbst legt im "Schaudernden Fächer" ein paar Fährten, die andeuten, in welche Richtung ihr Schreiben geht oder gehen möchte. Der programmatische Eingangstext "Die gelangweilte Combo oder Wie man gut schreibt" nennt Musil und Doderer als mögliche Gewährsmänner. Und so wie bei diesen beiden Größen des vorangegangenen Jahrhunderts sind Reflexion und Humor (Ironie) auch wichtige Ingredienzien des Cotten'schen Schreibens. Ausgeprägter aber noch als diese scheint ihr grundsätzlicher Drang zur verschnörkelten Verspieltheit, wodurch Entwicklungslinien der österreichischen Avantgarde auf eine genuine Art fortgeführt werden, insbesondere das von H.C. Artmann virtuos vorgeführte Spiel mit literarischen Genres und Masken.
Wie Pastiches, die auch Proust geliebt hat, zitieren viele dieser Erzählungen literarische Traditionen: sei es die des Romans russischer Herkunft (Gogol und Turgenjew werden an prominenter Stelle genannt) oder die der philosophischen Erzählung in Dialogform, wie sie etwa ein Voltaire oder Diderot populär gemacht haben.
Cotten füllt diese Erzählmuster mit
einer eigenwilligen Sprache, die altertümelnde Gewähltheit und zeitgenössischen Cultural Crossover vereint, Fremdsprachiges und Neudeutsches wie selbstverständlich einschließt. Und sie füllt diese
Erzählmuster mit Inhalten, die einer global operierenden Jugendkultur entnommen, manchmal rührselig und manchmal grotesk sind oder das Groteske zumindest streifen.
Zentrale Thematik der Erzählungen ist überraschenderweise die Liebe. Wie Cotten diesen vermeintlich verbrauchtesten Topos der Literatur, den ewigen Dauerbrenner auf den Kandelabern der Textaltäre, bearbeitet, remixt und scratcht, das zeugt schon von einer literarischen und intellektuellen Meisterschaft, die Ihresgleichen sucht.
Alle Spielarten menschlichen Begehrens werden durchdekliniert, wobei grausam-alltäglichen Situationen unerfüllter oder nur einseitiger Liebe ein besonderes Augenmerk gilt. Erheiternd der Dialog zweier Frauen über die Frage: "Wie können wir durch die Kraft der Kunst eine deprimierende Liebesaffäre in eine vergnügliche verwandeln?" ("Im Grünen Pfau"). Oder die in russischen Birkenidyllen angesiedelte Erzählung in Briefen ("Birkenhäuschen") über die Liebe zwischen einem homosexuellen Mann und einer transsexuellen Mann/Frau, die sich ihre Brüste amputieren und in Alkohol konservieren hat lassen. Wunderbar die Szene, in der die "Frau" vor der OP ein letztes Mal mit ihren Brüsten nackt durch einen See schwimmt, im Vollgenuss ihrer Weiblichkeit, von der sie sich doch danach freiwillig verabschiedet.
Die Deutlichkeit und Drastik, mit der von Cotten sexuelle Betätigungen beschrieben werden, steht jener eines Hubert Fichte in nichts nach. Eindrücklich auch die Darstellung einer sich anbahnenden lesbischen Beziehung, die jedoch nur einseitig betrieben wird und im knappen Dialog "Tu n'aimes pas." "No." eine abrupte Abfuhr erfährt.
Solche Situationen der Ablehnung finden sich zuhauf in dem Band, und der Autorin scheint es ein besonderes Bedürfnis zu sein, das Neinsagen in der Liebe mit Gefühl und Verstand gleichermaßen zu erforschen. Als die Icherzählerin in "Seekühe der Kunst" einem zu klein und zu weich geratenen Amerikaner zu verstehen gibt, dass sie nicht gedenkt, mit ihm ins "Love Hotel" zu gehen, denkt sie: "Hier, in dem einen Moment, spürte ich etwas, nämlich die Bandbreite der möglichen Reaktionen: mich bei lebendigem Leib zerreißen, nach einem Gefühl für den Mann suchend wie in der Handtasche auf der Straße nach dem Portemonnaie; mich verblüfft hier hineinfallen lassen und womöglich ganz unerwartet von Zuneigungen dieses weichen Mannes erlöst werden [...] oder sich mit freundlichen Gefühlen verabschieden, wie ich es nun dreist in die Wege leitete, statt an den Menschen einer logischen Illusion von Logik hingegeben."
Den meisten Erzählungen stellt die Lyrikerin Ann Cotten auch noch ein Gedicht hinzu. Diese im lockeren, reimlosen Enjambement gefassten Texte unterstreichen ihren Drang zum hybriden Sprachkunstwerk, zum sprachlichen Gesamtkunstwerk (neo-)romantischer Prägung.
Die Gedichte fallen allerdings hinter die Behändigkeit der formalen Aneignung überkommener metrischer Schemata zurück, durch welche die beiden vorangegangenen Bücher überzeugt haben. Die formale Experimentierfreudigkeit der Autorin tobt sich aber ohnedies in den Erzählungen aus, wobei "Seekühe der Kunst" die Möglichkeiten der Rahmenerzählung auslotet und als Quadraterzählung gewissermaßen das Gegenstück zu Friedrich Achleitners "Quadratroman" bildet.