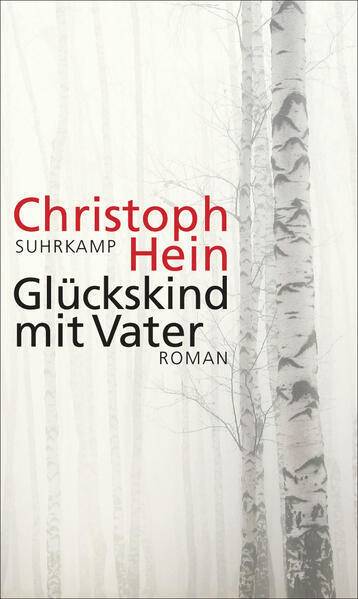Nach den Söhnen quälen sich die Enkel
Anja Hirsch in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 14)
Der Nazi im Stammbaum hat immer Saison. Drei Autoren schlagen sich mit der braunen Verwandtschaft rum
Spätestens seit Sabine Bodes Untersuchungen über die Kriegskinder sind Folgen früher Gewalt- und Hungererfahrung untersucht. Nach ihrem Buch über die Kriegsenkel hat aber auch die dritte Generation längst einen Symptomkatalog. Aufgewachsen unter kriegstraumatisierten Eltern plagt sie eine diffuse Lebensangst oder, wie Sacha Batthyany es formuliert: „So habe ich mich immer gefühlt: Als wäre ich nur halb da, als würde ich immer durchsichtiger.“ Familienrecherche mag da Abhilfe schaffen. Was aber, wenn die vermeintlich netten Verwandten tatsächlich Schuld auf sich geladen haben?
Diesem Thema stellen sich in diesem Bücherfrühjahr gleich eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren – erzähltechnisch am bemerkenswertesten der erwähnte Sacha Batthyany mit seinem Debüt „Und was hat das mit mir zu tun?“. Der 43-Jährige ist Schweizer Journalist mit ungarischen Wurzeln und gerade frisch verliebt, als ihn Boulevardblätter wie die Bild reißerisch über seine Tante Margaretha von Batthyány, geborene Thyssen-Bornemisza, aufklären: Tante Margit hatte im März 1945 während eines Fests auf ihrem Schloss im burgenländischen Rechnitz noch kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee etwa 200 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter ermorden lassen.
Sieben Jahre lang recherchiert Batthyany und beschreibt akribisch, wie er selbst sich lieber drücken möchte und dann doch alles in Bewegung setzt; beschreibt die peinlichen Zusammenkünfte einberufener Familienmitglieder, die alles verharmlosen; die Gespräche mit dem Vater, der jahrzehntelang geschwiegen hatte; und – besonders überzeugend – die Annäherung der beiden auf einer gemeinsamen Reise nach Sibirien, wo der Großvater in Kriegsgefangenschaft saß.
Flankiert wird diese persönliche Auseinandersetzung von Kriegstagebucheinträgen der Großmutter, die auf einem ungarischen Hof aufwächst und als Kind erlebt, wie ihre jüdische Freundin Agnes nach Auschwitz abtransportiert wird; und von Agnes selbst, die Auschwitz überlebt. Dann springt Batthyany in die 50er-Jahre, als die Großmutter mit ihrem nach zehnjähriger Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Mann hilfesuchend ausgerechnet bei Tante Margit strandet.
Die Szene ist eines der Herzstücke dieses mit verschiedenen Erzählformen experimentierenden Buches: Das unerträglich seichte Tischgespräch wird per Fußnoten von einer kritischen Erzählerstimme kommentiert. Die Vergangenheit verdichtet sich durch diese Stimme aus dem Off zu einer unheimlichen Melange aus unbeantworteten Fragen, Hypothesen und einigen nachweisbaren Fakten. Batthyany liefert zwar keine neuen Erkenntnisse zum Massaker auf Schloss Rechnitz, dafür die Entdeckung eines Geheimnisses, das der Kriegsenkel bis nach Buenos Aires zu Agnes bringt und das dieser eine neue Sicht auf den Tod der Eltern beschert.
Ganz anders gestaltet der als Krimiautor bekannt gewordene Österreicher Stefan Slupetzky seine Auseinandersetzung mit der NS-Schuld der Großvatergeneration. In seinem Roman „Der letzte große Trost“ endet die Entdeckung eines Täters in den eigenen Familienreihen beinahe im Wahn. Protagonist Daniel Kowalski – wie der Autor Jahrgang 1962 – erfährt durch den Brief einer Tante und durch eigene Recherchen, dass sein Großvater als Chemiefabrikant nicht nur am Ersten Weltkrieg gut verdient, sondern bereits 1925 unter Adolf Eichmanns Fittichen „in Österreichs Abenddämmerung das deutsche Morgengrauen“ erwartet hat.
Er lieferte nicht nur Zyklon B, sondern auch Vorschläge zur Beschleunigung des Tötungsvorgangs. Wegen dieses Großvaters, von dem sich Daniels Vater als jüngster Nachgeborener längst distanziert hat, stand das Haus, in dem Daniel selbst aufgewachsen ist, 17 Jahre lang leer; die jüdischen Verwandten, denen es eigentlich zustand, wollten es nicht übernehmen. Jetzt soll Daniel dort Kindheitskram abholen – und gerät in dieser „Gruft der zerbrochenen Seelen“ in einen Strudel tragischer Familienschicksale.
Zügig erzählt, überlagern sich diese Geschichten und Daniels verhältnismäßig unspektakuläre Erinnerungen an erste sexuelle Erlebnisse im Keller. Freundin folgt auf Freundin. Wie all diese Kriegsenkel laboriert auch Daniel an einer veritablen Identitätskrise, die sich mit den Nachforschungen noch verstärkt und ihn in eine manifeste Psychose stürzt. Doch wie schon bei Batthyany erwächst ihm Hilfe aus weiblicher Hand. Daniels umsichtige Frau Marion, mit der er Zwillinge hat, sorgt für den nötigen Realitätsschub.
Am mächtigen Gewicht der Opfer- und Tätergeschichten, mit denen „Der letzte große Trost“ aufwartet, haben der Roman und dessen Protagonist schwer zu tragen. Andererseits wird dessen Stillhaltereflex angesichts der Familienschuld sehr genau und mitunter sogar komisch beschrieben. Und als Schriftsteller ist Stefan Slupetzky krimiversiert genug, um für ein spannendes Finale zu sorgen. Das Bestreben, ein möglichst komplettes Bild der Herkunftsfamilie zu zeichnen, führt bei ihm wie bei Batthyany allerdings immer wieder dazu, die nötigen Informationen in den Text einzuarbeiten, was trotz der dramatischen Kämpfe, die die Protagonisten in ihrem Inneren auszutragen haben, mitunter eine gewisse Langatmigkeit zur Folge hat.
1944 geboren, gehört Christoph Hein nicht der Generation der Enkel, sondern jener der Söhne an. Sein Roman „Glückskind mit Vater“ erzählt von dem in Ostdeutschland aufgewachsenen Konstantin Boggosch, der erst als Jugendlicher die Wahrheit über einen Vater erfährt, von dem es immer nur geheißen hatte, dass er im Krieg gefallen sei. In Wirklichkeit hatte er eine Waffenfabrik im Dorf betrieben und mit dem Bau eines Kriegsgefangenenlagers begonnen (inklusive genauester Berechnungen, wie lange ein Häftling „einsetzbar“ sei) und war während seiner Flucht nach Polen nach einem nicht ganz legalen Prozess als Kriegsverbrecher gehängt worden.
Konstantin, der zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt ist, hat seinen Vater nie kennengelernt, ja er trägt nicht einmal dessen Namen, weil die Mutter ihn nach Kriegsende abgelegt hatte. Aber so sehr er sich auch bemüht, die Last der Vergangenheit loszuwerden, es will ihm nicht gelingen. Als man ihm den Zutritt zur Oberschule und zum Sportinternat verweigert, tritt er zu einer langen Reise an – eine Flucht, die misslingt, denn seine Arbeitgeber in Marseille entpuppen sich als ehemalige Mitglieder der Résistance und Gegner des Vaters.
Als Konstantin schließlich zur Zeit des Mauerbaus wieder zurück in den Osten kommt, wird der 16-Jährige als Republikflüchtling und „Aufnahmesuchender“ registriert. Auch hier überall Hindernisse: An der Filmhochschule in Babelsberg hätte man ihn sehr gerne aufgenommen, aber der Minister verhindert dies: „Die Akte“ weiß immer Bescheid. Weder Lüge noch Wahrheit helfen ihm, das Stigma des „Sohnes eines Verbrechers“ loszuwerden. Das „Glückskind“, mit dem die Mutter beim Einmarsch der Russen schwanger war – weshalb man sie verschonte –, fasst schließlich als Schuldirektor Fuß. Konstantin Boggosch übersteht Rauswürfe, die Wende und die Rente; er lehnt das Vermögen des Vaters ab, dessen „letztes Opfer“ er dennoch bleibt.
Auch bei Christoph Hein wird ein Leben im Spiegel der geschichtlich bedeutsamen Ereignisse mit vielen Stationen und Details nacherzählt. Die minutiösen Schilderungen und Aufzählungen sind zwar authentischer Ausdruck der Besessenheit, mit der Konstantin versucht, ein „richtiges“ Leben zu führen. Sie nehmen dem Roman allerdings auch viel von seiner Lebendigkeit.
„Glückskind mit Vater“ ist ein Roman, in dem alles Handeln und Denken auf den Prüfstein gelegt wird. Als Leser findet man sich in der Rolle eines Gutachters wieder, dem aber nur das seltsam unscharfe Selbstporträt eines wendigen Niemands vorliegt, der nicht greifbar wird und nirgendwo zu Hause ist, am wenigsten innerhalb der Beziehung: Für seine Frau, die mehr über seinen Vater erfahren möchte, bleibt er bis zum Schluss „der Schweiger“.
Lesetermine Stefan Slupetzky: 19.4. in der Seeseiten Buchhandlung (22., Janis-Joplin-Promenade 6/5); 21.4. in der Buchhandlung Lerchenfeld (8., Lerchenfelder Str. 50); 29.4. bei INTU.books (4., Wiedner Hauptstraße 13)