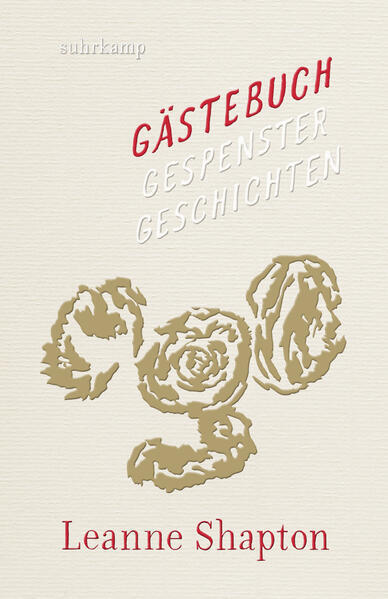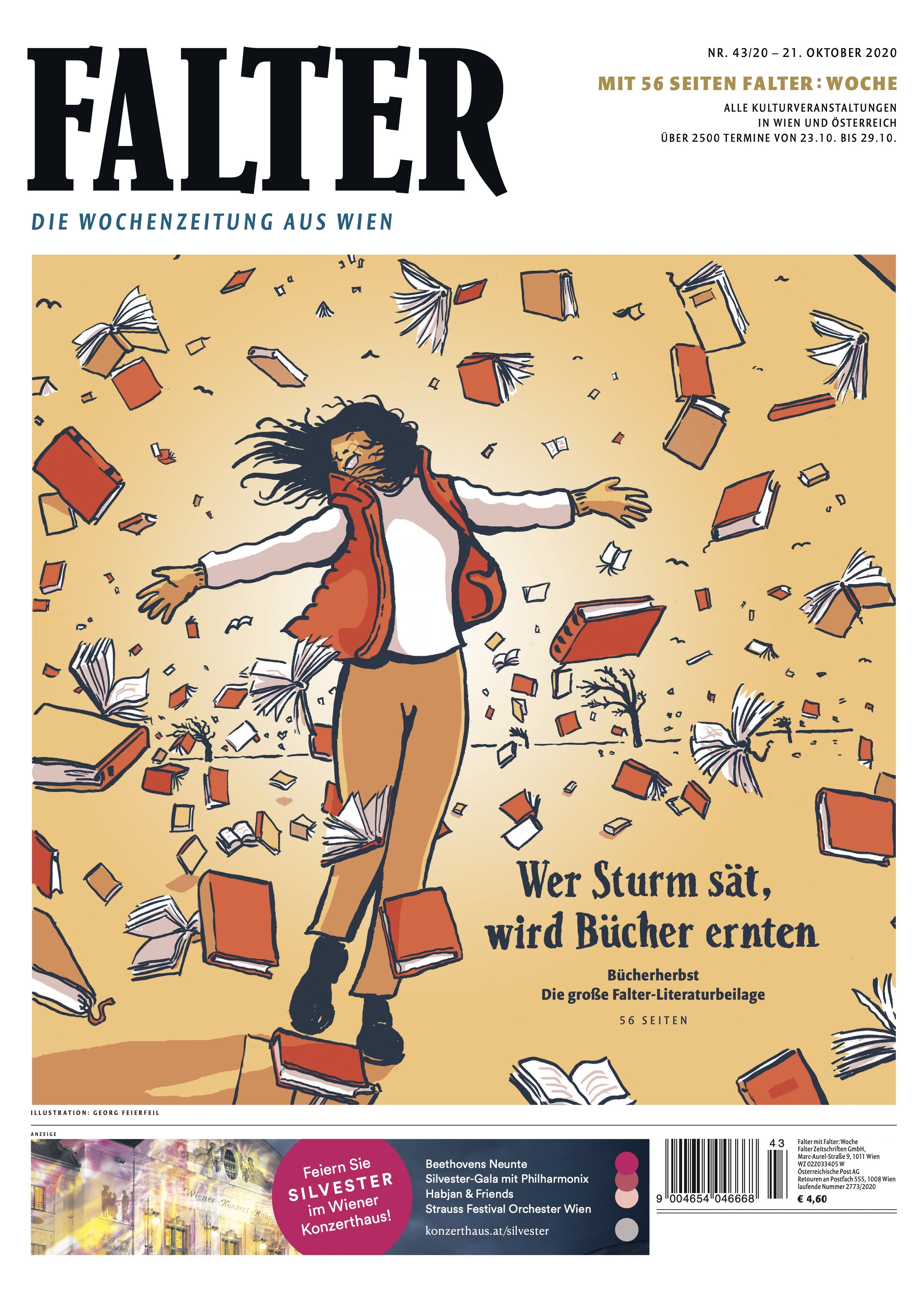
Großes Geistertennis
Jutta Person in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 10)
Wollte man sich eine Allstar-Galerie der Geister ausdenken, wären da zum einen die Klassiker mit dem Ektoplasma-Sabber im Mundwinkel, die Formvollendeten, die immer am Fußende des Bettes auftauchen, die Geruchspräsenzler oder die Ganzkörperverhüllten; zum anderen aber auch die funktional Modernen, die sich stets in denselben blauen Anzug werfen, die kalten Winde, die unheilslüstern durch den Schornstein fegen, die prophetischen Wasserflecken – oder die ganz Körperlosen, die nur eine Text-Bild-Schere brauchen, um völlige Desorientierung aufkommen zu lassen.
Leanne Shapton, die New Yorker Autorin, Künstlerin und Illustratorin, hat sie alle in ihrer Sammlung (bis auf die Ektoplasmatiker, die vielleicht endgültig aus der Mode gekommen sind). In ihrem „Gästebuch“ präsentiert sie 33 Kurzgeschichten oder vielmehr Kurzcollagen, die mit kunstvollen Arrangements aus Aquarellen, Stimmungsskizzen, Wohnungsgrundrissen und anderen Bizarrerien dem polymorph-pervers Unheimlichen auf der Spur sind: von der Fashion-Hipsterette, deren Vintagefummel womöglich aus dem Sarg der Urgroßmutter stammt, bis zu Billy Byron, dem Tennisprofi, der von einer imaginären Präsenz namens „Walter“ gequält wird.
Der besessene Billy ist die vielleicht typischste Figur dieser hemmungslos absurden Geister-Revue: Seine Lebensgeschichte besteht aus Schwarzweißfotos, deren Bildunterschriften zum Beispiel so klingen: „Während er seine Siegesserie fortsetzte, häuften sich die Berichte über sein unberechenbares Verhalten auf dem Platz. Es wurde beobachtet, dass er vor Aufschlägen und Satzbällen laut redete, wie zu einem unsichtbaren Begleiter, oder er schüttelte den Kopf und lachte.“ Walter ist bereits auf den – ebenfalls abgebildeten – Zeichnungen des etwa vierjährigen Billy zu sehen, der als Kind immer einen Tennisschläger für seinen Freund mitnimmt.
Allerdings mutiert Walter so etwa in den 1990er-Jahren zum Quälgeist; Billy Byron ist als Erwachsener zunehmend in den klassischen Tennis-Theater-Schmerz-Posen zu sehen. Die Fotos zeigen vollkommen unterschiedliche Spieler – aber Auge und Gehirn machen bereitwillig mit, wenn es darum geht, eine griffige Geschichte zu konstruieren. Jedes Bild hat einen Hof wie der Mond, der vom Text rückwirkend mit Sinnraketen befeuert wird.
Dieses Prinzip macht sich Shapton in beinahe jeder ihrer Geschichten zunutze – und deshalb braucht sie auch kein Ektoplasma, denn Fotos und Kommentare fabrizieren das Unheimliche ganz von allein. Dass etwas Drittes, Unausgesprochenes und trotzdem Anwesendes in den Ritzen sitzt, zeigt sich besonders dort, wo ein Wohnkomplex im Zentrum steht – „Komplex“ durchaus auch im medizinisch-psychiatrischen Sinne verstanden. Das Wohnen hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert zur Obsession entwickelt, und je heimeliger die Heime, desto unheimlicher deren Bewohner.
In einer Geschichte mit dem Titel „Heiligabend“ fragt eine ziemlich verlorene Ich-Erzählerin nach Geistergeschichten und landet schließlich mit Exmann und Kind bei den Nachbarn. Der lakonische Text wird kombiniert mit einer Serie knallbunter, terroristisch kitschiger Weihnachtsmuster: Glöckchen, Rehe und Tannenzweige als Emo-Waffen, die den größtmöglichen Kontrast zur Gefühlslage der Erzählerin darstellen. Ähnlich funktioniert das Prinzip in „Equalussuaq“, einer Geschichte über den Grönlandhai, der auf den Fotos nicht allzu attraktiv wirkt. Seine Fressgewohnheiten werden gegengeschnitten mit den „Menü- und Weinvorschlägen“ an Bord eines Kreuzfahrtschiffes: verstörende Nahrungsvernichtungsmaschinen unter- und oberhalb des Meeresspiegels.
In früheren Büchern hat Leanne Shapton das Bricolage- und Besessenheitsprinzip bereits in anderer Weise ausprobiert: „Frauen und Kleider“, veröffentlicht mit Sheila Heti und Heidi Julavits, war eine exquisit illustrierte Recherche quer durch die Kleiderschränke und deren Geheimnisse. Dass die Dinge zurückstrahlen, zeigte sich in „Bedeutende Objekte und persönliche Besitzstücke“, einem fiktiven Auktionskatalog, der eine unglückliche Liebesgeschichte bebilderte. „Bahnen ziehen“ war eine wasserfarbengesättigte Erinnerung an Shaptons Leistungsschwimmerinnen-Jugend im Kanada der 1980er-Jahre (New York kam erst später). Auch heute pflegt die Autorin, die statt Olympiaschwimmerin dann doch lieber Art-Direktorin wurde, eine intensiv-gestörte Beziehung zum Wasser, erfährt man in diesem Buch, das zudem eine Sammlung von Badeanzügen präsentiert – und auch hier entwickeln die Objekte ein unheimliches Eigenleben.
Die animierten Dinge funktionieren allerdings nicht überall gleich gut. Flair und Flimmern zwischen Text und Bild stellen sich nicht umstandslos ein, und gerade im „Gästebuch“ gibt es auch einige Geschichten, die ein bisschen dreist wirken: „Das Paar“ zum Beispiel verteilt drei Beziehungsklischeesätze großzügig auf einer ansonsten leeren Seite, dazu kommt das gut eingeführte Fotoprinzip mit einer historisierenden Kapitän-und-Dame-Serie, was in diesem Fall eher nach Zufallsgenerator aussieht.
Meistens aber erweisen sich Shaptons Gespenstergeschichten als großartige Gruselmaschinen. Der vermutlich furchtbarste Geist des Bandes heißt übrigens Edgar Mintz und trägt den eingangs erwähnten blauen Anzug. Am Freitag, 2. November 2018, so vermerken es die Kommentare zu den Fotos, erscheint er auf etwa 40 New Yorker Partys, Galas und Buchpräsentationen – gleichzeitig. Vielleicht muss diese arme Seele, gefangen im Ewig-grüßt-das-Murmeltier-Modus, ihre Kulturblasenmitgliedschaft bis in alle Ewigkeit vorführen. Aber das war natürlich vor Corona.