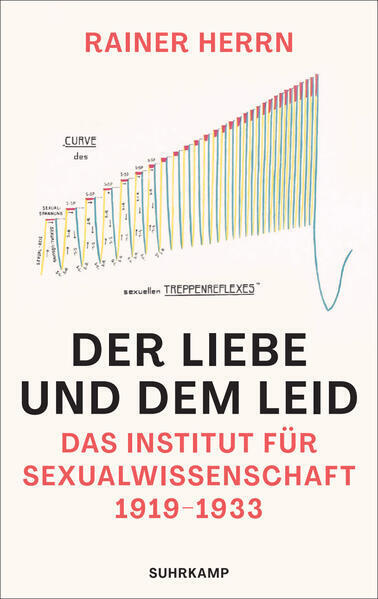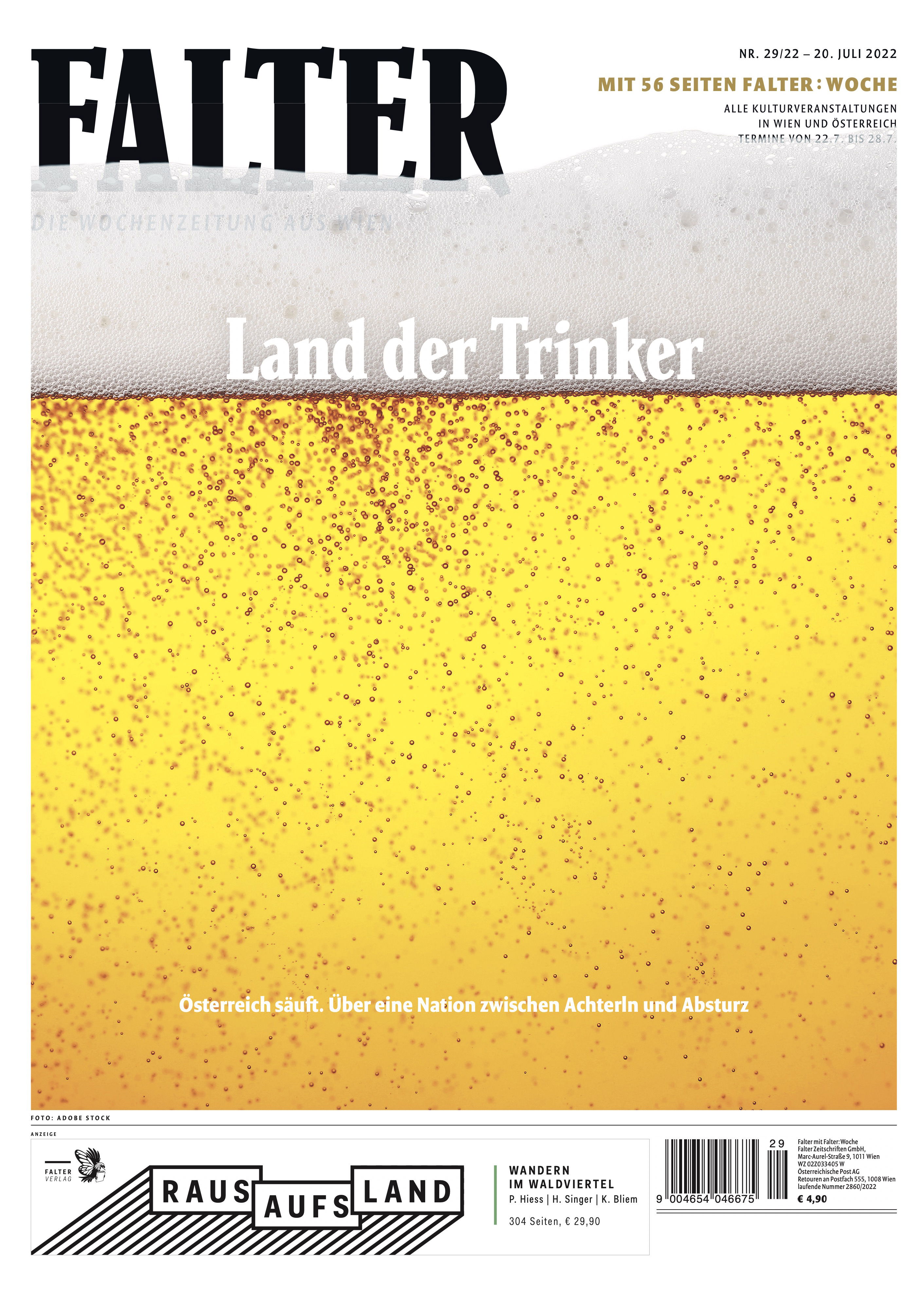
Der Einstein des Sex
Lina Paulitsch in FALTER 29/2022 vom 20.07.2022 (S. 24)
Ein Kinobesuch im Jahr 1922 wird alles im Leben von Rudolf Richter verändern. Der junge Mann lebt in einem Dorf im böhmischen Erzgebirge, auf der Flucht vor Erpressern, die ihn beim Sex mit Männern beobachtet hatten. Richter wird von seiner Familie zur Heirat gedrängt. Doch er kann nicht, Frauen liebt er nicht. Er fühlt sich selbst als Frau.
Im Kino sieht er einen Film über Tierversuche, bei denen weiblichen Ratten Hoden transplantiert wird. Einer der Schauplätze ist ein neuartiges Institut in Berlin, wo Sexualität "in all ihren Formen" beforscht und behandelt werden könne.
Richter bricht auf nach Berlin und beginnt ein neues Leben, unter den Fittichen von Magnus Hirschfeld, Arzt und Gründer des Instituts für Sexualwissenschaft. Hirschfeld erwirkt bei der Polizei den sogenannten "Transvestiten-Schein", damit Richter, der sich nun Dora nennt, Kosenamen "Dorchen", ungestraft Frauenkleidung tragen darf. Und er gibt Dorchen eine Bleibe als Hausangestellte am Institut.
Richter gilt als eine der ersten trans Personen, deren Lebensgeschichte Ärzte minutiös dokumentiert haben, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu ziehen. Und sie ist die erste trans Frau, deren Geschlecht chirurgisch angepasst wurde, acht Jahre nach ihrer Ankunft am Institut.
Diese und andere Figuren des Instituts für Sexualwissenschaft versammelt die 600 Seiten starke Publikation "Der Liebe und dem Leid" von Rainer Herrn, Medizinhistoriker an der Berliner Charité. 30 Jahre lang hat er dafür recherchiert, Briefe, Tagebucheinträge und Gerichtsgutachten ausgewertet. Durch die Geschichte führt ein honoriger Professor. Schnauzbart, runde Brille, Arztkittel. "Magnus Hirschfeld war ein Publikumsmagnet, er konnte eine ganze Kongresshalle füllen", erzählt Herrn am Telefon. "Anfang der 1920er waren seine Vorträge bedeutsam für die sexuelle Aufklärung einer ganzen Generation."
Der 1868 in Deutschland geborene jüdische Arzt gilt als Pionierfigur der LGBTIQ-Bewegung. Vor mehr als 100 Jahren entwarf Hirschfeld ein erstes Konzept fluider Geschlechtsidentität und kämpfte für die Rechte sexueller Minderheiten. Im Ausland taufte man ihn ehrfürchtig "Einstein des Sex", Prominente vom US-amerikanischen Komiker Buster Keaton bis hin zum japanischen Kaiser schätzten ihn. Daheim in Deutschland sah sich Hirschfeld dagegen Angriffen auf offener Straße ausgesetzt, er wurde bedroht und antisemitisch geschmäht. 1930 verließ er das Land, 1935 verstarb er an seinem 67. Geburtstag in Nizza.
Hirschfeld selbst war homosexuell und erwähnte dies auch in seinen Schriften. Mithilfe von Wissenschaft, so betont Herrns Buch immer wieder, wollte er auf die Gesetzgebung einwirken. Der Arzt und Sexualwissenschaftler versuchte medizinisch zu belegen, dass §175 -der Paragraf stellte Homosexualität zwischen Männern jahrzehntelang unter Strafe -nicht rechtens sei. Die "sexuelle Triebrichtung", so die These, sei nämlich angeboren, also weder kontrollierbar noch frei gewählt.
Um das zu beweisen, holte Hirschfeld den urbanen Untergrund an die Oberfläche. In "Berlins Drittes Geschlecht", einer Art queerem Stadtführer, beschreibt er abseitige Orte der damals drittgrößten Stadt der Welt. Und deren "homosexuellen Einschlag", welcher "den Charakter des Ganzen wesentlich beeinflusst": Um die Jahrhundertwende und in den Goldenen 1920er-Jahren war Berlin eine schillernde Metropole für Glücksspiel, Drogen und Prostitution; vielerorts öffneten Bars für Lesben und Schwule ebenso wie Transvestitentreffs. Hirschfeld wollte das Allgegenwärtige -Sex - auch als medizinisches Fach etablieren.
Die Gründung des Instituts für Sexualwissenschaft im Jahre 1919 krönte diese Bestrebung. Anlässlich seines 50. Geburtstags kaufte Hirschfeld das Gebäude am Berliner Tiergarten, vermutlich mit eigenen Ersparnissen. Eine nicht zufällige Ortswahl: Im nächtlichen, kaum beleuchteten Tiergarten fand sich neben dem illegalen Strich auch der "schwule Weg", ein Treffpunkt Homosexueller. Für sie und andere wolle das Institut eine Zufluchtsstätte sein, erklärte Hirschfeld bei der Eröffnung. Ein geschützter Ort, an dem sich keiner vor Polizei und Strafe zu fürchten brauche.
30 Prozent der Menschen, die Hirschfeld aufsuchten, waren homo-, inter-oder transsexuell. Dabei spielten genitalchirurgische Behandlungen von "Transvestiten", wie er diese Personen nannte, anfangs kaum eine Rolle. Erst als immer mehr Menschen ans Institut kamen, die an Selbstmord dachten, sollten sie nicht "ihre Geschlechtsteile nach ihrer Seele formen" können, wurden die ersten Operationen von institutsnahen Chirurgen durchgeführt.
Diese Eingriffe waren durchaus riskant. Die damals bekannteste Transformation, festgehalten in der Biografie "Ein Mensch wechselt das Geschlecht", durchlebte Lili Elbe. Bei der Bucherscheinung 1932 war sie bereits verstorben, vermutlich an den Folgen einer operativen Odyssee. Nach einer Penisamputation versuchte man Lili Elbe Eierstöcke zu transplantieren, die ihr Körper abstieß.
Zwei Drittel der Klientel waren Männer, ein Drittel Frauen, die meisten davon heterosexuell. Zu den alltäglichen Attraktionen zählten Aufklärungsfilme und Vorträge zum Schutz vor Sexualkrankheiten, aber auch Beratungen bei Eheproblemen oder zu Hygiene und Menstruation. Als legendär galt die sogenannte "Zwischenstufenwand". Vom Boden bis knapp unter die Decke hatte Hirschfeld Fotografien und Grafiken von Forschungsobjekten -nackten sowie bekleideten Menschen -angepinnt. Veranschaulicht wurde so seine wissenschaftliche Leitidee, die "Zwischenstufentheorie".
Hirschfeld ging von einem männlichen und einem weiblichen Pol aus, zwischen deren Eigenschaften jeder Mensch oszilliere. Graubereiche gebe es bei der Ausprägung der Geschlechtsorgane, bei körperlichen Eigenschaften wie Muskeln oder Bartwuchs, bei der sexuellen Orientierung und der sexuellen Identität. Die Zahl der denkbaren "Sexualtypen" war für ihn unendlich, eine rein männlich oder rein weibliche Person dagegen die Ausnahme. Zur Norm machte er so das Abnorme, allerdings ohne sich vom binären Geschlechtermodell zu verabschieden.
Anders als in der konkurrierenden Psychoanalyse argumentierte Hirschfeld rein biologisch. Er glaubte etwa, dass Homosexualität ihren Ursprung in weiblichen Hormonen habe, die in den Hoden von Homosexuellen produziert würden. Tatsächlich gab es Operationen, bei denen vermeintlich homosexuelle durch am Schwarzmarkt erstandene heterosexuelle Hoden getauscht wurden. Bewirkt hat die Transplantation der "supervirilen" Hoden nichts: Die jungen Männer waren nachher immer noch homosexuell und außerdem gebrochen, wie überlieferte Briefe in Rainer Herrns Buch eindrücklich und erschütternd bezeugen.
Solche Berichte verdeutlichen das Dilemma, in dem sich Hirschfelds Denken verstrickte. Zwar kämpfte er gegen die Bestrafung von Homosexualität und versuchte, deren gängige psychiatrische Einordnung als Perversion zu entkräften. Gleichzeitig wollte er "helfen", sollte ein Mann den Wunsch nach Kastration äußern. Heute mag das zynisch anmuten, im Kontext der Zeit zählte der praktische Nutzen. Denn Homosexualität trieb selbst im liberalen Berlin Männer in den Selbstmord, viele wurden erpresst und ihrer finanziellen Existenz beraubt.
Von Beginn an kämpfte das Institut mit Gegenwind. Anerkannte Kollegen wetterten gegen Hirschfeld und argumentierten mit der niedrigen Geburtenrate. Im Ersten Weltkrieg waren viele junge Männer gestorben, die Bevölkerung solle sich jetzt bloß nicht von der Vermehrung ablenken lassen, so der wissenschaftliche Duktus. Aus Angst vor der "Ausbreitung" von Homosexualität forderte gar die Mehrheit der Psychiater, "homosexuelle Propaganda" und "Werbung" unter Strafe zu stellen. Genau das also, was heute etwa die LGBTIQ-feindliche ungarische Regierung in die Tat umsetzt.
In Deutschland schaffte man den §175 erst 1994 gänzlich ab, Hirschfeld kämpfte vergebens. Immer aggressiver wurden die Anfeindungen in den frühen 1930ern; Hitlers Machtübernahme 1933 markierte ein jähes Ende für die Sexualwissenschaft. Bei den Bücherverbrennungen plünderten und zerstörten Nationalsozialisten das Institut. Johlende Studenten trugen die Büste Hirschfelds auf die Straße und warfen sie ins Feuer. Unter "Sieg Heil"-Rufen landeten die gesamte Literatur und sämtliche Forschungsdokumente des "Kinder-und Sittenschänders" in den Flammen.
Dorchen Richter, die erste trans Frau, gilt seit diesem Tag als verschollen, vermutlich wurde sie von den Nazis ermordet. Der Institutsgründer selbst war zu dieser Zeit bereits nach Frankreich geflohen. Für den Medizinhistoriker Rainer Herrn liegt Hirschfelds großes Erbe in der "subjektorientierten Auffassung" von Sexualität.
"Wir haben kein Recht, einem Menschen, der Weib sein will, zu sagen: 'Du bist ein Mann' oder jemandem, der ein Mann sein möchte, zu befehlen: 'Bleibe Weib'", schrieb dieser etwa 1907 in einem Gutachten über die Geschlechtsfeststellung einer intersexuellen Person. Ob sie dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet würde, könne er als Arzt nicht entscheiden, nur die betreffende Person selbst.
"Bis in die jüngste Vergangenheit galt es als durchaus üblich, intersexuell geborene Kinder über genitalchirurgische Eingriffe geschlechtlich zu vereindeutigen", erklärt Herrn. "Sehr häufig waren diese Kinder später mit der Vereindeutigung gar nicht einverstanden und haben stark darunter gelitten. Diese Erfahrung lehrt uns, dass wir stärker damit umgehen lernen müssen, Ambivalenzen besser zu ertragen."
Herausfordernd waren diese Ambivalenzen schon vor 100 Jahren innerhalb des Instituts. In Aufzeichnungen beschrieb Hirschfeld, wie sich Homosexuelle klar von Transsexuellen abzugrenzen versuchten -und umgekehrt. Es habe eine Tendenz gegeben, sich von noch stärker stigmatisierten Identitätsformen zu distanzieren: "Sich viril verstehende Homosexuelle lehnten häufig die Effemination ab, heterosexuelle Transvestiten dafür den Homosexualitätsverdacht. Auch das lässt sich heute noch in den Communitys beobachten."
Einen klaren Fortschritt sieht der Buchautor im Selbstbestimmungsgesetz, das kürzlich in Deutschland verabschiedet worden ist - zeige die Geschichte doch, wie viele Menschen bisher unter der ärztlichen und juristischen Bevormundung gelitten hätten. Nun kann das Geschlecht auf dem Papier durch einen einfachen Behördengang geändert werden. Dass trans Frauen Bio-Frauen in ihren Schutzräumen stören könnten, hält Herrn für ein Scheinargument. "Eigentlich geht es um den Zwang der Zuordnung, den wir brauchen, um uns selbst zu versichern", sagt der Medizinhistoriker. "Wir müssen erst lernen, entspannter zu sein und Verschiedenheit auszuhalten."