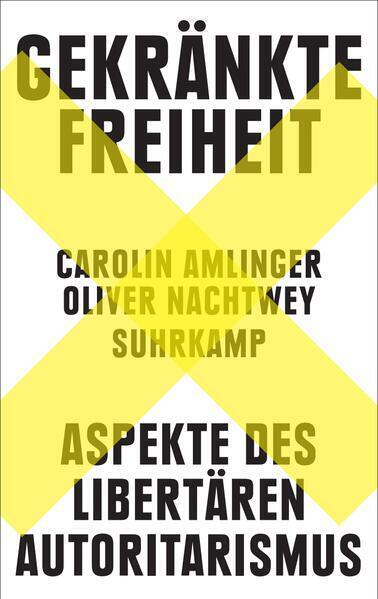Freiheitssinnig und autoritär zugleich
Barbaba Tóth in FALTER 43/2022 vom 26.10.2022 (S. 21)
Wer erinnert sich nicht? Yogis neben Glatzköpfen mit Springerstiefeln, dazwischen besorgte Mütter mit Kleinkindern im Buggy und Identitäre in Hipster-Kluft: Die Querdenker-Demonstrationen während der Pandemie nährten sich aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Sie als "rechts" hinzustellen, griff eindeutig zu kurz. Im Gegenteil. Viele, die sich als "links" oder "liberal" einstufen, marschierten mit.
Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben die Bewegung begleitend erforscht und legen jetzt einen dichten Befund ihrer Erkenntnisse vor. "Gekränkte Freiheit" heißt ihr Buch. Denn das Gefühl, in seinen individuellen Rechten eingeschränkt worden zu sein, ist ein gemeinsamer Nenner der Querdenker-Bewegung. Aus vielen Tiefeninterviews, Analysen alternativer Medienkanäle und Online-Umfragen destillieren sie einen neuen "Protesttyp" heraus, den sie den oder die "libertäre(n) Autoritäre(n)" nennen.
Das klingt wie ein Widerspruch. Wer libertär, also freiheitsliebend ist, kann doch nicht gleichzeitig autoritär sein? Doch, argumentieren die beiden. Die Menschen, die sie trafen, wurden oft links oder liberal sozialisiert, Selbstverwirklichung und -bestimmung sind für sie wichtige Werte. Ohne Einschränkungen reisen, konsumieren, reden und handeln zu können ist für sie normal. Weil sie oft der Mittelschicht angehören, haben sie den Staat nicht als übergreifend erlebt, anders als etwa Menschen, die ohne Arbeit sind und den Weg zu Ämtern und die vielen damit verbundenen Auflagen kennen.
In der Pandemie änderte sich das radikal. Ihr Freiheitsethos stieß an Grenzen, die Klima-und Energiekrise engt sie weiter ein, aber auch die neue Geschlechtergleichstellungsbewegung. Maske tragen, nicht mehr so viel und schnell Auto fahren, sich vorschreiben lassen, wie man Männer und Frauen in der Sprache kenntlich macht ("sensible Sprache") - all das irritiert sie massiv. Ihr absolutes Freiheitsverständnis verhärtet sich so sehr, dass es zu einer "Drift" ins Autoritäre kommt, beobachteten Amlinger und Nachtwey.
Es kommt dabei aber nicht zu einer Identifikation mit einem starken Führer oder zur Identifikation mit konventionellen, konservativen Werten wie beim klassischen autoritären Typus. Die autoritär motivierte Aggression richtet sich gegen Personen und Institutionen, die angeblich ihre individuellen Freiheitsrechte missachten. Das kann nach oben ausschlagen, also gegen den Staat oder Eliten. Oder nach unten, gegen kulturelle Minderheiten wie Muslime oder die LGBTQ-Community.
Bei der Mehrheit der Studienteilnehmer-und teilnehmerinnen"zeigte sich ein ausgeprägt spirituelles, esoterisches und anthroposophisches Denken, für das Ganzheitlichkeit, Natürlichkeit oder Vertrauen in den eigenen Körper elementar sind".
Amlinger und Nachtwey stellen im Buch exemplarische "Archetypen" als Fallstudien vor. "Frau Weber", angehende Pädagogin, etwa meditiert, ernährt sich vegan, zweifelt an den staatlichen Hygienemaßnahmen, fühlt das Kindeswohl gefährdet, glaubt, dass sie mehr Durchblick hat, und fühlt sich so erhaben gegenüber den "Schlafschafen", die alle Regeln brav befolgen. Für sie sind Medien "gleichgeschaltet", sie misstraut dem Mainstream.
Oder "Herr Rudolph", ein verarmter Fabrikantensohn, der immer Grün gewählt hat und jetzt die AfD wählt. Er fühlt sich im Abstieg, von seiner Familie nicht mehr geschätzt, ist "leicht erregbar", hat Angst vor der "Überfremdung" und wünscht sich einen erlösenden "Donnerknall".
Was bedeutet diese "Drift" für unsere Demokratie? Nichts Gutes. Libertäre Autoritäre misstrauen der Politik, sie orten ein vermeintlich "linksliberales Establishment", ja sogar quasi diktatorische Züge, analysieren Nachtwey und Amlinger. Sie lesen Krisen - Energiekrise, Klimakrise, Pandemie -nicht als gesellschaftliche Konflikte, sondern als individuelle Angelegenheiten. Ihr Blick auf die Welt ist fragmentiert, die großen Zusammenhänge fehlen. Klassendenken? Kapitalismuskritik? Solche emanzipatorischen POVs (points of view, aka Sichtweisen) erreichen sie deshalb nicht mehr. Gemeinsame Utopien, die die Linke einst ausmachten, kennen sie nicht. Am ehesten hängen sie einer unbestimmten, nostalgischen "Retrotopie" an, wie der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman das genannt hat. Alles möge so werden, wie es vermeintlich einmal war.