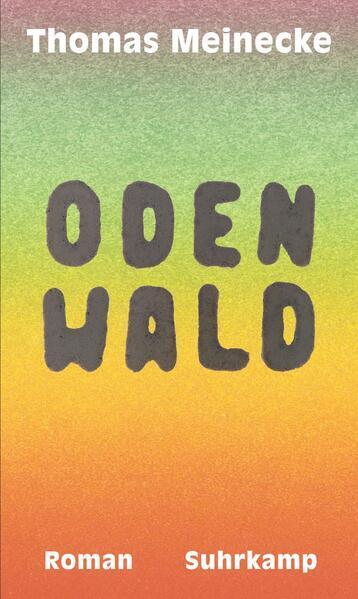Im diskursiven Rauschen des Odenwaldes
Tobias Heyl in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 18)
Amorbach sei der einzige Ort auf diesem fragwürdigen Planeten, in dem er sich im Grunde noch zuhause fühle, schrieb Theodor Wiesengrund Adorno im Januar 1968 an Annemarie Trabold, die ebendort ein Schreibwarengeschäft führte. Mit Mutter und Tante hatte der Knabe Teddie immer wieder das winzige Städtchen im bayerischen Odenwald besucht.
In dem Band „Ohne Leitbild“ beschwört Adorno diese Jahre noch einmal herauf, ein Stück melancholischer Erinnerungsprosa, das bereits in der Kindheit Motive seines späteren Denkens ausmachen will: radikale Kritik der falschen Verhältnisse; die Kunst als Gegenpol zur beschädigten Welt und dabei besonders das Werk Richard Wagners, mit dem er in Amorbach zum ersten Mal in Berührung gekommen sein will, wo ein Bühnenbildner der Bayreuther Festspiele in seinem Atelier regelmäßig Besuch von Sängerinnen und Sängern empfing.
Mit seinem neuen Roman kehrt Thomas Meinecke, über den sich die Experten nicht einig werden, ob er nun zu den Pop-Literaten zählt oder eher doch nicht, in den Odenwald zurück; schon „Tomboy“ von 1998 hatte dort seinen Schauplatz. Nun aber speziell Amorbach, wo eine der Figuren, die wohl nicht zufällig den gleichen Vornamen wie der Autor trägt, in Emichs Hotel absteigt, das, als es noch die Wiesengrunds beherbergte, Hotel Post hieß. Um ihn herum versammelt sich ein Ensemble von Figuren, die teilweise schon in früheren Romanen Meineckes unterwegs waren, zu einer lockeren Gesellschaft, in der Forschungen sehr unterschiedlicher Art präsentiert, diskutiert und weitergesponnen werden: Psychoanalyse, Mediävistik, Neuere Geschichte, Musikwissenschaft – Gendertheorie nicht zu vergessen.
Beim Lesen verirrt man sich recht bald in einen wuchernden Wald aus Geschichten und Theorien. Da geht es erst einmal um die Ortsgeschichte Amorbachs, die ein wenig kompliziert verlaufen ist, wie man das von der deutschen Kleinstaaterei so kennt.
Amorbach kam 1803 zum frisch gegründeten, aber nur kurzlebigen Fürstentum Leiningen, das in jüngerer Zeit Aufmerksamkeit fand, als sich Prinzessin Gabriele von Leiningen 1998 von ihrem Ehemann trennte, zum Islam konvertierte und Karim Aga Khan IV heiratete – überschattet von einem spektakulären Scheidungsprozess.
Auch ihr gönnt Meinecke mehrere Auftritte, zitiert mit bisweilen gnadenloser Ausführlichkeit die einschlägigen Quellen, gerne auch auf Englisch; vergisst natürlich auch nicht Viktor zu Leiningen-Westerburg-Altleiningen, der als Mitbegründer des „Mainzer Adelsvereins“ zwischen 1844 und 1849 die Auswanderung von vielen tausend Deutschen nach Texas organisierte. Da trifft es sich gut, dass Meinecke schon im Herbst 2023 Teile des Romans am Texas Language Center vorstellen konnte: Auch davon erzählt der Roman.
Der erzählerischen Imagination hat Meinecke schon immer misstraut und stattdessen Versatzstücke aus unterschiedlichsten Diskursen aneinander montiert. Bringt man gehörig Zeit und Geduld für die Lektüre auf, wird ein Netzwerk von Bezügen erkennbar, das auch noch Adornos Amorbach-Essay mit einschließt und als philosophischer Text genauso gelesen werden kann wie als ein Stück Literatur.
Ähnlich verfährt Meinecke, wenn er theoretische Texte als literarisches Material verwendet, aus ihrem ursprünglichen Kontext löst und den Kräften der Assoziation aussetzt. Von der binären Ordnung der Geschlechter bleibt auch hier nicht viel übrig, was damit zusammenpasst, dass auch Meineckes fluide Texte die strikte Unterscheidung von Literatur und Theorie sabotieren. Sie stehen für sich, gigantische Denk- und Erzählmaschinen, reich bestückt mit Schnittstellen, die auf Imaginationen, Geschichten und Archive aller Künste und Wissenschaften zugreifen, ein diskursives Ökosystem, so dunkel und undurchdringlich wie der Odenwald.