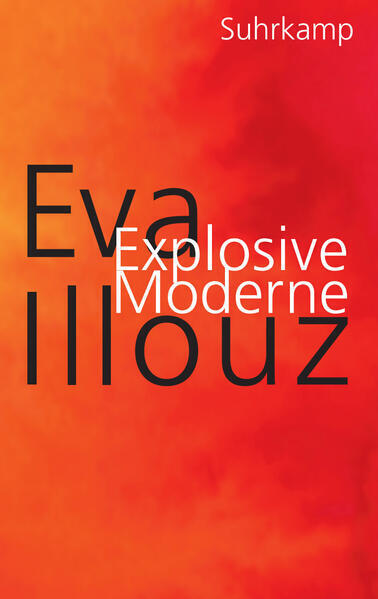Wo Enttäuschung nagt, ist die Wut nicht weit
Gerlinde Pölsler in FALTER 4/2025 vom 22.01.2025 (S. 19)
Die Allerzornigsten sind laut einer Gallup-Erhebung die Amerikaner. Aber auch im weltweiten Schnitt bezeichnen sich 22 Prozent der Menschen als zornig. "Neuerdings scheinen alle auf hundertachtzig zu sein", schrieb die New York Times: "Und zwar die ganze Zeit." Der Zorn wiederum sei laut Forschungen der stärkste Antrieb, autoritäre Politiker zu wählen, zitiert die Autorin Eva Illouz einschlägige Studien.
Da stimmt doch was nicht, fand die israelisch-französische Soziologin und Autorin viel beachteter Bücher über Liebe, Kapitalismus und Antisemitismus: Psychische Probleme und Suizide nehmen zu, gefährliche Gefühlsgemengelagen brodeln vor sich hin. Doch die Menschen fühlten sich für ihre Krisen allein verantwortlich und glaubten, sie müssten bloß zur Therapie, was eine "hochlukrative Branche der Selbstoptimierung" hervorgebracht habe. Doch das sei Bullshit: Gebe es doch "gewaltige Risse im Sozialgefüge infolge von Kapitalismus, Liberalismus, Globalisierung und Ungleichheit", Wut, Angst, Neid: Die Moderne und ihr mentaler Unterbau befeuerten diese Emotionen geradezu.
Vergebliche Hoffnungen Nehmen wir das Gefühl der Enttäuschung. Im Mittelalter hegten Menschen bloß bescheidene Ziele: Ein Bauer wollte ein größeres Feld oder die Tochter des Nachbarn heiraten. Der Spielraum für Veränderungen war überschaubar, "und man glaubte auch nicht, dass er nur von den eigenen Anstrengungen abhing". Heute dagegen schüren die Idee der Gleichheit und das Versprechen vom Aufstieg durch Leistung hochfliegende Hoffnungen. Dabei, so Illouz, "geht die überwältigende Mehrheit aller Hoffnungen und Träume nie in Erfüllung". Konnten sich etwa früher viele Menschen aus kleinen Positionen in Führungsfunktionen hinaufarbeiten, so besetzen diese heute Uni-Absolventen. Betriebe bauten mittlere Führungsebenen ab, stattdessen kumulieren Konzernbosse Macht und Bezüge in ungeahntem Ausmaß. Enttäuschung macht sich breit. Selbst bei Bildungsaufsteigern: Illouz zitiert Untersuchungen, wonach Menschen aus der Arbeiterklasse auch als Akademiker weniger schnell aufsteigen als ihre Kollegen.
Rollen unterlaufen
Bei alledem pocht die zeitgenössische Kultur darauf, dass jeder sein Schicksal selbst gestalte. Jede geplatzte Hoffnung sei daher mit einer noch schlimmeren Enttäuschung verbunden: der von sich selbst. Armut gilt da nicht mehr als Unrecht, sondern erzeugt Scham. Und wo Enttäuschung nagt, sind Neid und Wut nicht weit. Wobei der Zorn heute als legitim gelte und via soziale Medien im Nu Massen infiziere.
Man könnte bekritteln, dass Illouz Begriffe und Ären oft nicht scharf abgrenzt: Was hat etwa der Kapitalismus schon in seiner Entstehungszeit ausgelöst, was entstand erst in jüngerer Zeit? Doch das wiegt nicht allzu schwer angesichts der insgesamt treffenden, scharfen Zeitdiagnose.
Nur -was jetzt? In die mittelalterliche Ständegesellschaft will auch keiner zurück. Illouz' Vorschlag: Man mache sich bewusst, wie sich im inneren Leben das Kollektive mit dem Autobiografischen verbindet. Als Beispiel nennt sie das Buch "Weiblichkeitswahn" von Betty Friedan aus 1963, das Millionen von Hausfrauen dabei half, ihren Frust und ihre Aggressionen nicht mehr als persönliches Versagen zu sehen. Es gehe darum, unsere Rollen zu unterlaufen. Das ist freilich leichter gesagt als getan. Immerhin könne man dann "manchmal Revolutionen auslösen, private oder kollektive".