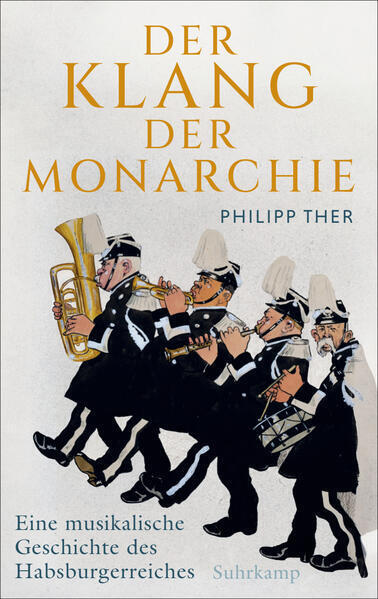Politik im Walzertakt
Klaus Nüchtern in FALTER 48/2025 vom 26.11.2025 (S. 34)
Das berühmte "Ta-ta-taa, ta-ta-taa, ta-taramm-tamm-tamm", das Jahr für Jahr den Saal des Wiener Musikvereins zum Mitklatschen animiert, begleitete am 27. Juni 1866 Tausende in den Tod. Zwar konnte die k. u. k. Armee in der Schlacht von Trautenau im Deutschen Krieg die Truppen des Rivalen Preußen zurückschlagen, doch erwies sich der militärische Erfolg als Pyrrhussieg. 4787 österreichische Soldaten blieben auf dem Feld tot oder schwer verletzt liegen. Ein Gemälde der Schlacht im Heimatmuseum von Trautenau (heute das tschechische Trutnov) zeigt im Vordergrund des Bildes einen gefallenen Trommler.
Als nur eine Woche später die Niederlage Österreichs in der Schlacht von Königgrätz endgültig besiegelt wurde, lag der Namensgeber des berühmten Musikstücks selbst allerdings schon seit acht Jahren unter der Erde. Wird heute gefordert, den unzeitgemäß martialischen "Radetzky-Marsch" aus dem Programm des Neujahrskonzertes zu nehmen, so kann man ergänzen, dass dieser schon zur Zeit seiner Entstehung keineswegs "unschuldig" war. Mit der Widmung an den im Kampf gegen die italienische Unabhängigkeitsbestrebungen erfolgreichen Feldherrn hatte Johann Strauss Vater auch eine klingende Loyalitätsbekundung an das Herrscherhaus abgegeben. Entstanden war der Marsch nämlich just um den 23. August 1848. An diesem Tag hatte die bürgerliche Nationalgarde in der sogenannten "Praterschlacht" das Feuer auf protestierende Arbeiter und Arbeiterinnen eröffnet, 22 von ihnen getötet und damit das Ende der Revolution eingeläutet, die im Oktober des Jahres endgültig blutig niedergeschlagen werden sollte.
Prekär war die Komposition nicht nur politisch, sondern auch familiär, denn sowohl Johann Strauss Vater als auch dessen damals 22-jähriger Filius gleichen Namens waren Mitglieder besagter Einheit. Johann Strauss Sohn löste seinen Gewissenskonflikt, indem er sich am Tag der Praterschlacht einfach aus seiner Kompanie davonstahl. Er sollte seinen Sympathien für die Revolution vorerst treu bleiben und sich ausgerechnet einen Tag nach der Inthronisierung Franz Josephs I. dazu hinreißen lassen, in einem Gasthaus mit seiner Kapelle die "Marseillaise" zu spielen. Das Polizeiverhör, dem er sich daraufhin unterziehen musste, dürfte einen Gesinnungswandel bewirkt und ihn dazu bewogen haben, sich mit dem "Kaiser-Franz-Joseph-Marsch" und der dem russischen Zaren gewidmeten "Nikolai-Quadrille" dann doch den reaktionären Potentaten des Kontinents anzudienen.
Noch ärger trieb es der Herr Papa, der ein Jahr nach dem "Radetzky-" noch einen "Jellacic-Marsch" nachschob -zu Ehren des kroatischen Ban und Feldherrn Joseph Graf Jelačić von Bužim, der sich mit seinen marodierenden Truppen bei der Niederschlagung der 48er-Revolution besonders hervorgetan hatte. Mit diesem musikalischen Manifest "überspielte" Strauss Vater auch den Umstand, dass die Revolutionskriege (jüngsten Schätzungen zufolge) mindestens 100.000 Opfer gefordert hatten.
In seinem soeben erschienenen Buch folgt der Historiker Philipp Ther, Professor an der Uni Wien und Wittgenstein-Preisträger des Jahres 2019, nicht nur der blutigen Spur des Radetzky-Marsches, sondern macht sich überhaupt daran, den "Klang der Monarchie" zu rekonstruieren.
Der geschilderte Fall von Johann Strauss Vater und Sohn ist nicht der erste und nicht der letzte, in dem Komponisten einem Imperium, das militärisch, ökonomisch und politisch immer wieder in Bedrängnis gerät, musikalische Schützenhilfe leisten. Nach der Napoleonischen Expansion und dem verlorenen Deutschen Krieg geht der Dynastie zwar "der Status als erstrangige Großmacht verloren, aber als Ersatz bauten die Habsburger ein internationales Prestige als Kulturstaat auf".
Als Ressource zur Imagepflege wird die Musik freilich nicht erst im Vormärz und Neoabsolutismus herangezogen, sondern schon in den Jahrhunderten davor von Adelsdynastien und Herrscherhäusern weidlich genutzt. Dem sich mit barockem Prunk inszenierenden Fürsten Nikolaus I. Esterházy de Galantha stand auf seinem Sitz in Eisenstadt ein dreihundertköpfiges Dienstpersonal zur Verfügung, zu dem man auch den jungen, ab 1760 dem Hofstaat angehörenden Joseph Haydn zählen kann, war er doch dem Rang eines Kammerdieners gleichgestellt.
Ehe er im Laufe seines 77 Jahre währenden Lebens zum "ersten wirklich freien Komponisten des Habsburgerreiches" aufstieg, hatte der Hofmusicus täglich vor seinem Brotherrn zu erscheinen und "die Hochfürstl.e Ordre" abzuwarten, "ob eine Musique seyn solle?" Zwei Opern-und vier Konzertabende pro Woche standen im Schloss Esterházy auf dem Programm. Außerdem komponierte Haydn für den Fürsten nicht weniger als 125 Baryton-Trios, vielfach in A-Dur, weil Nikolaus das Spiel auf dem damals populären, gambenartigen Streichinstrument mit Resonanzsaiten zunächst nur in dieser Tonart beherrschte.
Nach dem Tod von Nikolaus I. wurde Haydn von dessen Nachfolger in Pension geschickt. Als freigesetzter Komponist verließ er die Eisenstädter "Einöde" und reiste nach London, wo er nicht nur den Titel eines "Doctor of Music", sondern auch internationalen Ruhm sowie ein Vermögen erwarb. Nach heutigen Maßstäben war er Multimillionär und ökonomisch dem in Hinblick auf das Herkunftsmilieu bessergestellten, aber zeitlebens mit Geldnöten kämpfenden Mozart buchstäblich "haushoch" überlegen: Haydn erwarb ein Haus in Gumpendorf, sein um ein Vierteljahrhundert jüngerer Freund und Kollege konnte ein vergleichbares Vermögen nicht annähernd vorweisen; weswegen Mozart auch das Bürgerrecht versagt blieb. Er war kein Wiener und somit auch kein Österreicher (zu dem das vormalige bayerische Erzbistum Salzburg erst nach dem Wiener Kongress kam).
Ein besonderes Asset von Thers materialreicher Studie besteht darin, dass von den zahlreichen darin erwähnten Kompositionen über 60 per QR-Code auf einer Streamingplattform abgerufen und nachgehört werden können. Zum Beispiel der Huldigungswalzer für Queen Victoria. Während eines ausgedehnten London-Aufenthaltes, bei dem er nicht weniger als 79 Konzerte gab, gastierte Johann Strauss Vater im Mai 1838 auch im Buckingham Palace und brachte sein mit Zitaten aus "Rule Britannia!" und "God Save the Queen" geschmücktes Werk in Anwesenheit der jungen (noch ungekrönten) Monarchin zur Aufführung.
Hatte Strauss Vater als erster Star des Habsburg-Pop in der Pop-Metropole London für Furore gesorgt, so gelang dem Sohn der Sprung über den Großen Teich, wo er zum Stadionrocker avancierte. 1872 trat er im Rahmen des World's Peace Jubilee and International Musical Festival in Boston drei Wochen lang in einer Music Hall mit einem Fassungsvermögen von 30.000 Zuhörern auf. Vom zentralen Podium aus dirigierte er die 800 im Raum verteilten Musiker, der Sound dürfte entsprechend schwammig gewesen sein.
In Europa wiederum punktete der Walzerkönig, der freilich auch im 2 4-Takt zu reüssieren vermochte, mit Ethno-Pop: Neben einer "Czechen-Polka" komponierte er eine "Serben-Quadrille", ein "Slaven-Potpourri" oder einen "Pesther Csárdás". Dieser musikalische Multinationalismus, den er mit dem Adjektiv "völkertümlich" charakterisiert, gilt Ther als Beleg für das antizipative Potenzial von Musik. Johann Strauss Sohn habe gleichsam vorkomponiert, worin ihm Kaiser Franz Joseph mit der Dezem berverfassung von 1867 dann gefolgt sei, die die "Gleichberechtigung aller Völker, Recht auf Wahrung und Pflege von Nationalität und Sprache" garantierte.
Wobei es der Autor vermeidet, den Komponisten und deren Werken vorschnell eine klare politische Haltung oder Tendenz zuzuschreiben. Widmungen an Monarchen und Fürsten sind nicht notwendig einer Weltanschauung, sondern zuallererst der ökonomischen Notwendigkeit geschuldet, sich potenzielle Mäzene warmzuhalten.
Was bedeutet es, im ausgehenden 18., Mitte des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts als Komponist und Musikperformer tätig zu sein?
Mit dem informierten und distanzierten Blick des Historikers zeichnet Ther die Veränderungen nach, denen dieses Berufsfeld unter sich wandelnden sozialen, ökonomischen, aber auch technischen oder rechtlichen Bedingungen -neue Notendruckverfahren, Verkehrstechnologien oder das im Habsburgerreich erst 1895 eingeführte Urheberrecht -unterworfen ist.
Dabei werden auch lieb gewonnene Mythen infrage gestellt und etwa die viel beschworene "Wiener Klassik" als das benannt, was sie ist: ein retrospektiv erstelltes Konstrukt, das nicht zuletzt dem Pionier der "Wiener Musikwissenschaft" Guido Adler (1855-1941) zu verdanken ist. Anstatt Haydn, Mozart und Beethoven gemeinsam aufs Podest zu heben, zieht es Ther vor, die ersten beiden als Proponenten des Josephinismus und Letzteren als Staatskomponisten "des Krieges und des Sieges" zu charakterisieren.
Auch das Mozart-Klischee vom aufsässigen und rebellischen "Wolferl" hält einer näheren Überprüfung nicht stand. Der hatte Beaumarchais' literarische Vorlage für seine Oper "Figaros Hochzeit" politisch ebenso entschärft wie Beethoven Schillers Ode "An die Freude" im Finale seiner 9. Sinfonie und dem als "gottlosen Erz-Spitzbuben" apostrophierten Aufklärer Voltaire gleichsam noch aufs Grab gespuckt.
Recht ambivalent fällt auch die politische Einordnung des in den 1880er-Jahren entstandenen Genres der Schrammelmusik aus, die "nach einer Band und zwei Musikern" benannt wurde -grad so, "als würde man sämtlichen Rock 'n'Roll als ,Elvis-Musik' bezeichnen". Einerseits wurden "die Schrammeln" als Markenname eingesetzt, um -unter anderem auf der Weltausstellung von 1873 -ein restauratives Bild eines heimeligen, von der Industrialisierung unversehrten Alt-Wien zu etablieren. Andererseits steht die dezidierte Wertschätzung, die etwa Kronprinz Rudolf den Schrammeln entgegenbrachte, auch für "eine Anerkennung des Habsburg-Pop und der sozialen Schichten, die ihn produzierte", sodass sich trotz des Suizids Rudolfs im Jänner 1889 "eine Linie zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts 20 Jahre später ziehen" lässt.
Gerade die leichte Muse aber hatte mitunter ideologische Schwerstarbeit zu verrichten. Das Tschingderassabumm der Militärkapellen lässt sich unschwer als "Sound der Reaktion" identifizieren, die Operette als Strategie der Verharmlosung von Krieg und Militarismus. In "Gold gab ich für Eisen" (1914) von Emmerich Kálmán (Musik) und Wilhelm Karczag (Libretto) betreibt sie diese ganz ungeniert, wenn ein Vogerl namens "Zeppelin" besungen wird, das ein "Bomberl im Schnaberl" hat -einen "Gruß von Berlin und Wien!".