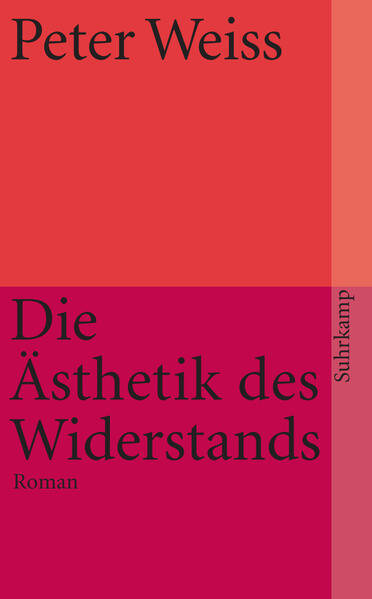Herakles im Blaumann: Wer zieht sein Fell an?
Klaus Nüchtern in FALTER 3/2017 vom 18.01.2017 (S. 29)
Peter Weiss’ „Ästhetik des Widerstands“ bleibt ein Massiv der deutschen Gegenwartsliteratur. Auf ins Bergwerk!
Am 22. September 1937 besuchen drei junge Männer im Pergamonmuseum in Berlin den berühmten Altar. Der Ich-Erzähler und dessen Freund Coppi sind beide um die 20 und stehen längst im Arbeitsleben, der frühreife Heilmann ist erst 15 und trägt „als Tarnung“ die Uniform der HJ.
Dem sogenannten „Gigantenfries“, der das Gemetzel an den aufsässigen Kindern der Erd- und Urgöttin Ge darstellt, nähern sich diese Betrachter aber nicht mit interesselosem Wohlgefallen. Götter gegen Giganten – das ist für sie nur eine Variante eines Jahrtausende währenden (Klassen-)Kampfes: „Die Eingeweihten, die Spezialisten sprachen von Kunst, sie priesen die Harmonie der Bewegung, (…) die anderen aber, die nicht einmal den Begriff Bildung kannten, (…) spürten den Schlag der Pranke im eigenen Fleisch. Genuß vermittelte das Werk Privilegierten, ein Abgetrenntsein unter strengem hierarchischem Gesetz ahnten die andern.“
Die Eingangsszene von Peter Weiss’ dreibändigem Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ gemahnt unverkennbar an Walter Benjamins Aufsatz „Über den Begriff der Geschichte“. Für den Philosophen, der 1940 auf der Flucht vor den Nazis Selbstmord beging, verdankten sich die Kulturgüter „nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“ Ganz ähnlich die Stoßrichtung von Weiss’ Opus magnum: „Und nichts erinnerte an die Fronarbeiter, die den Marmor brachen.“
Peter Weiss war ursprünglich Maler – ein Umstand, der sich in der „Ästhetik“ sowohl im Interesse an diesem Medium als auch in bildhaften Tableaus und einer gerade hyperrealistischen Obsession für Details manifestiert. Allerdings wandte er sich zu Beginn der 60er ausschließlich einer zunächst autobiografischen, ab Mitte des Jahrzehnts dezidiert politischen Literatur zu.
Ein Jahrzehnt lang arbeitete er mit beträchtlichem Rechercheaufwand an seinem 1200-Seiten-Roman, der zwischen 1975 und 1981 bei Suhrkamp erschien. Für die aktuelle Neuauflage wurde auch der „Director’s Cut“ der 1983 erschienenen DDR-Lizenzausgabe herangezogen, da der Autor über das glättende Lektorat todunglücklich gewesen war.
Das zunächst selbst von bekennenden Linken wie etwa dem damaligen Feuilletonchef der Zeit, Fritz J. Raddatz, verrissene Werk stand quer zum Zeitgeist nicht nur des Subjektivismus in der Literatur, sondern auch des großen Kehraus der Postmoderne, die es eilig hatte, „die großen Erzählungen“ der Aufklärung und Emanzipation als unhaltbare totalisierende Projektionen zu verabschieden.
Just in diesem Moment tritt Weiss mit seinem ursprünglich unter dem Titel „Der Widerstand“ begonnenen Projekt an, das den Kampf gegen den sich internationalisierenden Faschismus in eine bis in die Mythologie der Antike zurückreichende große Erzählung des Aufbegehrens einrückt.
Der Widerstand in Deutschland oder im (schwedischen) Exil sowie im Spanischen Bürgerkrieg ebenso wie die Auseinandersetzungen um die Einheits- und Volksfrontpolitik der 20er- und 30er-Jahre werden gleichsam als polyphones „Spiel vom Fragen“ mit historischem und fiktivem Personal nachgestellt, ohne durch eine auktoriale Erzählposition entschieden zu werden.
Neben (Hans) Coppi und (Horst) Heilmann – beide hingerichtete Angehörige der Widerstandsbewegung „Rote Kapelle“ – treten u.a. auch Bert Brecht, der aus der KP ausgeschlossene spätere SPD-Politiker Herbert Wehner, der Arzt und Sexualpädagoge Max Hodann und die Widerstandskämpferin Charlotte Bischoff auf, die zur wichtigsten Protagonistin neben dem Ich-Erzähler avanciert. In diesem selbst hat sich der aus hochbürgerlichem Milieu stammende Autor eine „Wunschautobiographie“ (Weiss) erschaffen: Im richtigen Leben Sohn eines Textilkaufmanns, ist sein fiktiver Vater in einer Textilfabrik als Drucker beschäftigt – ein Mann von bewundernswertem Bildungselan, unerschütterlicher Integrität und aufrechtem Klassenbewusstsein (keine Ironie!).
Weiss’ verwirrend fakten- und materialreicher „roman d’essai“ (Alfred Andersch) versucht nicht zu rekonstruieren, „wie es gewesen ist“, sondern fasst – vom Wissensstand der 70er- und 80er-Jahre ausgehend und unter dem Meta-Narrativ des Klassenkampfes – Geschichte als permanente Konstruktion auf. Innerhalb dieser kommt der Auseinandersetzung mit Kunstwerken wie etwa Géricaults Monumentalgemälde „Das Floß der Medusa“, Picassos „Guernica“ oder Kafkas „Schloss“ eine exemplarische Rolle zu: Deren Schönheit wird eben nicht als „zeitlos“ begriffen, sondern erweist sich der „Ästhetik“ zufolge darin, dass sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg befragbar und virulent bleiben.
Eine unerlöste Vergangenheit gibt der Gegenwart die Aufgaben auf, und das „Bild der geknechteten Vorfahren“ (Benjamin) speist die Energie für einen Kampf, in dem der durchaus ambivalent gezeichnete Herakles als proletarisches Role-Model taugt. Dessen Löwenfell hängt immer noch im Spind, und nicht ohne Pathos stellen die letzten Zeilen des Romans die Frage danach, wer es sich überstreifen mag.
Im Rahmen der Talkshow „Tea for Three“ diskutieren Daniela Strigl und Klaus Nüchtern mit ihrem Gast Alfred Pfabigan den besprochenen Roman (19.1., 19.30 Uhr, Hauptbücherei)