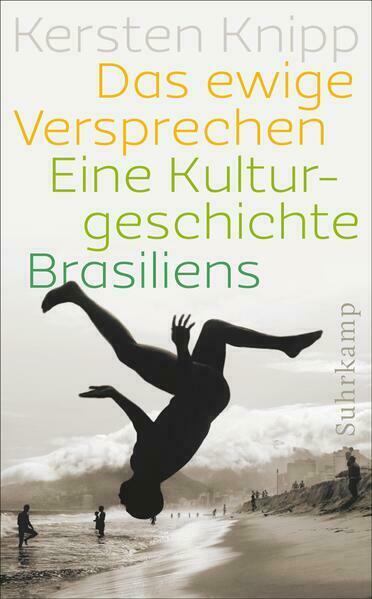Von Pau Brasil zu Paolo Coelho
Erich Klein in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 36)
Brasilien: Zwei Kulturgeschichten porträtieren das lange Zeit "europäische Projekt" am Amazonas
Als der Portugiese Alvares Cabral am 22. April 1500 in Brasilien an Land ging, notierte ein Besatzungsmitglied über die erste Begegnung mit den Indios: "Ihre Hautfarbe ist braun, etwas rötlich. Sie gehen nackt, ohne irgendeine Bekleidung. Es ist ihnen gleichgültig, ihre Scham zu verhüllen oder zu zeigen." Sieben Millionen Indianer lebten vor der Kolonisierung des Landes am Amazonas, heute sind es knapp 500.000.
Kulturgeschichten haben es an sich, dass sie als "Kultur" erzählen, was nichts als Barbarei war: Die Lateinamerikahistorikerin Ursula Prutsch, Co-Autor Enrique Rodrigues-Moura sowie der Journalist und "Brasilienliebhaber" Kersten Knipp konstatieren gleich zu Beginn ihrer höchst kurzweiligen Darstellungen der letzten 500 Jahre des Landes eine Art schlechtes Gewissen: Brasilien war längste Zeit ein europäisches Projekt.
Die Seelen der Indios durch rasche Taufe zu retten war das kulturelle Rahmenprogramm der Kolonisatoren – tatsächlich galt ihr Interesse Pau Brasil, Brasilholz, das in der europäischen Textilindustrie verwendet wurde; später folgten Gold und Edelsteine, Zuckerrohr und schließlich Kaffee. Die Arbeit wurde von Indios und Sklaven verrichtet.
Schon im 17. Jahrhundert beginnt auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Grausamkeiten der indigenen Zwangsarbeit. Der erste genuin brasilianische Schriftsteller, Jesuitenpater Antonio Vieira, lehnt die Sklaverei ab – und hebt zu einem Lob der Schönheit des Landes an.
Sarkastischer im Umgang mit der Terra Brasil ist der Dichter Gregorio de Matos, der Melancholie und Sex, zwei wichtige Bestandteile künftiger Brasiliendiskurse, unumwunden formuliert: Allzu frommen Priestern empfiehlt er von ihren barocken Kirchtürmen herab einen Blick auf die realen Sitten des Landes zu werfen.
Das bis heute vielleicht wichtigste Element brasilianischer Kultur war der Import von drei Millionen westafrikanischer Sklaven. Schon um 1700 dominieren sie das Aussehen des Landes: 600.000 Schwarzen stehen 100.000 Europäer gegenüber. Im Sinne der Aufklärung verlangen die Söhne wohlhabender Fazendeiros immer wieder deren Befreiung, erst ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1822 erfolgt sie tatsächlich.
Deutlichstes Beispiel für die rasante Modernisierung des Landes Ende des 19. Jahrhunderts ist die Hauptstadt Rio de Janeiro. Der Diplomat und Schriftsteller Gilberto Amado besingt den Ausbau von Hafen und imposanten Prachtstraßen wie der Avenida Atlantica an der Copacabana: "Unsere Stadt ist die einzige, die Regierungssitz, Industrie-, Wirtschafts-, Banken- und politisches Zentrum in einem und zugleich eine vom 1. Januar bis 31. Dezember in Betrieb befindliche Sommerfrische ist."
Von den direkt daneben entstehenden Favelas ist dabei ebenso wenig die Rede wie von der Niederschlagung des Aufstands der Canudos. Als deklassierte Bauern, ehemalige Sklaven und Mestizen hatten sie im Hinterland, in der kargen Landschaft Sertão, eine Art religiös-kommunistische Stadt, gegründet. Modernisierung wurde dort, in "Belo Monte", verweigert.
Ein regelrechter Boom moderner gesellschaftlicher und künstlerischer Strömungen erfolgt nach dem Ersten Weltkrieg, an dem Brasilien auf Seite der Alliierten teilnimmt. Mit Alberto Santos Dumont hat auch Brasilien seinen Luftfahrtpionier; Psychoanalyse und Stummfilm finden rasche Verbreitung; die Malerin Anita Malfatti importierte deutschen Expressionismus.
Provokation war selbst in der Musik angesagt. Der Komponist Heitor Villa-Lobos trat mit einem Schuh und einer weißen Sandale vor ein Publikum, das der Dichter Mario de Andrade attackierte: "Ich beschimpfe den Bourgeois! Den Pfennig-Bourgeois / Den Gesäß-Bürger!"
Mario de Andrade lässt in den 1930er-Jahren den Protagonisten seines epochalen Romans "Macunaíma" durchs ganze Land irren und findet das "echte" Brasilien bei den Indianern. Ironie der Geschichte – deren Erzählungen sind den Berichten deutscher Ethnografen entnommen.
Stefan Zweig bezeichnete Brasilien, das ihm 1940 Zuflucht vor der Verfolgung durch die Nazis gewährte, als "Land der Zukunft". Neben Bossa Nova und Astrud Gilbertos Welthit "The Girl from Ipanema" war das spektakulärste Projekt der Nachkriegszeit die Errichtung der neuen Hauptstadt Brasilia mitten im Dschungel.
Mit dem Slogan "50 Jahre in 5" sollte neuer Pioniergeist geweckt und das Land besser integriert werden. Die Vision des Architekten Oscar Niemeyer, der zufolge in seinen "Superquadras" Arm und Reich zusammenleben sollten, scheiterte. Die zur selben Zeit mit einer Landreform und Verstaatlichung der Ölindustrie begonnene linke Erneuerung des Landes endete 1964 in einem Putsch der Militärs.
Es waren Verfolgte jener Zeit, die 1985, nach dem Ende der blutigen Diktatur, die Macht übernahmen – der einstige Gewerkschaftsführer Lula da Silva ebenso wie die derzeitige Präsidentin Dilma Rousseff. Aus jahrelanger Emigration kehrten der Theatererneuerer Augusto Boal zurück, auch zahlreiche international erfolgreiche Musiker wie Caetano Veloso oder Gilberto Gil, der Mitte der 2000er-Jahre Kulturminister wurde.
Am Ende von dessen Amtszeit standen Korruptionsvorwürfe – bezeichnend für ein Land, das sich als fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ständig am Rande des Chaos bewegt. Eine Million Menschen fiel zwischen 1980 und 2010 Mord und Totschlag zum Opfer.
Vielleicht noch bezeichnender sind die beiden wichtigsten kulturellen Exporte der jüngsten Zeit – der Blockbuster "Tropa de Elite" über Drogen, Polizei- und Mafiagewalt sowie der Schriftsteller Paulo Coelho. Dessen Orgien an spirituellem Kitsch verkauften sich bislang 100 Millionen Mal.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: