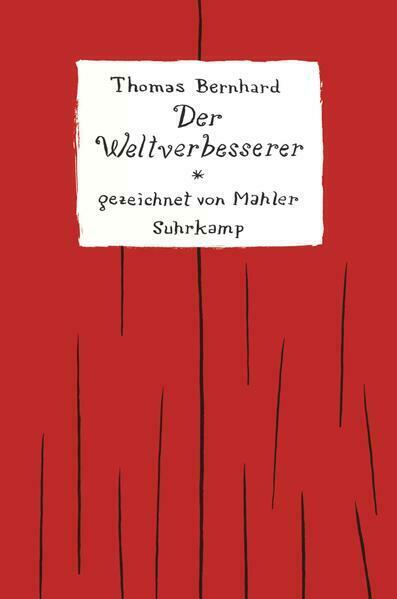Thomas Bernhard goes Pop
Martin Wanko in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 21)
Zu seinem 25. Todestag sind ihm ein ziemlich kurioser Roman und ein neuer Mahler-Band gewidmet
Irgendwann musste es passieren, so spröde konnte der Altmeister doch gar nicht sein. Der Autor und Grantscherben der Nation Thomas Bernhard wird 25 Jahre nach seinem Ableben zur Popikone erklärt, und das auf äußerst unterschiedliche Weise.
Alexander Schimmelbusch, 1975 in Österreich geboren, in Deutschland und den USA aufgewachsen und als Journalist tätig, legt mit "Die Murau Identität" seinen dritten Roman vor. In diesem wird der Tod von Thomas Bernhard als Schwindel enttarnt. Alexander, so heißt der freischaffende Journalist und Icherzähler, bekommt die versiegelten Reiseberichte Thomas Bernhards zugespielt, die kein Geringerer als sein ehemaliger Verleger Siegfried Unseld verfasst haben muss. In den Berichten reist der Verleger einige Jahre nach dem fingierten Tod zum putzmunteren Dichter nach Mallorca, wo sich dieser eine bürgerliche Existenz aufgebaut hat, mit Frau und Kind!
Es ist nicht unwitzig, sich in Unselds Gedankenwelt hineinzubegeben. Bernhard verprasst das Geld des Verlegers im Hotel und kauft sich dann an der Steilküste bei Deià eine pompöse Hazienda. Er stellt dem Verleger jedoch auch, fast als Gegenleistung, einen weiteren Roman in Aussicht. Das klingt schon einmal nach Bernhard, der mit Unseld schon immer seine Spielchen am Laufen hatte.
Hier treten dann auch wunderbar skurrile Geschichten zutage, wie die über eine asiatische Vase, die Unseld von Bernhard geschenkt bekommen hat und sich nun als Ramsch herausstellt. Dass dem Autor ein grauer Benz aus den 1960er-Jahren gehört, passt auch, kann man sich doch noch sehr gut an die Bernhard-Dokus erinnern, in denen er mit einem schwarzen Benz durch Ohlsdorf kurvte. So weit, so gut.
Die Berichte des Verlegers werden jedoch regelmäßig durch eine Art Roadmovie des Journalisten unterbrochen, der sich auf die Suche nach Thomas Bernhard begibt. Dass der Journalist hier einen ziemlich frivolen Lebensstil führt, ist zwar seine Angelegenheit, wirkt aber doch wie ein Stilbruch. Man kann mit Bernhard viel verbinden, nur keine lockere Atmosphäre.
Schimmelbusch hatte beim Schreiben anscheinend nicht nur Bernhard im Kopf. Er erwähnt einige Male auch Michel Houellebecq. Überhaupt sind hier auch Autoren Teil der Story, die man in einem "Such den Bernhard"-Roman nicht erwartet hätte: Bret Easton Ellis oder Salman Rushdie zum Beispiel. Heikel wird's bei Peter Handke. Bernhard und Handke haben sich bekanntlich nie vertragen, im späteren Alter hatten sie ein Verhältnis wie Hund und Katz, das durchaus von Bernhard ausging.
Handke kriegt hier sein Fett ab. Warum eigentlich? Seine im Roman mehrfach erwähnten Schriften über den Balkankrieg, die ihm viel Kritik einbrachten, sind mittlerweile gegessen. Außerdem wird eine gewisse Eitelkeit, die Handke eigen ist, kritisiert. Mein Gott, Autoren mit Welterfolgen werden halt im Alter ein wenig eitel. Sätze wie "Handke ist davon überzeugt, dass jeder Satz, der ihm entweicht, Weltliteratur ist" hätte sich Schimmelbusch schenken können.
Schade ist auch, dass die Proportionen in diesem Roman nicht ganz funktionieren: Auf das Erscheinen von Thomas Bernhard muss der Leser bis zum Schluss warten. Und dann verpflanzt der Autor Bernhard noch dazu in eine futuristische Welt, in der Gedankenströme durch Computerchips gelenkt werden können. Diese Welt erinnert wiederum eher an Houellebecqs ersten Roman "Elementarteilchen".
Lässt man einmal die Mängel beiseite, ist "Die Murau Identität" das witzigste Bernhard-Buch, das Thomas Bernhard nicht geschrieben hat. Seine Verehrer sollten sich den Roman nicht entgehen lassen und in der Ecke für skurrile österreichische Literatur hat der Schimmelbusch sein fixes Platzerl.
Der Zweite im Bunde der Bernhard-Veredler ist Nicolas Mahler. Der Illustrator und Comic-Künstler beweist mit der Auswahl der von ihm zu Graphic Novels verwandelten Büchern durchaus Geschmack: Musils "Mann ohne Eigenschaften" war schon an der Reihe, ebenso H.C. Artmann, nun nimmt sich der Zeichner ein zweites Mal nach "Alte Meister" Bernhards an und macht aus "Der Weltverbesserer" eine kuriose und zugleich sehr menschliche Story.
"Der Weltverbesser" wurde 1981 unter der Regie von Claus Peymann im Schauspielhaus Bochum uraufgeführt, mit der Hauptrolle wurde Bernhard Minetti betraut. In dem Stück wartet ein greiser Privatgelehrter auf die Ehrendoktorwürden, die ihm wegen seines "Traktats zur Weltverbesserung" verliehen werden sollen. Aber warum eigentlich, sinniert der Gelehrte, denn das Traktat habe niemand verstanden, lediglich er selbst. Bis die Herrschaften kommen, wartet er in seinem Ohrensessel und schickt seine Dienerin über die Bühne.
Mahler inszeniert sehr gut. Er holt sich aus dem Stück seine persönlichen Highlights raus, verdichtet klug und lässt eine Thomas Bernhard ähnelnde Mahler-Figur auf einem übermächtigen Stuhl sitzend und schimpfend auf die Übergabe der Doktorehren warten. Zwischendrin schikaniert er seine Dienerin. Beide Charaktere sind "mahlerische Langnasen" und sehr schrullig. Durch die äußerst reduzierte Form, die Mahler anwendet, gelingt eine höchst erfrischende Inszenierung. Bernhard kann sehr komisch und unglaublich menschlich dargestellt werden – vor allem, wenn Mahler zum Stift greift.
Der Zeichner schafft Theater für Menschen, die im Prinzip keine Theatergänger sind oder ihren Hintern dazu nicht aufraffen können. Und das Schönste kommt am Ende. "Die Welt ist eine Kloake", lässt Mahler seinen Bernhard sprechen, und als auf den letzten Seiten der Rektor samt Gefolge vorbeikommt, entleert sich diese als Gewitterwolke. Rawumm! Alles schwarz.
Lesung - Die Murau Identität: 21.3., Wien, Porgy (Wortspiele)