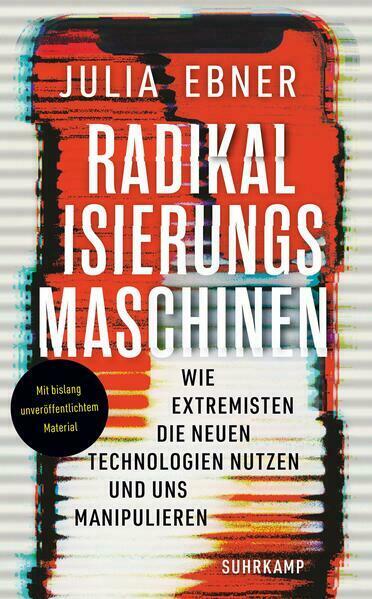Auf der Suche nach der verlorenen Mitte
Tessa Szyszkowitz in FALTER 15/2023 vom 12.04.2023 (S. 15)
Da wäre einmal Claire Lafeuille. Die Französin tritt gegen Klimawandelaktivismus auf, gegen Black Lives Matter und gegen Covid-19-Impfungen. Sie treibt sich in den dunkelsten Ecken des Internets herum. So trifft sie auf Mark Collett. In einem persönlichen Gespräch offenbart der Gründer der ultranationalistischen britischen Bewegung "Patriotic Alternative" ihr sein Weltbild: Klimawandel sei für ihn "ein künstlich fabriziertes Problem, das weiße Menschen vor lauter Schuldgefühlen dazu bringen soll, keine Kinder mehr zu bekommen".
Mark Collett gibt es wirklich. Die Facebook-und Instagramseiten der "Patriotischen Alternative" mit 16.000 Fans wurden 2021 wegen des bedenklichen Inhalts geschlossen. Auf Telegram aber macht Collett weiter. "Er hat es geschafft, die zersplitterte britische Ultrarechte zu vereinen", schreibt Extremismusexpertin Julia Ebner in ihrem neuen Buch "Massenradikalisierung".
Claire Lafeuille dagegen ist erfunden. Hinter diesem Falschnamen verbirgt sich niemand anderer als Julia Ebner. Mit ihrer Recherche in rechtsextremen Internetforen hat sich die Österreicherin mit Wahlheimat London einen Namen als Expertin für Radikalisierung im Netz gemacht. Ort der Forschung: Echokammer. Recherchemodus: Undercover. Ihre Bücher "Wut"(2017) und "Radikalisierungsmaschinen" (2019) waren Bestseller. Sie hörte und las unter gefälschten Identitäten über Monate mit, wie es in der Internetwelt von Hackern, Terroristen, Fundamentalisten und Verschwörern so zuging. So konnte sie die wildgewordenen Trolle am besten kennenlernen.
Es geht Ebner dabei nicht nur darum, die dunkelsten Ecken des Internets auszuleuchten. Die Österreicherin berät inzwischen die britische Regierung, wie man die Radikalisierung entschärfen kann. Auch die Vereinten Nationen, die Nato, die Weltbank und europäische Geheimdienste hören auf sie - und der CIA. Derzeit forscht sie am Londoner Institute for Strategic Dialogue ISD, während sie gleichzeitig am Centre for the Study of Social Cohesion an der Universität von Oxford ihren Phd abschließt.
Seit sie 2016 damit begonnen hat, Rechtextremisten im Internet zu beobachten, ist die Welt gefährlicher geworden. In ihrem neuen Buch "Massenradikalisierung" legt sie mit der These nach, dass diese Extremisten von den Rändern der Gesellschaft in die Mitte gerückt sind. "Ich habe mein neues Buch geschrieben, weil ich dabei zusehen musste, wie sich QAnon und andere Querdenker in die Mitte vorgearbeitet haben", sagt Ebner. Sie hat am ISD eine Social-Media-Analyse durchgeführt, die zeigte, dass "Anti-Impf-Desinformation vor allem in den sich überschneidenden Netzwerken der Neuen Rechten, der rechtspopulistischen Parteien wie der deutschen AfD und der österreichischen FPÖ sowie von prominenten Verschwörungstheoretikern verbreitet" wurde. Das "Mainstreaming" radikaler Verschwörungstheorien hat die Expertin im virtuellen Raum und im wahren Leben recherchiert.
In der Corona-Pandemie passierte es immer öfter, dass sich Freunde als Impfgegner entpuppten. Sie erzählt von einem Telefonat mit einer Freundin, die sich nicht impfen lassen wollte: "Hast du keine Angst, unfruchtbar zu werden?" Ebner hörte der Freundin zu. Bei ihr selbst überwog nicht die Angst vor Impfschäden, sondern vor dem Coronavirus selbst. Aber sie hatte auch Verständnis. Dieses endete bei Marius, den sie auf einer Demo in London traf und der zu ihr sagte: "Alle in der Royal Family sind Reptiloide."
Julia Ebner genießt inzwischen eine größere Öffentlichkeit als andere Extremismusforscher. Sie vertritt ihre Forschungsergebnisse bilingual in Medien wie der BBC oder dem ORF. Ebner hat außerdem das Talent, schnell Nähe zu Menschen herstellen. Und dabei - das ist vielleicht das Wichtigste für ihre Arbeit in den Echokammern von Querdenkern -ist nicht festzustellen, ob das Berechnung ist oder nicht.
"Krude verschwörungstheoretische Telegram-Gruppen sind das Bindeglied für viele Querdenker", sagt sie. In "Massenradikalisierung" wird das anhand von Mary Petrova verdeutlicht, einer Bayerin mit russischen Wurzeln. Mary ist eine ihrer angenommenen Identitäten, mit der sie die deutsche Impfgegnerszene seziert hat. Als Mary lernt sie auf einer Demonstration gegen die Covid-19-Maßnahmen der Regierung vor der Frankfurter Oper Gabriel kennen, der sie später in seine Online-Gruppen einlädt. Dort treffen sich Impfgegner und prorussische Gegner von Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie alle sind gerade erst "aufgewacht" - so heißt es im Querdenker-Sprech: Sie haben erkannt, dass sie von ihren Regierungen belogen werden. Manche von ihnen radikalisierten sich innerhalb weniger Monate, steigerten sich in einen Kampf der Ungeimpften gegen Regierende hinein. Manche Corona-Querdenker marschierten nach Ende der Pandemie einfach weiter - diesmal gemeinsam mit prorussischen, selbsternannten Pazifisten.
Es ist nicht immer einfach, mitten unter Extremisten die Nerven zu bewahren. Ebner passt auf, damit sie nicht auffliegt. Im Internet und bei Demonstrationen kann sie auch schnell in einer dunklen Gasse verschwinden, wenn sie Misstrauen spürt. Es kostet auch viel Energie. "Es braucht schließlich Empathie, wenn du dich auf eine angenommene Identität einlässt", sagt sie. Mary wäre sonst nicht glaubwürdig. So aber kann Ebner mitlesen, wie nicht nur gegen "globale Ausführungseliten" gehetzt wird. "Homophobie ist ein weiteres Erkennungsmerkmal von glühenden Putin-Unterstützern", erklärt Ebner die Stimmung in der testosterongeladenen "Manosphäre"."Frauenfeindlich sind diese Gruppen auch." Sie gibt zu: "Wenn ich diese frauenfeindlichen Statements höre und lese, dann fällt es mir schon schwer, ruhig zu bleiben. Frauenfeindlichkeit macht auch etwas mit mir persönlich."
Wie gefährlich gerade die Radikalisierung der Coronaleugner ist, zeigte sich in den vergangenen Jahren sehr schnell auch in Österreich: "Die österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr ist ein bedrückendes Beispiel für die potenziellen Konsequenzen", heißt es in "Massenradikalisierung". Die Landärztin hatte sich für Covid-19-Impfungen ausgesprochen, daraufhin wurde sie im Internet und in der Realität bedroht. Kellermayr hielt dem Hass nicht stand, sie beging im Juli 2022 Suizid. Ebner beobachtete auch danach noch die einschlägigen deutsch-österreichischen Internetgruppen auf Telegram. Besonders schockierend war für sie, dass "die tote Ärztin hier weiterhin für Hass und Hohn herhalten musste".
War Kellermayr eine Ausnahme? Wie weit geht die Radikalisierung?"Verschwörungstheorien hat es natürlich immer schon in Zeiten der Krise vermehrt gegeben", sagt Ebner, "zu Zeiten der Pest haben die Leute sich eingeredet, die Juden hätten die Brunnen vergiftet." Antisemitische Mythen vermischen sich heute mit anderen rassistischen Verschwörungstheorien. Ein Indiz für die Brisanz dieser Radikalisierung sind die Daten zu QAnon, einer 2017 entstandenen US-amerikanischen Bewegung, die Verschwörungstheorien verbreitet. Aus ein paar tausend Anhängern sind inzwischen Millionen geworden. 16 Prozent der Amerikaner glauben, ermittelte das Institut PRRI 2022, dass Regierung, Medien und Banken von Pädophilen kontrolliert werden, die von Satan besessen sind. Julia Ebner ist nicht die einzige Autorin, die vor dem Effekt der sozialen Medien warnt: "Das Internet ist eben eine Multiplikationsmaschine", die den Hass in bisher ungekanntem Ausmaß verstärken hilft.
Auch als Akademikerin hat sie sich mit der Frage befasst, wieso Radikalisierung so einen Sog in die Mitte entwickelt hat. Soeben hat Julia Ebner ihre Doktorarbeit an der Universität Oxford an der Fakultät für Anthropologie beendet. Sie heißt "Identität und Extremismus in virtuellen Gruppen: Der Einfluss von Online-Identitätsfusion auf gewaltbereite Radikalisierung". Sie hat darin untersucht, wie persönliche Identität in einer Gruppenidentität aufgeht. Das kann explosive Folgen haben, wie die Radikalisierung Einzelner zeigt. "Reduzierende Gruppenidentitäten werden von Regierenden oft eher forciert als aufgebrochen. Dabei wäre das wichtig, um Radikalisierungen zu verhindern." Der Gegensatz Österreicher und Ausländer könnte etwa mit der Botschaft, dass viele Österreicher auch Ausländer sind, entschärft werden. Stattdessen beklagt der ÖVP-Politiker Karl Mahrer lieber, dass er sich am Brunnenmarkt in Wien nicht mehr wohlfühle, weil zu viele Ausländer dort arbeiten.
Julia Ebner ist nicht weit davon aufgewachsen. Ihre Mutter arbeitete erst als Schauspielerin, später als psychologischer Coach. Der Vater ist Berater im Gesundheitswesen. Ein kluges Kind war Julia Ebner immer schon, attestiert ihr die Rapperin Esra Özmen, die mit ihr im Gymnasium am Parhamerplatz im 17. Bezirk die Schulbank gedrückt hat: "Julia war legendär, vielleicht sogar Schulbeste. Ich habe mir immer gewünscht, nur für einen Tag ihr Hirn zu haben", bekannte Özmen in einem Doppelinterview mit Ebner im Datum. Nachdem Ebner parallel Internationales Management und Philosophie in Wien studiert hatte, setzte sie sich zu weiteren Studien nach Paris, Peking und London ab. 2015 schrieb sie ihre Masterarbeit an der London School of Economics über "Selbstmordattentäterinnen - zwischen Viktimisierung und Dämonisierung". Damit hatte sie ihr Thema gefunden.
Zuerst arbeitete sie in London bei Quilliam, einem Thinktank, der von ehemaligen Islamisten gegründet worden war, die bei der Deradikalisierung mithelfen wollten. Ebner leitete
dort Forschungsprojekte zur Terrorismusprävention. Da sie sich mit ihren Artikeln im Guardian einen Namen gemacht hatte, wurde sie 2017 eingeladen, das britische Parlament über die Radikalisierung von Rechtsextremen im Internet zu instruieren. Einige Monate davor war die proeuropäische Labour-Abgeordnete Jo Cox von einem Rechtsextremen erschossen worden. "Es ist wichtig, nicht nur radikale Ideologien zu entkräften, sondern auch alternative Narrative anzubieten", sagte die Sachverständige Ebner laut Protokoll. Dass Experten in Ausschüsse eingeladen werden, ist eine Eigenart des britischen Parlamentarismus. Sie war damals gerade 25 Jahre alt.
Julia Ebner will mit ihrer Arbeit aber nicht nur aufklären. Deradikalisierung hält sie für ihre Mission. Deshalb hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen vom Institute for Strategic Dialogue einen Katalog von 15 Maßnahmen erarbeitet, mit dem die Gefahr des "Mainstreaming" eingedämmt werden kann. Das Institute for Strategic Dialogue wurde 2006 vom britisch-österreichischen Philanthropen George Weidenfeld und der Britin Sasha Havlicek gegründet, um mit Unterstützung von internationalen Organisationen, Regierungen und Stiftungen wie der Gates Foundation zu erforschen, was man dem Trend zur Polarisierung, Extremismus und Desinformation entgegensetzen kann. "Wir wollen auch die psychologischen Bedürfnisse der Menschen verstehen, die hinter dieser Radikalisierung stehen", sagt Julia Ebner. "Erst dann können wir die Radikalisierung bekämpfen, indem wir Alternativen für diese Bedürfnisse anbieten." Das heißt für sie auch, dass Parteien und Regierungen sich nicht rechtspopulistischen Inhalten annähern, sondern bessere politische Alternativen entwickeln müssen.
Ebners Maßnahmenkatalog ist im hinteren Teil ihres neuen Buches abgedruckt. Sie will zum Beispiel "ein Mengendiagramm des extremistischen Ökosystems zeichnen"."Wenn wir die Verlinkungen der verschiedenen Gruppierungen verstehen und wie sie damit neue Zielgruppen erreichen", präzisiert Ebner im Interview mit dem Falter, "dann können Forscher und Regierungen besser präventiv arbeiten und intervenieren." Influencer können eine spezielle Rolle spielen, indem man mit ihnen darüber spricht, mit welchen Argumenten man gegen vorherrschende Verschwörungstheorien vorgehen könnte. Um der Empörungsmaschine etwas entgegenzusetzen, müssten außerdem Technologieriesen an ihren Algorithmen arbeiten. Es braucht stärkere regulierende Maßnahmen - die EU hat mit dem Digital Services Act DAS, der ab 2024 gelten soll, zumindest versucht, besonders große Anbieter ins Visier zu nehmen.
Ganz oben auf der Prioritätenliste der Forscherin steht: "Angesichts der neuen Technologien wird in Regierungen viel zu wenig geplant und vorbereitet. Sie müssen sofort Schutzmaßnahmen entwickeln. Und dann Industrie und Techriesen dazu zwingen, diese umzusetzen. Sonst explodiert die Radikalisierung völlig unkontrolliert."
Julia Ebner geht noch einen Schritt weiter. Sie schlägt vor, Aktionsbündnisse zu schließen -so wie sich Querdenker in verschiedenen Themenbereichen gegenseitig verstärken, könnten das auch aufklärerische und progressive Gruppen tun. Um bei der Prävention besser zusammenzuarbeiten, haben sich zum Beispiel im Netzwerk "Strong City Network" 140 Bürgermeister und Politiker vernetzt.
Wie aber sollen Regierungen Aktionsbündnisse mit progressiven Gruppen schließen, wenn sie selbst nach rechtsradikalen Wählern schielen und damit freiwillig schon weit nach rechts gerutscht sind? In Großbritannien hat Julia Ebner diesen Prozess der konservativen Regierungspartei in den Brexit-Jahren hautnah miterlebt. Die rechtspopulistische Propaganda der Brexit-Befürworter rund um das EU-Referendum und die Regierungspolitik mit hart rechter Migrationspolitik haben zu "einer Normalisierung, Verbreitung und Berechtigung von rechtsextremen Inhalten" geführt. Auch in der alten Heimat Österreich seien einige der jüngsten Vorgänge nicht hilfreich bei der Bekämpfung von Radikalisierung: "Die Koalition der ÖVP in Niederösterreich mit einer ganz extremen FPÖ ist genau das, was Verschwörungsmythen normalisiert. Da fühlen sich viele Querdenker legitimiert."
Vergangenen Mittwoch präsentierte Ebner "Massenradikalisierung" vor vollem Saal im Roten Salon in der Berliner Volksbühne. Dort war ihr das Publikum gewogen. Aber ein paar Tage davor saßen bei einer Präsentation gleich mehrere Querdenker im Publikum. Einer rief: "Was ich in Ihrer Ankündigung gelesen habe, schockiert mich total. Das ist der Jargon, der die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben hat.""Daraufhin", schrieb die Wilhemshavener Zeitung, gab es "richtig Krach".
Frauen sind ganz besonders oft mit Drohungen aus dem rechtsradikalen Milieu konfrontiert. Meistens handelt es sich um wüste Beschimpfungen in den sozialen Medien. Sasha Havlicek, Ebners Chefin beim ISD, sorgt sich um die Sicherheit ihrer Mitarbeiterin. Damit es keine physischen Drohungen gibt, ist das Institute for Strategic Dialogue abgeschirmt, es gibt keine Adresse. Ebner selbst wird auch geschützt, ihre E-Mails werden gescreent. Interviews gibt sie nur an öffentlichen Orten. Chefin Havlicek ist das ein wichtiges Anliegen: "Wir können nicht vorsichtig genug sein."
Denn was radikalisierten Extremisten der größte Dorn im Auge ist, ist eine Frau, die ihnen erklärt, warum sie auf dem Holzweg sind. Und die obendrein noch Vorschläge dafür hat, was man dagegen tun kann.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: