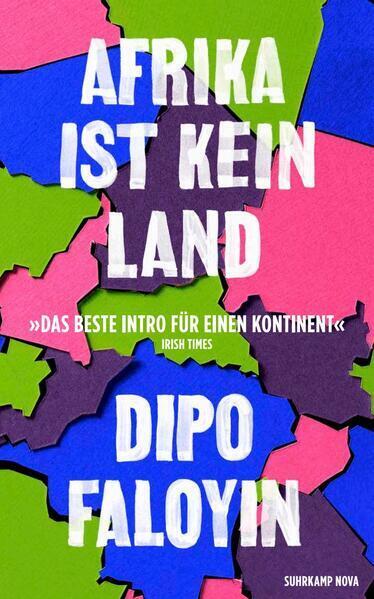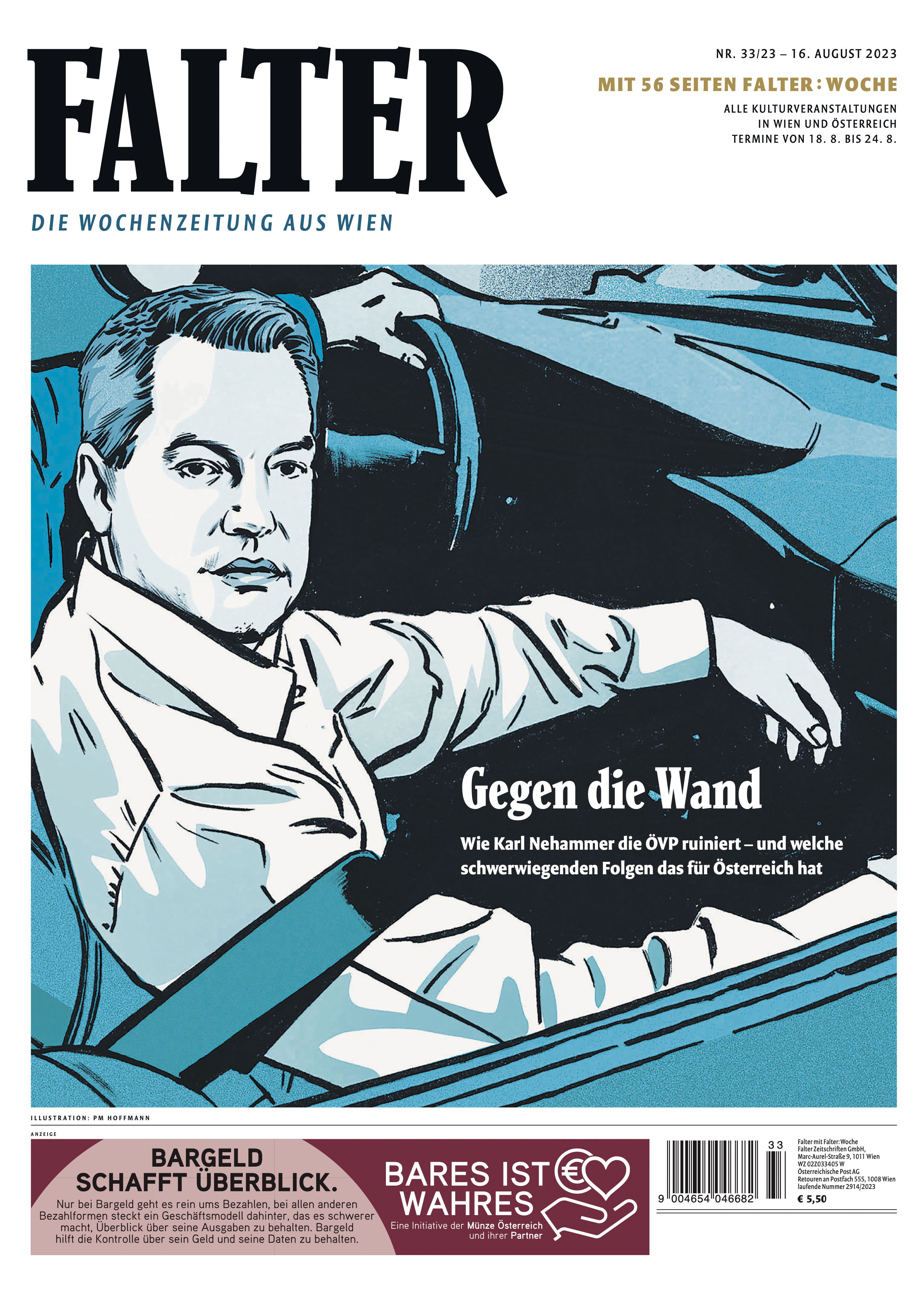
Nein, Afrika muss nicht gerettet werden
Kirstin Breitenfellner in FALTER 33/2023 vom 16.08.2023 (S. 18)
Schöne Landschaften mit wilden Tieren, raffgierige Diktatoren und hungernde Menschen - so lauten die Stereotype über einen Kontinent, über den die meisten herzlich wenig wissen. Nachrichten über Putsch und Chaos aus den Republiken Niger oder Sudan in diesem Sommer zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der afrikanischen Realität.
Der Journalist und Autor Dipo Faloyin - in Chicago geboren, in Lagos aufgewachsen und heute in London ansässig - will das mit seinem Buch ändern: "Afrika ist kein Land" ist der Titel seines packenden Buchs, das Kultur-und politische Geschichte gleichermaßen abdeckt. Der Senior Editor für Vice zu den Themen Race, Kultur und Identität verfolgt darin keinen Vollständigkeitsanspruch, unterfüttert seine Fakten mit Anekdoten und anschaulichen Beispielen, spart nicht mit Ironie - und zeichnet auf diese Weise ein realistisches Bild des Kontinents, ohne dessen Probleme kleinzureden.
Zu Beginn nimmt er die Leserschaft in Nigerias Metropole Lagos mit, eine Stadt mit 16 Millionen Einwohnern, die größte Stadt Afrikas. 43 Prozent der Bevölkerung Afrikas lebt in Städten. Trotzdem reproduziert die Populärkultur hartnäckig das Bild von Ureinwohnern, die in Savannen leben und mit einem Speer bewaffnet in einen Sonnenuntergang schauen. Solche Klischees ärgern Faloyin schon lange. Er räumt mit dem Stereotyp auf, dass Afrika ein Land ist, ein Stereotyp, das die sehr unterschiedlichen Kulturen zwischen Ägypten, dem Kongo und Südafrika einfach in einen Topf wirft.
Entstanden sind viele von ihnen während des Kolonialismus, dem der Autor das zweite Kapitel widmet. Der "Kuchen" Afrika wurde am 15. November 1884 in einer vom deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck einberufenen Konferenz zwischen 14 Nationen aufgeteilt. 80 Prozent des Kontinents waren zu diesem Zeitpunkt noch "frei", innerhalb der nächsten 30 Jahre sollten 90 Prozent Afrikas von Europa kontrolliert, unterdrückt und ausgebeutet werden.
Nicht nur die Gewalterfahrung, sondern auch die auf ungenauen Karten willkürlich gezogenen Ländergrenzen führen bis heute zu Verwerfungen zwischen Volksgruppen, die auf diese Weise entweder getrennt oder zusammengepfercht wurden in Nationen, die ihre Identität immer noch suchen. Die Freiheitskämpfer der Unabhängigkeitsbewegungen der 1960er-Jahre mutierten nicht selten zu Despoten, die nur noch an ihrem Machterhalt interessiert waren. "Die Kolonialmächte hatten ein solches Chaos angerichtet, dass afrikanische Länder ihre Grenzen nicht ändern konnten, ohne dass die Folgewirkung möglicherweise verheerend gewesen wäre." Ein Dilemma. Das alles zu wissen ist eine Sache, Faloyins anschauliche Beschreibungen machen es auch spürbar und begreifbar. Auch dem Thema Raubkunst ist ein eindrückliches Kapitel gewidmet. Mit der Rückgabe von Kunstwerken hapert es noch.
Das Fatale an diesem "Erbe" sieht Faloyin darin, dass Afrika auch heute noch keine Selbstbestimmung zugestanden wird. Afrika aber müsse nicht vom Westen gerettet werden, schreibt Faloyin, schon gar nicht vor sich selbst.
Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Ländern wie Botswana sei es gelungen, Wohlstand für viele zu schaffen, und die mediale Vernetzung mache es Bürgerrechtsbewegungen leichter, sich zu organisieren. Sogar die Populärkultur habe nachgezogen. Das nigerianische "Nollywood" avancierte zur zweitgrößten Filmindustrie der Welt. Und mit "Black Panther" schuf 2018 sogar Hollywood schwarze Helden.