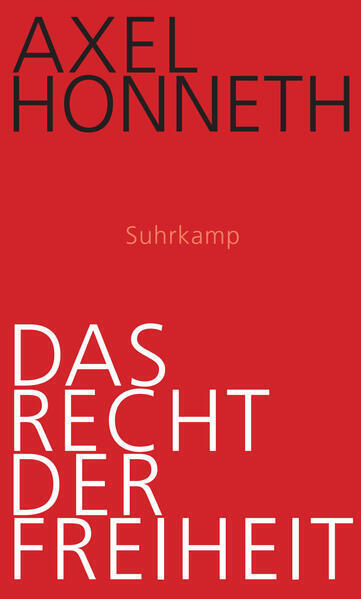Reden wir über Markt, Moral und Sittlichkeit
Robert Misik in FALTER 34/2014 vom 20.08.2014 (S. 59)
Im Kapitalismus zählt nur egoistisches Profitstreben? Ist gar nicht wahr, sagt der Sozialphilosoph Axel Honneth
Sind Sie auch der Meinung, dass in der kapitalistischen Marktwirtschaft nur das egoistische Profitstreben zählt und die Moral nicht gefragt ist? Die allermeisten Menschen wären wohl instinktiv dieser Ansicht: dass nur das Geld zählt, alles zur Ware wird und sich alle zwischenmenschlichen Beziehungen auf ein System der nackten, baren Zahlung reduzieren.
Die ultraliberalen Kapitalismusfreunde würden sagen: Ja, das ist so – und gut so. Die schneidigen marxistischen Kapitalismusgegner würden sagen: Ja, das ist so – und schlecht so. Axel Honneth will in seinem Opus magnum "Das Recht der Freiheit" zeigen, dass beide Unrecht haben. Honneth ist Frankfurter Philosophieprofessor und Direktor des legendären Instituts für Sozialforschung (also der direkte Erbe von Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas).
Er hat keinen flotten Essay geschrieben, sondern eine grundlegende philosophische Studie, die große Begriffe neu durchbuchstabiert: Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind zwei Begriffe, Vokabeln, Werte, die in der öffentlichen Diskussion gerne als Antipoden dargestellt werden. "Freiheit" – das umschließt den Wert der personalen Autonomie, gesichert von individuellen Freiheitsrechten, dazu gehört das Recht auf Privatheit und auch das Recht des Einzelnen, seine eigenen Zwecke zu verfolgen. Sie braucht, so gesehen, keine anderen. Sie lebt im Gegenteil davon, dass man von anderen und auch vom Staat in Ruhe gelassen wird. "Gerechtigkeit" dagegen ist ein relationaler Wert, der Begriff ist völlig sinnlos, wenn man ihn nicht im Verhältnis zu anderen denkt: Werde ich von anderen fair behandelt? Erfährt man die Anerkennung und den Respekt, die einem zustehen? Werde ich gerecht bezahlt?
Wenn man die Dichotomie dieser beiden großen Begriffe simpel auslegt, kann man zum Schluss kommen: Die Liberalen – auch die Ultra- und Neoliberalen – sind mehr für die Freiheit, die Linken mehr für die Gerechtigkeit.
Aber so simpel sind die Dinge nicht, allein, weil demokratische Freiheitsrechte (Wahlen, demokratische Mitbestimmung) darauf abzielen, dass man sie mit anderen gemeinsam ausübt. Freiheit ist aber auch ohne Gerechtigkeit schwer zu denken, denn, so Honneth, "als gerecht' muss gelten, was den Schutz, die Förderung und oder die Verwirklichung der Autonomie aller Gesellschaftsmitglieder gewährleistet".
Echte Freiheit braucht mehr als bloß die Garantie, von anderen nicht behelligt zu werden, und es ist eine lächerliche Schwundform der Freiheit, sie auf das Recht zu reduzieren, meine egozentrischen Lebensziele zu realisieren. Erstens, weil ich damit womöglich andere daran hindere, ihre Lebensziele zu realisieren. Zweitens, weil Selbstverwirklichung und Autonomie von Voraussetzungen leben, etwa von kulturellen und materiellen Ressourcen, von Bildung, aber auch von Sicherheit. Und drittens wäre ich ja gar nicht in der Lage, meine "egozentrischen Lebensziele" zu formulieren, wenn ich nicht mit anderen kommunikativ verbunden wäre.
Die Idee des Eigenen kann bei einem sozialen Tier wie dem Menschen nicht alleine aus dem Inneren kommen. Gerechtigkeit und Freiheit sind zirkulär verbunden, und sei es bloß in der simpelsten aller Weisen: Gerecht ist Freiheit für alle. "Reflexive Freiheit", wie Honneth das nennt, ist ohne das Zusammenwirken von Subjekten nicht zu denken. Honneth interessiert sich für "Freiheit" und "Gerechtigkeitsnormen" aber nicht in einem idealistischen Sinn, als reine Kategorien – er fragt nicht nach der "idealen Freiheit" –, sondern er versucht zu entwirren, wie Freiheitsnormen und Gerechtigkeitsnormen in der Wirklichkeit vorkommen. Er analysiert sie gewissermaßen in freier Wildbahn. In der Realität materialisieren sie sich etwa im Funktionieren von Institutionen, aber auch im sozialen Verkehr der Bürger untereinander. Man setzt im Umgang miteinander voraus, sich wechselseitig anzuerkennen und zu respektieren, man erwartet auch in der Sphäre der Marktökonomie nicht übervorteilt zu werden, und diese Erwartung materialisiert sich in Regeln, vom Kollektivvertragslohn bis hin zum Verbraucherschutz.
Die Pointe ist nun, dass auch die Marktwirtschaft, die das individuelle Profitstreben des Einzelnen anstacheln will, in solche moralische Vorannahmen eingebettet ist, in das, was Honneth in Anlehnung an Friedrich Hegel "Sittlichkeit" nennt. Diese Art von "Sittlichkeit" zieht eine Grenze zwischen dem gesellschaftlich Akzeptierten und dem nicht Akzeptierten. Den hohen Preis, der am Schwarzmarkt für Babys zu erzielen ist, würde kaum jemand als Beweis dafür nehmen, wie sehr wir den Wert menschlichen Lebens schätzen, sondern der Vorgang selbst – der Verkauf von Kleinkindern – würde als illegitimer, ja degoutanter Vorgang angesehen werden. Nicht einmal die verschrobensten Lobredner der Marktwirtschaft würden behaupten, dass man mit Babys handeln solle, solange es ein Angebot oder eine Nachfrage gibt.
Kurzum: Nicht nur ist der Markt auch von Moral eingehegt, die Marktwirtschaft selbst kann gar nicht funktionieren, wenn alleine nackte Zahlungsvorgänge die Fäden gesellschaftlichen Zusammenhalts ersetzen. Wie genau Regeln, Moral und Verkehrsformen die Ökonomie begrenzen, das variiert doppelt: über den Zeitverlauf und von Land zu Land. Der Philosoph, der "zu Hegel zurück geht", muss sie im Detail und in aller Wirklichkeit, also: in allen Wirklichkeiten analysieren. Das tut Honneth im zweiten Teil seiner Studie, deren optimistischer Sound gegen Ende hin gedämpft wird. Aber das liegt vielleicht nicht an ihm, sondern an der Wirklichkeit.
Reden wir einmal über Markt, Moral und Sittlichkeit
Robert Misik in FALTER 27/2011 vom 06.07.2011 (S. 18)
Im Kapitalismus zählt nur egoistisches Profitstreben? Ist gar nicht wahr, sagt der Sozialphilosoph Axel Honneth in seinem Opus magnum
Sind Sie auch der Meinung, dass in der kapitalistischen Marktwirtschaft nur das egoistische Profitstreben zählt und die Moral nicht gefragt ist? Die allermeisten Menschen wären wohl instinktiv dieser Ansicht: dass nur das Geld zählt, alles zur Ware wird und sich alle zwischenmenschlichen Beziehungen auf ein System der nackten, baren Zahlung reduzieren.
Die ultraliberalen Kapitalismusfreunde würden sagen: Ja, das ist so – und gut so. Die schneidigen marxistischen Kapitalismusgegner würden sagen: Ja, das ist so – und es ist schlecht so. Axel Honneth will zeigen, dass beide Unrecht haben. Der Frankfurter Philosophieprofessor und Direktor des legendären Instituts für Sozialforschung (also der direkte Erbe von Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas) hat gerade sein Opus magnum mit dem Titel "Das Recht der Freiheit" vorgelegt.
Honneth hat keinen flotten Essay geschrieben, sondern eine grundlegende philosophische Studie, die große Begriffe neu durchbuchstabiert: Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind zwei Begriffe, Vokabeln, Werte, die in der öffentlichen Diskussion gerne als Antipoden dargestellt werden. "Freiheit" – das umschließt den Wert der personalen Autonomie, gesichert von individuellen Freiheitsrechten, dazu gehört das Recht auf Privatheit und auch das Recht des Einzelnen, seine eigenen Zwecke zu verfolgen. Sie braucht, so gesehen, keine anderen. Sie lebt im Gegenteil davon, dass man von anderen und auch vom Staat in Ruhe gelassen wird. "Gerechtigkeit" dagegen ist ein relationaler Wert, der Begriff ist völlig sinnlos, wenn man ihn nicht im Verhältnis zu anderen denkt: Werde ich von anderen fair behandelt? Erfährt man die Anerkennung und den Respekt, die einem zustehen? Werde ich gerecht bezahlt?
Freiheit oder Gerechtigkeit?
Wenn man die Dichotomie dieser beiden großen Begriffe simpel auslegt, kann man zum Schluss kommen: die Liberalen – auch die Ultra- und Neoliberalen – sind mehr für die Freiheit, die Linken mehr für die Gerechtigkeit.
Aber so simpel sind die Dinge nicht, allein, weil demokratische Freiheitsrechte (Wahlen, demokratische Mitbestimmung) darauf abzielen, dass man sie mit anderen gemeinsam ausübt. Freiheit ist aber auch ohne Gerechtigkeit schwer zu denken, denn, so Honneth, "als gerecht' muss gelten, was den Schutz, die Förderung und oder die Verwirklichung der Autonomie aller Gesellschaftsmitglieder gewährleistet". Echte Freiheit braucht mehr als bloß die Garantie, von anderen nicht behelligt zu werden, und es ist eine lächerliche Schwundform der Freiheit, sie auf das Recht zu reduzieren, meine egozentrischen Lebensziele zu realisieren. Erstens, weil ich damit womöglich andere daran hindere, ihre Lebensziele zu realisieren. Zweitens, weil Selbstverwirklichung und Autonomie von Voraussetzungen leben, etwa von kulturellen und materiellen Ressourcen, von Bildung, aber auch von Sicherheit. Und drittens wäre ich ja gar nicht in der Lage, meine "egozentrischen Lebensziele" zu formulieren, wenn ich nicht mit anderen kommunikativ verbunden wäre. Die Idee des Eigenen kann bei einem sozialen Tier wie dem Menschen nicht alleine aus dem Inneren kommen. Gerechtigkeit und Freiheit sind zirkulär verbunden, und sei es bloß in der simpelsten aller Weisen: Gerecht ist Freiheit für alle. "Reflexive Freiheit", wie Honneth das nennt, ist ohne das Zusammenwirken von Subjekten nicht zu denken.
Am Ende steht Sittlichkeit
Honneth interessiert sich für "Freiheit" und "Gerechtigkeitsnormen" aber nicht in einem idealistischen Sinn, als reine Kategorien – er fragt nicht nach der "idealen Freiheit" –, sondern er versucht zu entwirren, wie Freiheitsnormen und Gerechtigkeitsnormen in der Wirklichkeit vorkommen. Er analysiert sie gewissermaßen in freier Wildbahn. In der Realität materialisieren sie sich etwa im Funktionieren von Institutionen, aber auch im sozialen Verkehr der Bürger untereinander. Man setzt im Umgang miteinander voraus, sich wechselseitig anzuerkennen und zu respektieren, man erwartet auch in der Sphäre der Marktökonomie nicht übervorteilt zu werden, und diese Erwartung materialisiert sich in Regeln, vom Kollektivvertragslohn bis hin zum Verbraucherschutz.
Die Pointe ist nun, dass auch die Marktwirtschaft, die das individuelle Profitstreben des Einzelnen anstacheln will, in solche moralische Vorannahmen eingebettet ist, in das, was Honneth in Anlehnung an Friedrich Hegel "Sittlichkeit" nennt. Diese Art von "Sittlichkeit" zieht eine Grenze zwischen dem gesellschaftlich Akzeptierten und dem nicht Akzeptierten. Den hohen Preis, der am Schwarzmarkt für Babys zu erzielen ist, würde kaum jemand als Beweis dafür nehmen, wie sehr wir den Wert menschlichen Lebens schätzen, sondern der Vorgang selbst – der Verkauf von Kleinkindern – würde als illegitimer, ja degoutanter Vorgang angesehen werden. Nicht einmal die verschrobensten Lobredner der Marktwirtschaft würden behaupten, dass man mit Babys handeln solle, solange es ein Angebot oder eine Nachfrage gibt.
Kurzum: Nicht nur ist der Markt auch von Moral eingehegt, die Marktwirtschaft selbst kann gar nicht funktionieren, wenn alleine nackte Zahlungsvorgänge die Fäden gesellschaftlichen Zusammenhalts ersetzen. Wie genau Regeln, Moral und Verkehrsformen die Ökonomie begrenzen, das variiert doppelt: über den Zeitverlauf und von Land zu Land. Der Philosoph, der "zu Hegel zurück geht", muss sie im Detail und in aller Wirklichkeit, also: in allen Wirklichkeiten analysieren. Das tut Honneth im zweiten Teil seiner Studie, deren optimistischer Sound gegen Ende hin gedämpft wird. Aber das liegt vielleicht nicht an ihm, sondern an der Wirklichkeit.