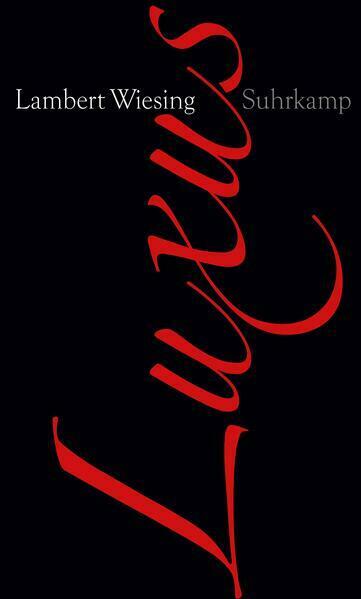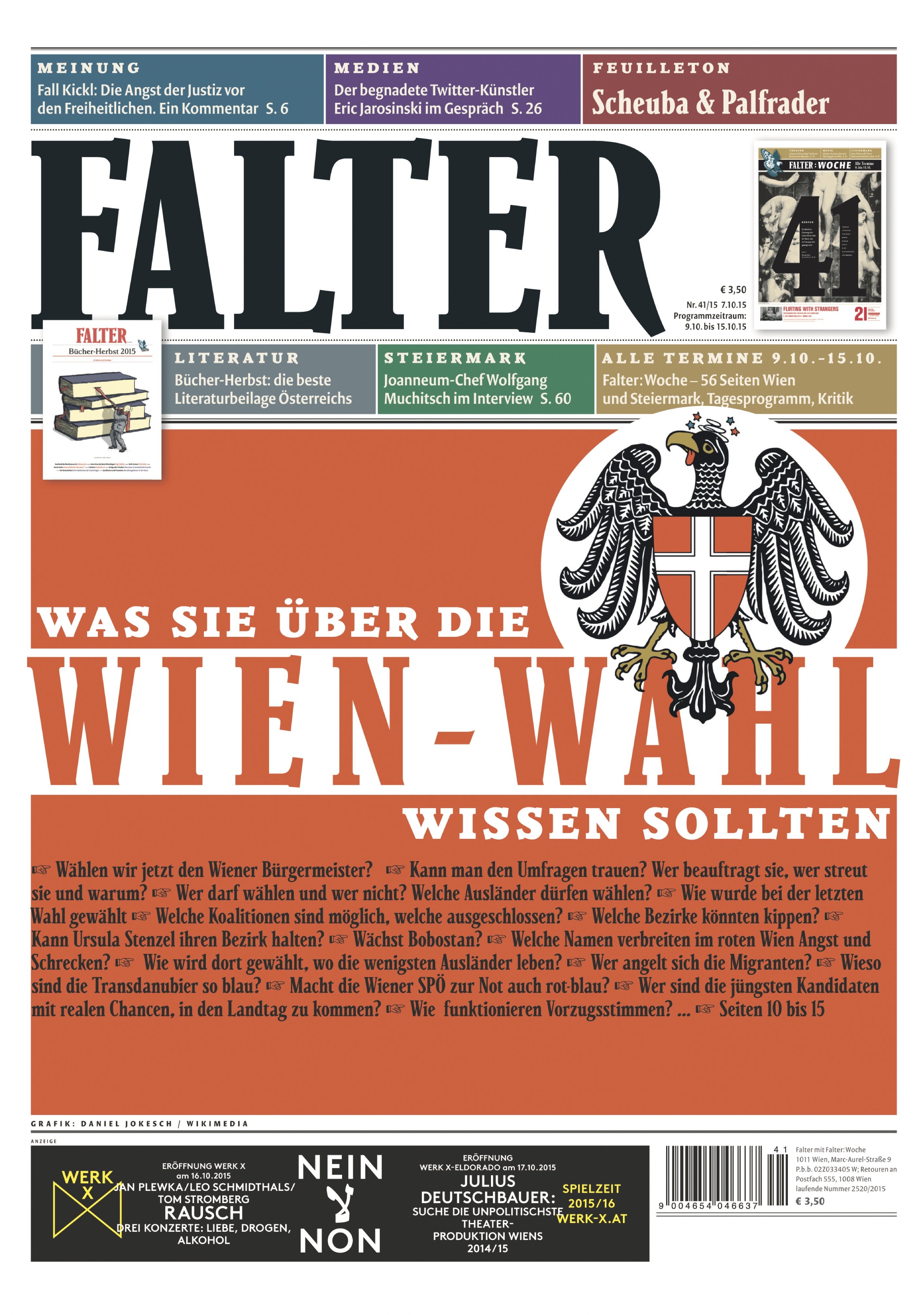
Luxus ist fein: haben, um zu sein
Klaus Nüchtern in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 44)
Philosophie: Lambert Wiesing arbeitet sich in jeder Hinsicht erschöpfend am Begriff des Luxus ab
Wer von diesem Buch erwartet, dass es mit exklusiven Automodellen, Preisen von Hotelsuiten oder süffigen Anekdoten eines dekadenten Lebenswandels aufwartet, ist auf dem falschen Luxusdampfer. Sein Verfasser, Lambert Wiesing (Jg. 1963), sitzt auf einem Lehrstuhl für Bildtheorie in Jena und hat davor Bücher mit Titeln wie „Sehen lassen. Die Praxis des Zeigens“ (2013) oder „Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie“ (2009) publiziert. Edutainment sieht anders aus.
Armbanduhren mit Tourbillon (einem sinnlos komplizierten, überflüssigen Mechanismus, der zur Ganggenauigkeit beitragen soll) sind so ziemlich das einzige konkrete Beispiel für das Phänomen, dem sich der deutsche Philosoph widmet: Luxus. Zu dem haben die Philosophen nach David Hume nämlich nicht mehr allzu viel zu sagen gehabt, wie Wiesing leicht verschnupft anmerkt.
Diese gleich im ersten Satz aufgestellte Behauptung wird zwar vom Autor selbst widerlegt, wenn er im letzten Siebtel seines Buches ausführlich auf Adorno und dessen Kritik an Thorstein Veblens „Theorie der feinen Leute“ eingeht, aber ein bisschen PR in eigener Sache wird man niemandem übelnehmen wollen. Nur leider braucht der Leser ziemlich lange, um herauszufinden, was überhaupt Sache ist.
Dass der Autor „Luxus und Protz“ (eigentlich gemeint: Protzerei) „als zwei grundlegend verschiedene Phänomene behandelt“, wird bereits auf Seite 15 deklariert, womit auch klargestellt ist, dass es hier nicht um eine moralische Verurteilung des Phänomens, sondern die Arbeit am Begriff geht. Die fällt hinreichend gründlich, um nicht zu sagen „übergründlich“ aus. „Friedrich Schiller ist nicht gerade berühmt dafür, sich philosophisch eingehend mit den Problemen oder Phänomenen des Luxus befasst zu haben“, schickt Wiesing dem ersten Teil seines Buches einen Satz voraus, dessen Teaser-Qualitäten als fragwürdig gelten müssen. Es folgen: 50 Seiten über Schillers Theorie des Spiels, gelesen durch die Brille von Heidegger, Husserl und Merleau-Ponty. Ein Drittel des Buches ist danach schon einmal durch.
„Das Ziel der Überlegungen ist die Entwicklung einer klaren Kategorie, um mit dieser differenzierte und präzise Beschreibungsmöglichkeiten zu erhalten“, lässt der Autor, ein wahrer Virtuose in der Disziplin des Bei-der-Stange-Haltens, die Leser auf Seite 76 wissen und zieht noch einmal ein Schnoferl ob der Luxus-Ignoranz der Philosophen. Das „Zwischenergebnis“ auf Seite 109: „Luxus ist das Produkt einer Interpretation von etwas technisch Nichtnotwendigem als etwas für Menschen Nichtnotwendiges, welches dann gegebenenfalls in einem zweiten Schritt auch noch als ein Gut oder Übel interpretiert wird.“ Ja, dann!
Keine Frage, der Autor hat über sein Thema gründlich nachgedacht und dabei einige luzide Einsichten gewonnen – etwa in das Verhältnis von Eleganz und Luxus: Erstere negiert die Kausalität so wie Letzterer die Zwecke; beide werden als „Formen des Entrücktseins, des Nichtteilnehmens, des Nichtmitmachens“ betrachtet. Unter dieser Perspektive gewinnt Luxus eine nachgerade subversive Qualität, und es ist bezeichnend, dass er bei Adorno ganz nah an dessen Kunstbegriff steht.
Leider verfügt die Prosa, die Wiesing schreibt, über die Eleganz einer Diplomarbeit: Die Physis, die jene scheinbar zum Verschwinden bringt, haftet viskos wie Melasse an den Sätzen, denen jede Verve nicht zuletzt deswegen abgeht, weil die zutage beförderte Erkenntnis – Luxus ist eine ästhetische Erfahrung, die notwendig auf Besitz beruht und der, so wie dies Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“ am Beispiel des Schönen ausgeführt hat, die reflektierende Beurteilung des Gegenstands vorhergeht – ständig wiederholt wird.
Die durchaus überzeugenden Thesen wollen gerne frech und unkonventionell sein, kommen aber in etwa so dandyhaft daher wie ein Volkshochschulkurs für Peddigrohrflechten. „Luxus ist der Dadaismus des Besitzens“, steht auf dem Cover. Es ist der einzige Satz seiner Art. Insofern ist der Umschlag kein Luxus, sondern bloß eine Mogelpackung.