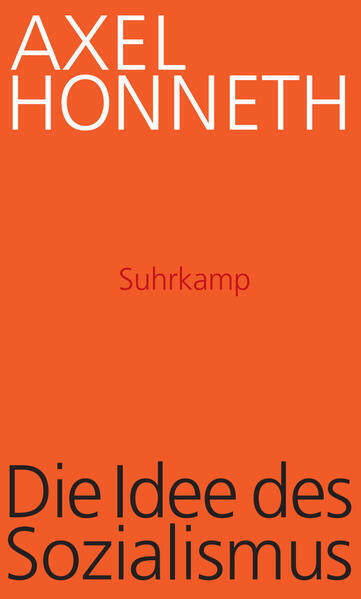Selbstverwirklichung oder Freiheit?
Matthias Dusini in FALTER 41/2015 vom 07.10.2015 (S. 45)
Philosophie: Was könnte Sozialismus heute bedeuten? Axel Honneth hat dazu wenig konkrete Ideen
Neue linke Parteien in Spanien und Griechenland propagieren die Rückkehr zum Sozialismus. Der kürzlich gewählte Labour-Chef Jeremy Corbyn will „Produktionsmittel verstaatlichen“, und der politische Philosoph Slavoj Žižek sieht im Kommunismus die einzige Alternative zum herrschenden Neoliberalismus. Welche Potenziale für die Lösung von aktuellen und Zukunftsfragen hat dieser Trend?
Schauen wir bei dem deutschen Sozialphilosophen Axel Honneth nach, der in seinen Schriften an die Kritische Theorie anknüpft und soeben einen Versuch einer Aktualisierung der Theorie des Sozialismus vorgelegt hat, bewegt von der Tatsache, dass das Thema mehrere Generationen von Theoretikern zu Auseinandersetzungen anstachelte. Émile Durkheim, Max Weber oder Joseph Schumpeter stellten sich die Frage, ob der Sozialismus die bessere Zukunft nach der kapitalistischen Gegenwart sein wird. „Heute scheint es als ausgemacht zu gelten, dass er seine Zeit inzwischen überlebt hat“, konstatiert Honneth.
Die Stärke des Buchs liegt in der Darstellung der Ursprünge. Honneth beschreibt den Sozialismus als geistiges Kind der Industrialisierung. Frühsozialistische Aktivisten wie Robert Owens in England oder die Fourieristen in Frankreich stellten fest, dass die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für einen Großteil der Bevölkerung leere Versprechungen geblieben waren. Statt der „wahren Liebe und Vertraulichkeit“ unter den Gliedern des Gemeinwesens, wie es in Texten der Aufklärung hieß, bestimmte der von Eigennutz getriebene Konkurrenzkampf das nachrevolutionäre Leben.
Wie lässt sich das real existierende Gegeneinander durch ein utopisches Füreinander ablösen, wie die Freiheit ökonomischer Selbstverwirklichung mit solidarischer Brüderlichkeit verbinden? „Die sozialistische Bewegung nahm von dem Gedanken ihren Ausgang, nicht mehr die Einzelperson, sondern die solidarische Gemeinschaft als Trägerin der zu verwirklichenden Freiheit zu begreifen“, schreibt Honneth.
Mehr Liebe im Sinne gegenseitiger Anerkennung und weniger Neid und Eigennutz: Warum konnte sich diese andere Idee von Gesellschaft nicht durchsetzen? In der Analyse des Scheiterns der Idee „sozialer Freiheit“ beweist der Autor seine Fähigkeit, eine immense Literatur zu überblicken und daraus einleuchtende Argumente herauszufiltern. Den Strickfehler der Idee solidarischer Gemeinschaften erkennt Honneth darin, dass sich die Gründerväter des Sozialismus, etwa Saint-Simon und Marx, zu sehr auf das Feld wirtschaftlicher Aktivitäten, vor allem auf die Industriearbeit beschränkten.
Ein weiterer Geburtsfehler sei die metaphysisch aufgeladene Erwartung einer nahenden Revolution, die es den Menschen der Gegenwart verunmöglichte, die Veränderbarkeit kapitalistischer Gesellschaften experimentell zu erproben. Die kleine Selbstverwirklichung des Individuums wurde der Idee der nahenden großen Freiheit des Kollektivs geopfert. Mit dem Zusatzwort „demokratisch“ ließ sich dieses Defizit des Sozialismus nicht beheben.
Beim Versuch, die alten Ideale zum Leben zu erwecken, ist der Autor bereit, ihre Verzahnung mit den inzwischen haltlos gewordenen gesellschaftstheoretischen Grundannahmen schrittweise rückgängig zu machen. Nun wird es spannend: Gelingt es ihm, den Sozialismus der Fabriken und Kooperativen zu überwinden und die Idee einer zeitgemäßen sozialen Freiheit zu entwerfen?
Leider wird die Argumentation an dieser Stelle nebulös. Statt das Programm eines experimentellen Sozialismus ohne Heilsversprechen präzise zu benennen, bezieht sich Honneth auf John Deweys Vorschlag einer „ungezwungenen Kommunikation der Gesellschaftsmitglieder zum Zwecke der intelligenten Problemlösung“, was immer das heißen mag. Vergeblich wartet der Leser auf anschauliche Beispiele dafür, wie die Hegemonie des ökonomischen Wettbewerbs durch ein solidarisches Füreinander beendet werden könnte. Der konkreteste Vorschlag ist die Einrichtung eines Archivs, in dem alle in der Vergangenheit bereits unternommenen Versuche von Vergesellschaftung gespeichert werden. Ob das reicht, „um den Sozialismus aus seinem alten Denkgehäuse zu befreien“?
Auch ein zweiter Anlauf, historische Versäumnisse zu korrigieren, endet enttäuschend. Warum, fragt der Autor, hätten die Frühsozialisten den Begriff der sozialen Freiheit immer nur auf die ökonomische Sphäre bezogen? Marx spricht zwar von Liebe im Sinne von Zwanglosigkeit und Gleichberechtigung, sieht aber ausgerechnet die persönlichen Beziehungen durch Produktionsverhältnisse bestimmt. Die Sozialisten gewannen den Begriff der sozialen Freiheit am anschaulichen Vorbild der Liebe. Als die Emanzipationsbewegung der Frauen die soziale Freiheit forderte, galt das lediglich als zu überwindender Nebenwiderspruch.
Der Autor sieht den Ball, spielt ihn aber nicht weiter. Auf die Frage, wie eine solidarische Freiheit der sich um Geschlechter und Ethnien formierenden Gruppen aussehen könnte, geht er nicht näher ein. Daher lässt sich in dem Buch auch keine Erklärung dafür finden, warum sich die Anliegen des Feminismus und der queeren Bewegung so selten mit ökonomischen Forderungen linker Gewerkschafter überschneiden. Die Utopie einer gerechten Umverteilung von Anerkennung, eines Sozialismus der Selbstachtung, deutet Honneth nur an.
Die finale Skizzierung einer „demokratischen Lebensform“ endet mit einer Ermutigung, „sich an die umsichtige Einreißung von noch bestehenden Schranken und Blockaden bei der Verwirklichung eines zwanglosen Füreinanders in allen zentralen Gesellschaftssphären zu machen“. Dann doch lieber – keine Macht für niemand!