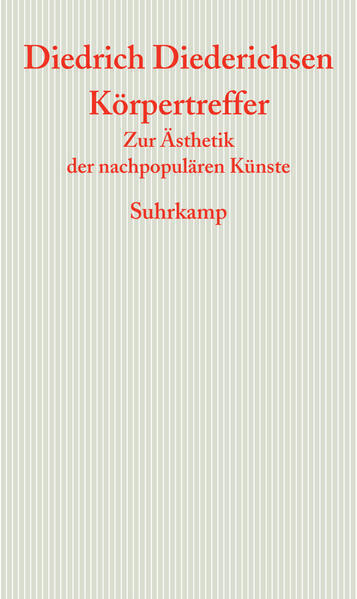Wette auf die Tragfähigkeit von Begriffen
Florian Baranyi in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 35)
Kunsttheorie: Diedrich Diederichsen liefert eine fulminante Theorie der Gegenwartskünste
Diedrich Diederichsen steht wie kaum ein zweiter deutschsprachiger Kulturtheoretiker für intellektuelle Selbstentgrenzung. In der linken Szene sozialisiert, machte er sich ab 1985 als Chefredakteur des Spex einen Namen. Das Magazin erhob die Plattenkritik zur philosophisch relevanten Textsorte und analysierte die Populärkultur mit Termini aus der postmodernen Theoriewelle. Als „Kollateralschaden“ durfte sich dabei freilich die längste Zeit jeder fühlen, der nicht schon mehrere Semester Geisteswissenschaften studiert hatte und von den Besprechungen wenig bis gar nichts verstand.
Diederichsen selbst blieb der Verbindung von Populärkultur und Theorie stets treu und startete ab den 1990ern eine internationale akademische Karriere als Kunst- und Kulturtheoretiker. Seit 2006 lehrt er als Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien.
Gerade sind Diederichsens 2015 gehaltene Adorno-Vorlesungen erschienen. Seit 2002 lädt das Frankfurter Institut für Sozialforschung Denkerinnen und Denker ein, Anleihen am Werk des Helden der kritischen Theorie zu nehmen und es weiterzudenken. Diederichsen versucht sich in „Körpertreffer“ an einer Ästhetik der nachpopulären Künste. Hauptsächlich kreisen seine Ausführungen dabei um zwei Begriffe: den Index und die Verursachung. Das Indexalische ist ihm das ästhetisch Spezifische an den verschiedenen Formen populärer Kultur ab den 1960er-Jahren.
Schallplatten, Fotografie und Film zeichnen ein Stück Welt auf, das durch die mediale Übermittlung beim Hörer und Seher einen paradoxen Eindruck von Unmittelbarkeit erzeugt. Diederichsen macht sich systematisch zum Theoretiker dieses „Index-Effekts“. Seiner Meinung nach ist die Wirkung dieser unmittelbaren Präsenz von Welt in den populären Medien nämlich derart stark, dass sie alle vorhergehenden Größen der Ästhetik über Bord wirft.
So gehe es etwa in einem modernen Blockbuster gerade nicht um den Plot, sondern das Spektakuläre zentriere sich um den Effekt, den die Übermittlung von realen Körpern im Bild auf den Zuseher ausübe. Es geht also um gefühlte Realpräsenz von etwas Echtem, das durch die 24 Bilder pro Sekunde, durch die Nadel in der Rille oder das entwickelte Foto auf uns einwirkt.
Die Funken, die Diederichsen aus diesem Effekt, den er in Anlehnung an Brecht als B-Effekt (Begehrens-Effekt) theoretisiert, schlägt, sind erstaunlich. So nimmt er an, dass die unendliche Variation der Themen Sex und Gewalt in der populären Kultur daher rührt, das diese per se einen ähnlichen Effekt auslösen wie das Indexalische. Einen Effekt, der den Zuseher oder Hörer direkt anspringt und Reflektion und Interpretation hintergeht. Hier kommt Diederichsens zweiter Begriff ins Spiel: die Verursachung. Die Effekte des Index verursachen nämlich etwas im Zuseher oder Zuhörer, ohne dass eine kalkulierte Intention des Künstlers diesen Effekt kontrollieren könnte.
Mit anderen Worten: Diederichsen entwickelt hier auf knappem Raum auch eine Ästhetik, die die gute alte Schulfrage, was der Künstler denn (wem und wie) sagen wollte, vollends aus den Angeln hebt. Was er hier alles unter zwei Begriffen bündeln und mit ihnen erklären kann, ist bewundernswert: Die Verfahrensweisen der modernen Kunst seit Andy Warhol, die Geburt der „Sexyness“ im Umfeld des queeren Theaters im New York der 1960er-Jahre und den kalkulierten medialen Umgang mit ihr bis ins gegenwärtige Reality-TV hinein, die Entstehung der Konzeptkunst aus der avantgardistischen Musiktheorie, die Gemeinsamkeiten von Hip-Hop, Heavy Metal und Pornografie und nicht zuletzt eine neue Systematisierung von Politik und Kunst, die vollkommen ohne die Intention des Künstlers auskommt. Dabei herrscht mitnichten Eklektizismus.
Hier denkt jemand Themen zusammen, bei denen man nicht einmal auf dieser Abstraktionsebene Berührungspunkte auch nur vermutet hätte. Außerdem erfüllt Diederichsen natürlich die Erwartungshaltung der Vorlesungsreihe. Der Namenspatron Adorno spielt eine merkliche Rolle als Stichwortgeber. So nimmt Diederichsen Adornos und Horkheimers Begriff der Kulturindustrie aus der „Dialektik der Aufklärung“ auf und wendet ihn in einer Weise gegen ihn selbst, dass einem Hören und Sehen vergeht – und er einem neu beigebracht wird.
War bei Adorno und Horkheimer die Kulturindustrie der Buhmann, der aus Kunst nur noch Ware mit rein ökonomischem Gebrauchswert machte, entfaltet Diederichsen eben aus dem Umstand, dass die Kunst sich ihre Anleihen aus der populären Kultur holt, ihre Beschreibbarkeit. Das ist genau die im Untertitel versprochene Ästhetik der nachpopulären Künste.
Für Diederichsen hat die zeitgenössische Kunst nämlich nur noch zwei Optionen: sich entweder den in den Massenmedien entstandenen Effekten hinzugeben, um das Publikum doch noch zu erreichen, oder konzeptuell zu werden. Im ersten Fall hieße das eine Orientierung an Sex und Gewalt, im zweiten in Kauf genommene Unverständlichkeit beim Großteil des Publikums.
Eben hier zeigt sich, was die Adorno-Vorlesungsreihe hervorbringt: avantgardistische Theorieentwürfe, die aufgrund der Dramaturgie des Formats eine Wette auf die Tragfähigkeit weniger Begriffe eingehen müssen. Der Einsatz liegt, wie schon in der Diederichsen-Ära des Spex, im Abstraktionsniveau der Begrifflichkeit und Argumentation. Wer sich auf die Wette einlässt, hat bei der Lektüre allerdings viel zu gewinnen: eine Postpoptheorie der Kunst voller Chuzpe und stupender Belesenheit.