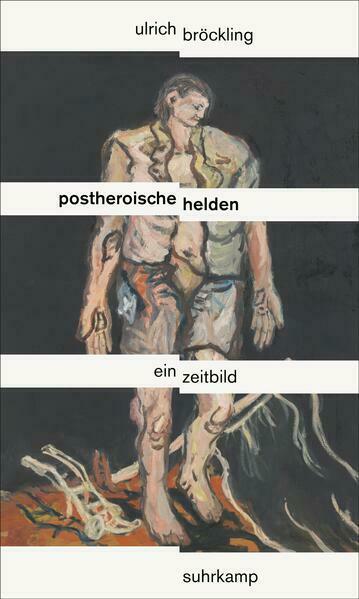Brauchen wir Helden? Und wenn ja, welche?
Klaus Nüchtern in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 30)
Debatte: Auch im „postheroischen Zeitalter“ herrscht ungebrochene Nachfrage nach Superhelden.
Drei Bücher von Ulrich Bröckling, Lisz Hirn und Dieter Thomä nähern sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven
Es flattert immer noch mehr Post ins Haus: Postmoderne und Poststrukturalismus, Posthistoire und Posthumanismus, Postkolonialismus und Postdemokratie, Post-Rock und postdramatisches Theater. Auch die Helden sind vor dieser Entwicklung nicht gefeit. „Postheroische Helden“ betitelt sich Ulrich Bröcklings „Zeitbild“ in Buchform, wobei der deutsche Kultursoziologe darauf hinweist, dass sich die nachheldische Ära nur adjektivisch manifestiert: Es gibt zwar eine „postheroische Kriegsführung“ und ein „postheroisches Management“, aber eben keinen „Postheroismus“.
Einige Monate früher ist das Buch des deutschen Philosophen Dieter Thomä erschienen, das schon im Titel Einspruch gegen den Abgesang auf den Helden erhebt: „Warum Demokratien Helden brauchen“. Aber obgleich sich Bröckling auf die Analyse beschränkt, wohingegen Thomä normativ argumentiert und offen eine Agenda vertritt, sind sich die beiden Bücher gar nicht so unähnlich. Das betrifft zum einen die Definition dessen, was überhaupt einen Helden ausmacht, und zum anderen die Skepsis gegenüber allen Postismen.
Der Titel „Postheroische Helden“ ist denn auch nur scheinbar paradox, wie Bröckling am Beispiel des Managements klar macht: „Ein postheroischer Führungsstil ist keine einfache Negation des heroischen, sondern ein Heroismus höherer Ordnung: die souveräne Größe, um der Sache willen auf heldenhafte Alleingänge zu verzichten“ – weil sich die Managerhelden alten Zuschnitts als „Exzellenzverhinderer“ erwiesen hätten. Und überhaupt sei, wie Bröckling anmerkt, der Topos des Postheroischen als Verabschiedungsgeste unbrauchbar, weil dieser ja „die Unterscheidung heroisch/nichtheroisch wieder in die Beobachtung einer Gesellschaft einführt, die diese Unterscheidung in ihrer Selbstbeobachtung verabschiedet zu haben glaubt“.Dass die Diagnose „Heldendämmerung“ nicht haltbar ist, beweist das zeitgenössische Kino, wo Super-, Bat-, Spider-Man, X-Men und, immerhin, auch Wonder Woman seit Jahren Dauerdienst tun. Geschaffen wurden diese Figuren großteils in den 1930er- und 1940er-Jahren in den Vereinigten Staaten, die der Welt ganz generell idealtypische Bilder eherner Virilität aufgezwungen haben, verkörpert von Schauspieleridolen wie John Wayne, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger.
So sieht es jedenfalls die französische Philosophin Elisabeth Badinter, die von ihrer jungen österreichischen Kollegin Lisz Hirn zustimmend zitiert wird. Den Umstand, dass das Universum der Superhelden von „Action-, Gewalt-, Helden-, Retter-, Rache- oder Porno-Fantasien“ und nicht von Konzepten „wie Kooperation, Fürsorglichkeit oder Emanzipation“ dominiert wird, führt Hirn auf die Tatsache zurück, dass 90 Prozent der Drehbücher von Männern geschrieben werden und der Anteil an Regisseurinnen noch geringer ist.
In Hirns Buch „Wer braucht Superhelden“, das ohne Fragezeichen im Titel auskommt, werden zahlreiche Statistiken aufgerufen und Phänomene benannt, die sich unter dem Rubrum „toxische Männlichkeit“ versammeln lassen: die überwiegend männliche Zustimmung, die rechtsextreme Parteien erfahren; die „Involuntary Celibacy“(Incel)-Bewegung, die ihren Anspruch auf Sex mit Gewalt und Zwangsmaßnahmen durchsetzen will; die „Smombies“ (= Smartphone + Zombie), die das analoge Leben verpassen und 20 Prozent der Fußgängerunfälle verursachen; arabische Mütter, die ihre Söhne zu Macho-Prinzen erziehen; die Abschaffung der Gender-Studies in Ungarn oder die Kürzung der Gelder für oberösterreichische Frauenhäuser durch die türkis-blaue Koalition.
Es gibt wenig, was dieser zivilsationskritische Panoramaschwenk nicht zumindest ein paar Sekunden lang in den Blick nimmt. Sehr tief dringt dieser freilich selten. Stattdessen werden – zwischen einem Kierkegaard-Zitat da und einem von Nietzsche dort – „Ja eh“- und „No na“-Aussagen aneinandergereiht. Meist wird man zustimmend mit dem Kopf nicken. Warum Superhelden den „perfekten Untertan“ verkörpern, erschließt sich freilich nicht. Und wenn beklagt wird, dass „Apps wie Tinder, Uber oder Pizzabestellungen“ die Bedürfnisse ihrer jungen männlichen Entwickler repräsentierten, muss man anmerken, dass auch schon Frauen gesichtet worden sind, die in ein Uber-Taxi gestiegen sind, sich eine Pizza bestellt oder nicht uninteressiert Tinder-Profile durchgewischt haben.
Eine differenziertere und für Ambivalenzen offene Auseinandersetzung mit historischen und gegenwärtigen Heldenmodellen leisten die anderen beiden Bücher. Ulrich Bröckling hält daran fest, dass sich die Welt von Superman & Co „als Schauplatz avancierter Reflexionen über den Platz des Heroischen in der Gegenwartskultur“ erweise. Und in seiner „Kleinen Verteidigung der Superhelden“ schreibt Dieter Thomä, dass es just die Doppelnatur „zwischen Normalmenschen und Überflieger“ sei, die Superhelden „anschlussfähig für Normalsterbliche“ mache. Beatrix Kiddo aus „Kill Bill“ weist am Ende die ihr von Bill zugewiesene Rolle als Killermaschine zurück, tötet diesen „und macht es sich mit ihrer Tochter vor dem Fernseher gemütlich“.
Auch wenn man mit Bröckling das „postheroische“ Zeitalter als jenes begreift, in dem die Helden problematisch werden und sich der Reflexion stellen müssen, hat die Heldenkritik den Helden von Anfang an begleitet.
Odysseus – im Vergleich zu einem egozentrischen, jähzornigen Helden wie Achilles ohnedies schon eine differenziertere Heldenfigur – war für Pindar ein falscher Hund, für Euripides ein zynischer Ungustl und für Sophokles ein rücksichtsloser Opportunist. Ja, folgt man der Typologie von Thomä und Bröckling, lässt sich sogar bezweifeln, ob viele der „klassischen“ Helden überhaupt Helden waren, denn ein Held – darin sind sich die beiden einig – diene einer Sache, die größer sei als er selbst und dürfe eines auf keinen Fall: ein Held sein wollen. Der Opfertod ist die dunkle Seite des Heldennarrativs, aber er darf nicht mutwillig angestrebt werden: „Mit entblößter Brust in gezückte Schwerter hineinzurennen, ist keine Heldenpose, sondern Wehrkraftzersetzung“, meint Bröckling.
Die Ressourcen an Opferbereitschaft, die der Staat seinen Bürgern abverlangen kann, werden in postheroischen Zeiten aber immer knapper. Im globalen Norden, wohlgemerkt. Die „Heldenmaschine“ des Krieges ist ins Stottern geraten, und der US-amerikanische Militärstratege und Politikwissenschaftler Edward N. Luttwak verhöhnt die verweich- bzw. verweiblichte Haltung jener, die ihren Söhnen (und Töchtern) vielleicht eine Karriere beim Militär vergönnen, aber empört reagieren, wenn diese tatsächlich zum Kriegseinsatz abkommandiert werden, als „mammismo“.
Eine doppelte Asymmetrie der Opferbereitschaft spaltet die Welt. Die reichen Industrieländer suchen die eigenen Verluste im „postheroic warfare“ mittels Flugzeug-, Raketen- und Drohneneinsätzen distanztechnologisch zu minimieren, nehmen dafür aber steigende Zahlen von Zivilopfern der anderen Seite in Kauf. Diese verfügt ihrerseits über größere Humanressourcen – Stichwort „youth bulge“ – und kompensiert die technische Unterlegenheit mit militantem Märtyrertum: Der Selbstmordattentäter ist sozusagen die heroische Antwort auf die postheroische Drohne.
Dass aufgrund der kriegstechnologischen Entwicklung hin zu Fernlenk- und Massenvernichtungswaffen im postheroischen Krieg kein Heldentum mehr möglich wäre, ist freilich ein Irrtum: Der Pilot, der den Abwurf der Atombombe verweigert hätte, wäre das Musterbeispiel für einen „Helden der Überwindung“, einen Typus, den Dieter Thomä vom „Helden der Übererfüllung“ unterscheidet, die das, was allgemein für gut befunden wird, in unerhörtem Ausmaß erbringen. Der „Held der Arbeit“ im Kommunismus glänzt als „Stachanowist“ (benannt nach der sowjetischen Kampagne zur Steigerung der Arbeitsproduktivität), wohingegen Wehrdienstverweigerer oder Whistleblower eine Norm verletzen, um entweder den Status quo ante wiederherzustellen oder ein neues moralisches Koordinatensystem zu etablieren. Im Moment der Tat ist ihr Heldentum ungewiss, sie sind, nach einem Wort Nietzsches, „schlechte Menschen, welche später gutgesprochen worden sind“.
Wie komplex die Sache mit den Helden ist, lässt sich ausgerechnet an John Wayne zeigen, der meistens als Macho-Held alter Schule gehandelt wird. Dabei ist er ein postheroischer Held avant la lettre. John Fords Spätwestern „The Man Who Shot Liberty Valance“ (1962) ist so etwas wie die filmische Vorwegnahme des Böckenförde-Theorems von 1964 (benannt nach dem deutschen Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Böckenförde), das besagt, dass der freiheitliche säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann.
Dem jungen, ambitionierten Anwalt Ransom Stoddard (James Stewart), der frisch vom College aus dem Osten nach Shinbone kommt und wild entschlossen ist, dort Order by Law zu etablieren, nutzt sein Gesetzbuch gegen die gewalttätige Willkür des „Outlaws“ Liberty Valance (Lee Marvin) einen Dreck. Das pazifistische Greenhorn lässt sich (angetan mit einer Küchenschürze!) auf ein Duell ein, in dem Liberty Valance wider alle Wahrscheinlichkeit den Kürzeren zieht. Tatsächlich hat freilich Tom Doniphon (John Wayne) Valance aus dem Hinterhalt erschossen. Heldenhaft ist nicht die Tat an sich, sondern der Umstand, dass Doniphon lediglich Stoddard vom wahren Hergang erzählt, diesem durch die Aufrechterhaltung des Mythos eine glänzende Karriere sichert – und ihm auch noch die Frau überlässt, die er liebt.
Fords Film zeigt den historischen Moment, in dem das Heldenformat gewechselt wird – und ein vermeintlich „klassischer“ Helden, der darum weiß, auf seinen Ruhm verzichtet und abtritt. Als Stoddard nach Doniphons Tod die wahre Geschichte öffentlich machen möchte, spricht der Redakteur der lokalen Zeitung die berühmten Worte: „When the legend becomes fact, print the legend.“
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: