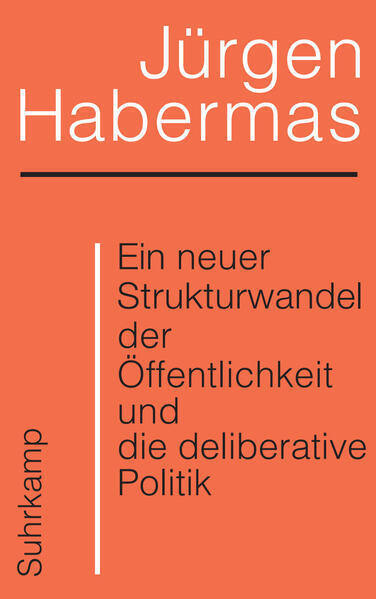Geschnatter "unserer redseligen Spezies"
Robert Misik in FALTER 38/2022 vom 21.09.2022 (S. 22)
Ein 93-jähriger Mann, der einen Großteil seines Lebens in der Studierstube verbrachte und primär per Brief kommunizierte (man sagt, er wäre auch per Fax erreichbar), schreibt über das Internet. Intuitiv neigt man zum Ausruf: Muss das sein?! Aber bei Jürgen Habermas ist das etwas anderes. Nicht nur wegen seiner legendären Bereitschaft, Witterung aufzunehmen, ein Vorgefühl für das zu haben, was auf uns zukommt. "Reizbarkeit" nannte er das einmal.
Genau 60 (!) Jahre ist es jetzt her, dass Habermas' Habilitationsschrift in Buchform mit dem Titel "Strukturwandel der Öffentlichkeit" erschien. Das neue, schmale Bändchen ist also auch eine Art von Selbstzitat: "Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und deliberative Politik." Jetzt schreibt Habermas von Medienarbeitern, die oft zu "Influencern" werden, "die um die Zustimmung von Followern für ihr eigenes Programm und ihre eigene Reputation werben". Habermas hat dafür gewiss eine Nase, denn er war zeitlebens kein weltabgewandter Denker, sondern hatte auch einen Sinn für Soundbites. Seine Titelzeilen waren stets auch Stichworte zur Zeit, die zu geflügelten Worten wurden ("Die neue Unübersichtlichkeit"), die griffige Pointe war ihm noch nie fremd, auch dem Streit auf großer Bühne wich er selten aus, also dem, was man auf Twitter modisch "Beef" nennt. Lässig schreibt er, dass er dieses oder jenes seinerzeit "wohl überpointiert habe".
Habermas' Buch zu lesen hat Erholungswert in den Aufgeregtheiten zeitgenössischer Öffentlichkeit. Zunächst verdeutlicht Habermas, welch Wunder stabile pluralistische Demokratien sind. "Je heterogener die sozialen Lebenslagen, die kulturellen Lebensformen und die individuellen Lebensstile einer Gesellschaft sind, desto mehr muss das Fehlen eines a fortiori bestehenden Hintergrundkonsenses durch die Gemeinsamkeit der öffentlichen Meinungs-und Willensbildung wettgemacht werden." Das war -und ist -die Funktion (bürgerlicher) Öffentlichkeit, erst durch Zeitungen, dann durch andere Formen der Massenmedien von TV bis Radio.
In diesen Öffentlichkeiten findet ein Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst statt, das in keinen totalen Konsens mündet, aber doch irgendein Maß gemeinsamer Auffassungen herstellt, das nötig ist, damit Gemeinwesen nicht im großen Tohuwabohu kollabieren.
Der "neue Strukturwandel der Öffentlichkeit" setzt frühere Tendenzen fort (etwa Kommerzialisierung oder die Herrschaft politischen Häppchen-Entertainments), zerstört die bisherigen Formen von Medienöffentlichkeit, zerreißt die Gesellschaft in Bubbles, die nichts mehr miteinander zu tun haben, macht sie zum "Kampfplatz konkurrierender Öffentlichkeiten". Bisher akzeptierte Prinzipien von Rationalität, die erst den Wettstreit konkurrierender Auffassungen ermöglicht haben, verlieren ihre Geltung. Klassische Medien sind ökonomisch bedroht und der Ökonomie des Netzes unterworfen, was einen Anpassungsdruck auf die Erregungszusammenhänge der Social-Media-Welten etabliert.
In diesen wiederum ist die Unterscheidung öffentlich/privat aufgeweicht, es wird in der Öffentlichkeit kommuniziert, als wäre man in einem privaten Raum. Diskurs löst sich auf in Geschnatter "unserer redseligen Spezies". Ohne den minimalen Konsens, der klassischerweise in der "Öffentlichkeit" hergestellt wird, zerreißt es nicht nur Gesellschaften, es wird auch die vernünftige demokratische Debatte unmöglich, die nicht nur ein Ideal ist, "sondern in pluralistischen Gesellschaften eine Existenzvoraussetzung jeder Demokratie".