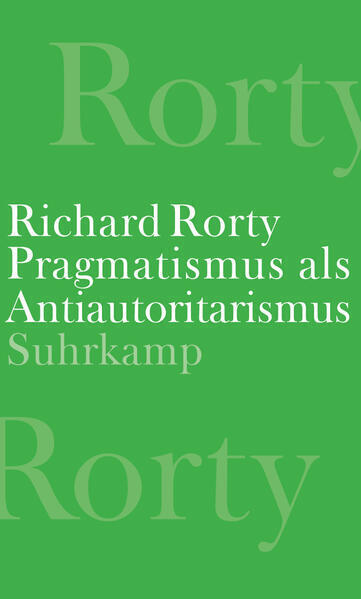Vom gesunden Misstrauen gegen geistigen Snobismus
Robert Misik in FALTER 9/2023 vom 01.03.2023 (S. 23)
Dass auch Starphilosophen nicht immer frei von Dünkelhaftigkeit sind, weiß jeder, der der Welt der Großdenker nur ein bisschen nahegekommen ist. Umso erfreulicher gestalteten sich Kontaktaufnahmen mit Richard Rorty. Obwohl einer der Größten seiner Zunft, musste man weder Sekretariate überlisten noch mit dem Zorn des Meisters rechnen, wenn man mit Rorty über ein aktuelles Thema sprechen wollte. Sandte man ihm ein E-Mail, erhielt man prompt eine Antwort, die etwa besagte, er sei jetzt zwar in dieser oder jener entlegenen Weltgegend, aber unter beigefügter Telefonnummer könne man ihn erreichen.
Rorty, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte und 2002 im Alter von 75 Jahren verstarb, bekämpfte jede Form von metaphysischen Letztbegründungen, Wahrheiten und Absolutheitsansprüchen. Aber dennoch war Rorty kein Relativist, dem alles moralisch gleich gültig ist. Jetzt hat der Suhrkamp-Verlag eine der grundlegendsten Arbeiten von Rorty als Buch herausgebracht, Vorlesungen nämlich, in denen er die wesentlichen Kernpunkte seines philosophischen Denkens durchbuchstabiert.
Was Rorty versuchte, war die "Vollendung der Aufklärung", wie Philosophenkollege Robert B. Brandom in seinem Vorwort bemerkt. "Pragmatismus als Antiautoritarismus", ist der Band überschrieben, und mit Antiautoritarismus ist hier nicht gemeint, dass Niedrigprivilegierte gegen Chefs rebellieren, obgleich Rorty auch dagegen nichts einzuwenden gehabt hätte. Antiautoritarismus, wie Rorty ihn hier versteht, bedeutet, dass unser Denken - wir -radikal ohne Autoritäten auskommen müsse. Das ist die letzte Konsequenz jenes Prozesses, der mit der Aufklärung begann, die Gott, Kirche und metaphysische Wahrheiten gestürzt hat. Alles ist Kommunikation, alles ist Sprachspiel. Höhere Wahrheit, auch die "Realität", all das gibt es nicht, da alles ein Produkt sozialer Praktiken ist und auch eine objektive Realität nicht unabhängig von unseren sprachlichen Beziehungen ist, die wir zu ihr knüpfen.
Dass etwa die Menschenrechte "immer schon" bestanden hätten, "auch als sie von niemandem anerkannt wurden", hält Rorty für eine absurde Behauptung. Das heißt aber nicht, gegen die Menschenrechte zu sein. Sondern, sogar im Gegenteil, sie als zivilisatorische Errungenschaft zu sehen, als eine Kulturleistung, die wir erbracht haben. Aber sie sind auch ein "korrigierbares Kulturvermächtnis", was uns täglich dazu ermahnen sollte, sie zu verteidigen. Dass wir als Menschen besser fahren, wenn wir kooperieren, als wenn wir uns gegenseitig niedermetzeln, ist zunächst eine Hypothese, aber eine erprobte. Ob diese "Probe" erfolgreich ist, können wir nur durch Kommunikation herausfinden, an der wir uns beteiligen.
Seit er als Teenager mit den Schriften Leo Trotzkis Bekanntschaft schloss, war das Ziel einer gerechteren Welt der Polarstern Rortys, der als Sohn undogmatischer Gewerkschaftsaktivisten in New York City geboren wurde. Um die Jahrtausendwende zettelte Rorty mit seinem kleinen Buch "Achieving Our Country" ("Stolz auf unser Land", so der Titel der deutschen Ausgabe) heftige Debatten an. Darin geht er hart mit den modernen "Kulturlinken" ins Gericht, die sich viele Gedanken über "Differenzkultur" machten und außerdem der Überzeugung seien, dass man "innerhalb des Systems" ohnehin nichts verbessern könne.
Dem stellte er die alte amerikanische Linke entgegen, die "unser Land voranbringen" wollte. Ein schicker Jetset-Philosoph war er nie. Beim Lesen philosophischer Bücher, schrieb er einmal, habe er vor allem eines gelernt: "Misstrauen gegenüber dem geistigen Snobismus, der mich anfangs zu dieser Lektüre bewogen hat."