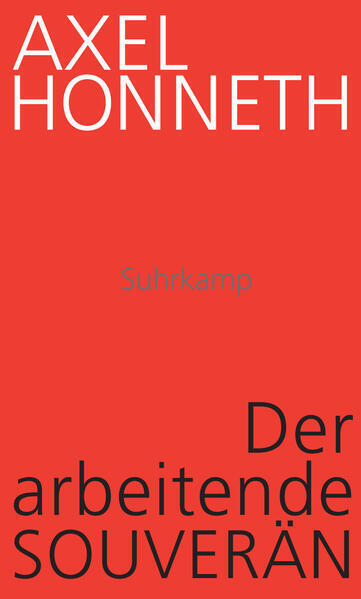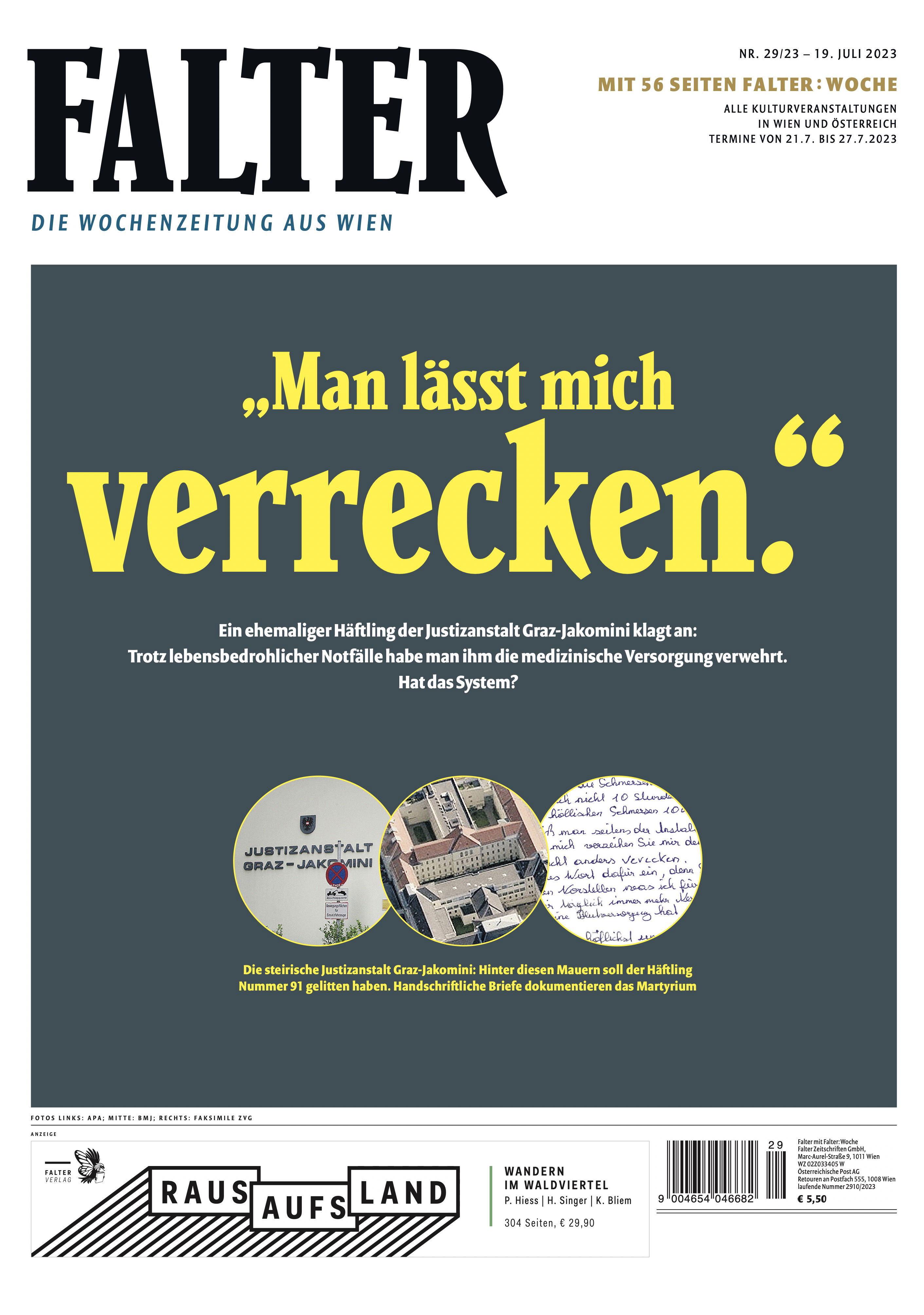
Die kleinen Stalins in den Werkshallen und Start-ups
Robert Misik in FALTER 29/2023 vom 19.07.2023 (S. 16)
Die Vielen sind in unserer Gesellschaft nominell der oberste Souverän, zugleich aber faktisch machtlos. Erlebt wird diese Machtlosigkeit nicht selten als "Ohnmacht des kleines Mannes", der das Gefühl hat, keine Stimme zu haben, nicht vertreten zu sein, also sich nicht wirksam im demokratischen System artikulieren zu können.
Soziale Lage, Status und Prestige, aber auch die Einübung in Selbstwirksamkeit spielen also eine nicht unerhebliche Rolle. Oder anders gesagt: die Wirklichkeit unserer Arbeitswelt. "Es gehört zu den größten Mängeln fast aller Theorien der Demokratie, mit erstaunlicher Hartnäckigkeit immer wieder zu vergessen, dass die meisten Mitglieder des von ihnen lauthals beschworenen Souveräns stets auch arbeitende Subjekte sind", formuliert der deutsche Sozialphilosoph Axel Honneth in seinem neuen Buch "Der arbeitende Souverän". Wer in Büro und Job, in der Fabrik und im Laden nur kommandiert und herablassend behandelt wird, der oder die wird eher nicht zum tragenden Subjekt einer liberalen Demokratie werden.
Dass die Demokratie vor Werktoren oder Bürotürmen haltmacht, wurde ja schon häufig beklagt. Gewerkschaften haben für "Mitbestimmung" gestritten und für eine "Humanisierung der Arbeitswelt".
Dabei ist aber nichts derart unumstößlich wie der Glaube der Mächtigen, die Beschäftigten seien verschiebbare Nummern und ökonomische Erfolge werden dann am besten ausfallen, wenn Manager ihre cäsarenhaften Entscheidungen alleine treffen. Das ist skurril, bedenkt man, dass Neoliberale dauernd die Weisheit der Vielen beschwören und die Klugheit dezentraler Marktentscheidungen. Aber wenn es um die Firma geht, sind sie plötzlich für zentrale Planwirtschaft, mit dem Chef als kleinen Stalin, der sagt, wo es langgeht.
Historisch ist das Nachdenken über die gute Arbeit relativ neu, denn früher war Arbeit sowieso etwas, das kein vernünftiger Mensch freiwillig getan hätte. Wer arbeiten musste, war ein armer Schlucker, dem nichts anderes übrigblieb. Der Gedanke, dass die Arbeit einen positiven Wert haben könnte, kam erst mit der Neuzeit und dem Bürgertum auf. Die arbeitenden Klassen übernahmen dieses Paradigma, das um Fleiß, Tätigsein, aber auch Selbstverbesserung und die Entwicklung von Fertigkeiten kreiste. Der Stolz des Handwerkers auf sein Können vererbte sich dem modernen Facharbeiter und den Angestelltenmilieus.
Erst dieses positive Bild von der Arbeit motivierte eine Kritik, die darauf abzielte, dass die Wirklichkeit der Arbeit nicht den hehren Ansprüchen entsprach. Man denke nur an die Kritik von Karl Marx über die "entfremdete Arbeit" oder an den beklagten Autonomieverlust unselbstständiger Arbeitnehmer oder eben die Kritik, dass ein demokratiefreier Raum keine Schule der Demokratie ist, ja, dass er eigentlich mit Demokratie unvereinbar ist.
Axel Honneth hält letztere Spielart der Arbeitskritik für die produktivste. In verschiedenen Abschnitten seiner Studie widmet sich Honneth den grundsätzlichen Quellen der Kritik, den sich wandelnden Wirklichkeiten der Arbeitswelt in den vergangenen 200 Jahren, um am Schluss über mögliche Neuorganisationen der gesellschaftlichen Arbeit nachzudenken. Mehr Mitbestimmung, mehr kooperative Arbeitsformen, völlig neue Logiken auf den Arbeitsmärkten - warum sollte das nicht realistisch sein? Weil man uns seit 40 Jahren einredet, dass jede kleinste Änderung am Status quo "unrealistisch" sei? Wohin diese Ideologie führt, wissen wir mittlerweile zur Genüge.