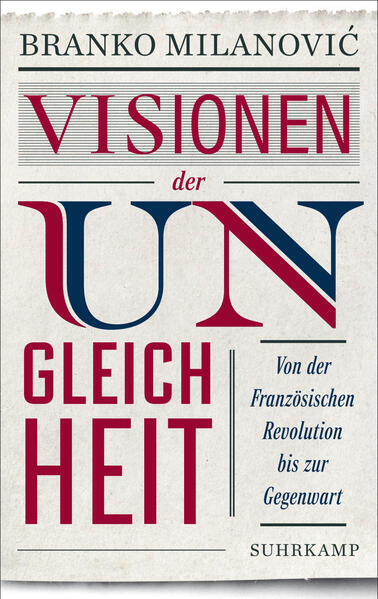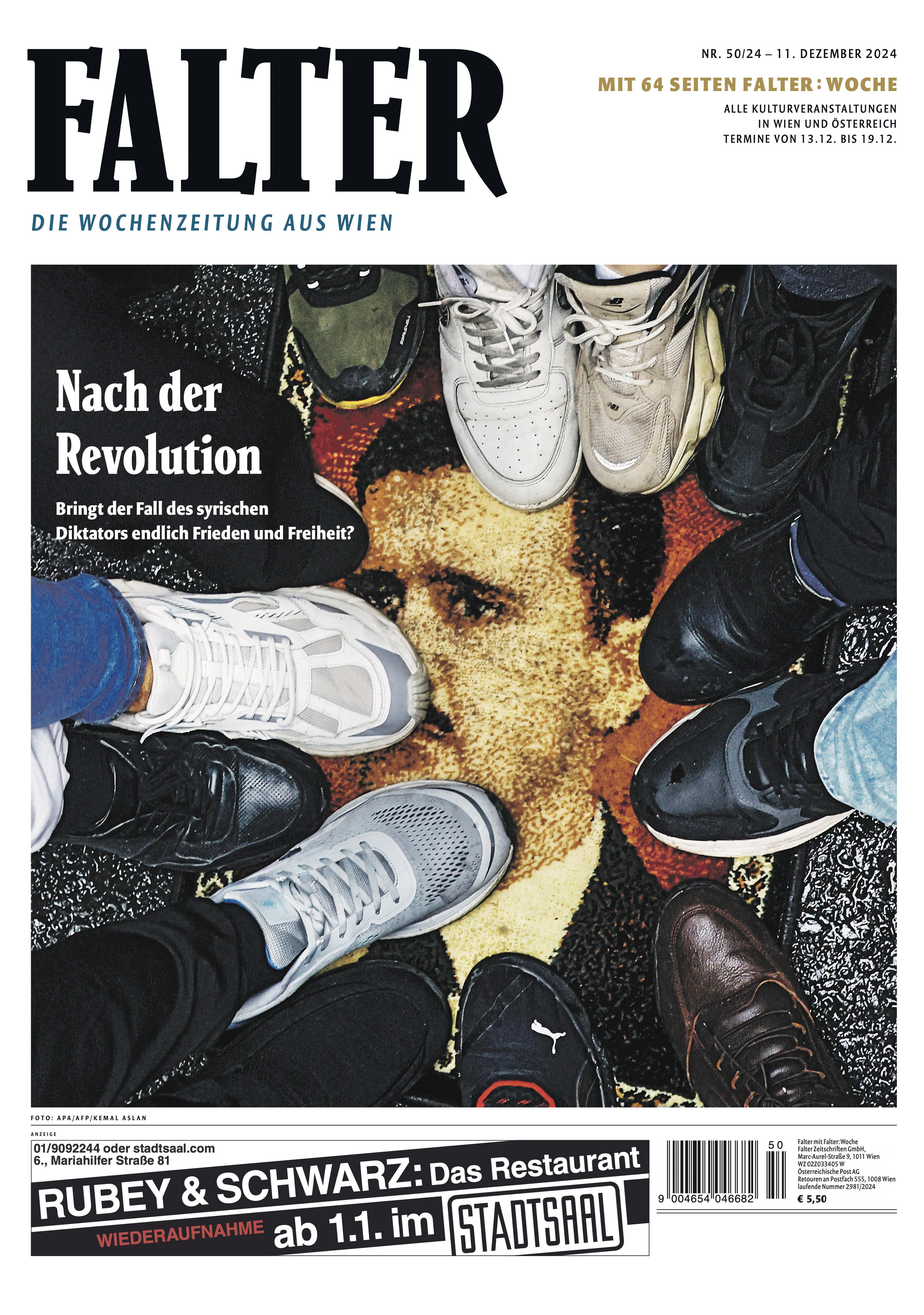
Als Ungleichheit noch als etwas Gottgegebenes galt
Andreas Sator in FALTER 50/2024 vom 11.12.2024 (S. 24)
David Ricardo, der wohl reichste Ökonom aller Zeiten, lehnte das allgemeine Wahlrecht ab. Karl Marx, Spross einer Familie aus den oberen fünf Prozent in Trier, wurde zum schärfsten Kritiker des Kapitalismus. Und Adam Smith, Vater der modernen Ökonomie, hatte für arme Menschen den wertvollen Rat: Sie sollten sich einfach mit der Armut abfinden, denn erstens sei das Gottes Wille und zweitens mache Materielles sowieso nicht glücklich.
Der Ökonom Branko Milanović wirft in seinem neuen Buch "Visionen der Ungleichheit" Licht auf die Zeit und das Milieu, in dem die großen Wirtschaftsdenker der vergangenen zwei Jahrhunderte ihre Sicht auf die Welt und auf die Unterschiede zwischen Arm und Reich formten - und wie sie uns damit bis heute prägen.
Ungleichheit hoch, aber stabil Als Smith 1776 sein epochales Werk "Der Wohlstand der Nationen" schrieb, verdienten Grundeigentümer im Schnitt das 33-Fache eines Arbeiters, Kapitalisten nur elf Mal so viel. Die Ungleichheit, die Smith kaum beschäftigte, war hoch, aber stabil. Das sollte sich ändern. In den folgenden vierzig Jahren stieg sie massiv an. Kapitalisten überholten die Grundbesitzer. Als Marx "Das Kapital" veröffentlichte, besaß das reichste eine Prozent in Großbritannien bereits sechzig Prozent des Vermögens -heute sind es zwanzig Prozent. In den USA übrigens 35 Prozent.
Milanović zeigt meisterhaft, wie diese gesellschaftlichen Umbrüche das ökonomische Denken formten. Revolutionär war bei Adam Smith, dass er den Wohlstand eines Landes am Wohlergehen der Arbeiterschaft maß - nicht wie die Merkantilisten zuvor an der Elite.
Smith selbst lebte bescheiden. Anders etwa David Ricardo, selbst ein erfolgreicher Börsenspekulant, dessen Vermögen dem Jahreslohn von 14.000 Facharbeitern entsprach - heute wären das 350 Millionen Pfund. Interessant ist bei allen dreien, dass sie den Begriff "Ungleichheit", wie wir ihn heute verwenden, nicht kannten. Sie dachten in Klassen, nicht in Individuen.
Dieser Paradigmenwechsel kam erst mit Vilfredo Pareto und der Einführung von direkten Steuern auf das Einkommen der Menschen. Damit verbesserte sich die Datenlage und man konnte sich ausrechnen, wie viel das oberste Prozent besaß. Pareto sah in der Verteilung des Wohlstands ein Naturgesetz, bestimmt durch die Fähigkeiten der Menschen. Ebenfalls prägend: die Arbeiten von Simon Kuznets. In den USA der Nachkriegszeit beobachtete er, wie die Ungleichheit kontinuierlich sank. Seine daraus abgeleitete Theorie - Ungleichheit steige mit der Entwicklung eines Landes erst an und falle dann wieder -prägte jahrzehntelang das Denken. Bis die Realität sie ab den 1980er-Jahren widerlegte.
Mit dem Koch durchgebrannt Milanović, selbst einer der führenden Ungleichheitsforscher unserer Zeit, gelingt mehr als eine Geschichte des ökonomischen Denkens. Er zeigt auch, dass die brillantesten Theoretiker Kinder ihrer Zeit waren. Es wäre lohnend, auch heute weiter über Verteilung zu streiten.
Der einzige Wermutstropfen: Das Buch verliert sich in biografischen Details. Dass Paretos Frau mit dem Koch durchbrannte, ist eine nette Anekdote -mehr nicht. Straffer editiert wäre "Visionen der Ungleichheit" noch stärker. Dennoch: Wer verstehen will, warum wir heute so über Ungleichheit diskutieren, wie wir es tun, findet hier die historischen Wurzeln. Ökonomische Feinschmecker werden es lieben.