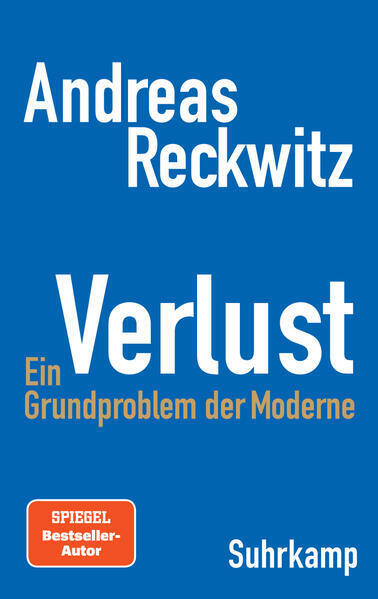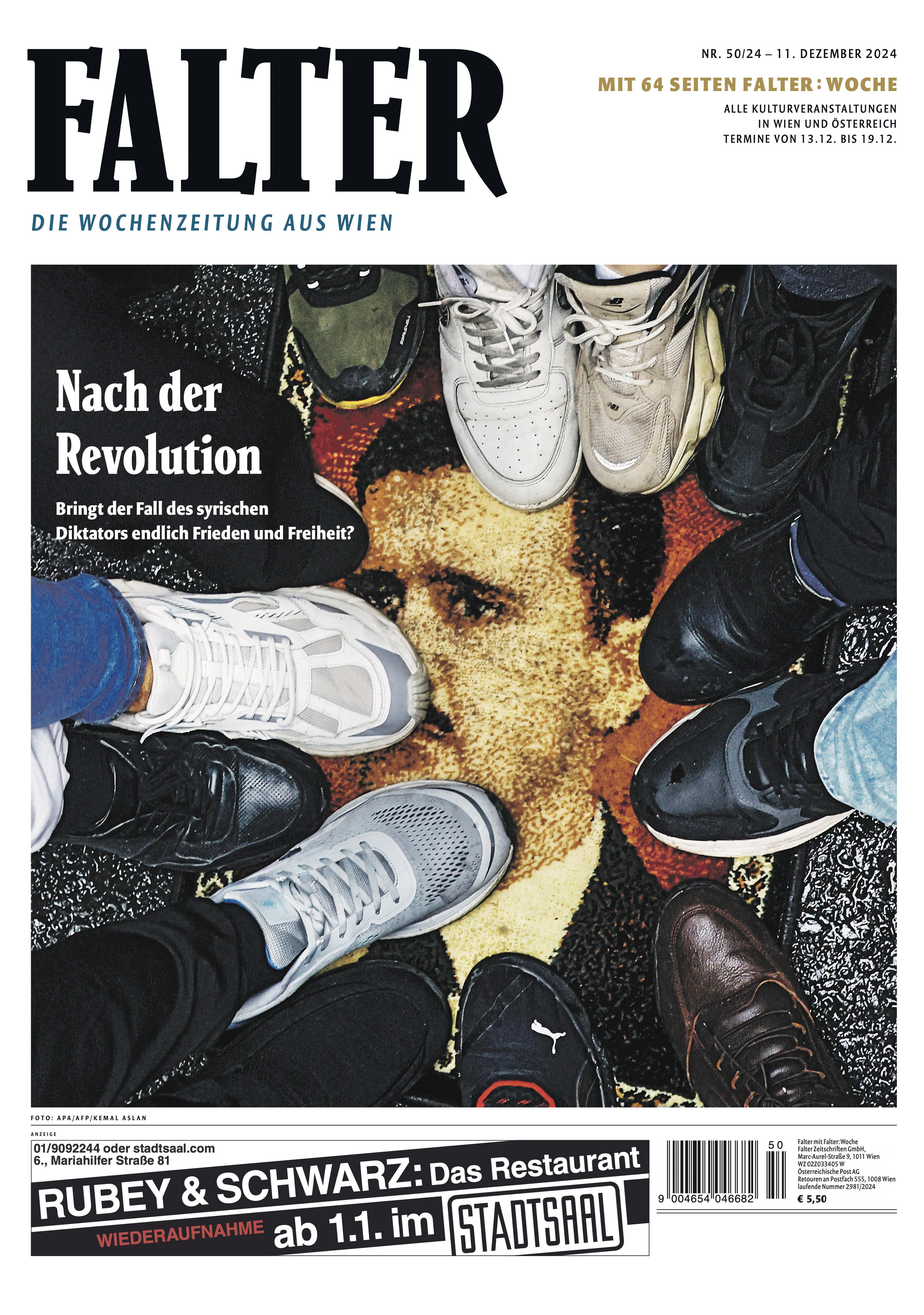
"Wer mehr erwartet, hat auch mehr zu verlieren"
Klaus Nüchtern in FALTER 50/2024 vom 11.12.2024 (S. 29)
Eines muss man Deutschland zugestehen: Es ist ein diskursfreudiges Land. Gerade wenn es wieder einmal von Krisen und Selbstzweifel gebeutelt wird, liefern seine Dichter und Denker verlässlich "Stichworte zur geistigen Situation der Zeit"(so der Titel zweier 1979 von Jürgen Habermas herausgegebenen Edition-Suhrkamp-Bände). Philosophen, Soziologen, Politologen oder Medienwissenschaftler stellen als public intellectuals Diagnosen, die nicht nur ein Fachpublikum erreichen. Schlagworte wie jene von der "Müdigkeitsgesellschaft", von "Bildungspanik","Großer Gereiztheit" oder "Gekränkter Freiheit" bringen komplexe Analysen auf griffige Formeln, die Eingang finden in Leitartikel, Talk-Runden und Wirtshauskonversationen.
Zu den Wissenschaftlern, die eine zeitdiagnostisch interessierte Öffentlichkeit seit Jahren mit Stoff versorgen, zählt auch Andreas Reckwitz. Und das, obwohl der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrende Soziologe nicht eben Popstar-Allüren pflegt und seine Bücher in einem akademischen Stil verfasst. Sein besonderes Augenmerk gilt der von ihm als "Spätmoderne" bezeichneten Ära, die im Laufe der 1970erund 1980er-Jahre auf eine Periode folgt, in der Wirtschafts-und Bevölkerungswachstum, Wohlfahrtsstaat, Bildungsboom und Konsumismus Wohlstand für alle und für immer verhießen.
In "Gesellschaft der Singularitäten" (2017) beschreibt Reckwitz, wie der kulturelle Kapitalismus eine "soziale Logik der Singularisierung" generiert, die Menschen dem Druck aussetzt, nicht bloß ökonomisch erfolgreich zu sein, sondern sich als einzigartige Individuen zu beweisen und ein geglücktes Leben zu führen. Dass ein solches heute für sehr viele nicht in Sicht ist, produziert Enttäuschungen, deren Ursachen, Folgen und Potenziale Reckwitz in seinem jüngsten Buch "Verlust. Ein Grundproblem der Moderne" analysiert. Im Fokus stehen dabei die Diskurse und Praktiken, die eine Gesellschaft hervorbringt, um mit diesen Verlusten umzugehen (Reckwitz verwendet dafür die englische Formel "doing loss"), und die vom Unsichtbarmachen bis zur Einübung in Resilienz reichen können.
Falter: Herr Reckwitz, sind Sie je Motorrad gefahren? Andreas Reckwitz: Nein.
Fahrrad aber schon? Reckwitz: Natürlich.
Können Sie sich an die Marke Ihres ersten Fahrrades erinnern? Reckwitz: Nein.
In Österreich steht der Zweiradproduzent KTM, ein Traditionsbetrieb, vor der Insolvenz, 4000 Arbeitsplätze sind gefährdet.
Reckwitz: Solche Verluste durch ökonomischen Strukturwandel hat es in der Moderne immer gegeben. Gerade der permanente Überbietungsprozess hat dazu geführt, dass Branchen auch verschwinden. Allerdings gibt es heute kein glaubhaftes Fortschrittsversprechen mit Aussicht auf Besserung mehr. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten schon bei den Deindustrialisierungsschüben in den USA, in Nordfrankreich oder Ostdeutschland gesehen.
Auch Menschen, die nicht von Arbeitsplatzverlusten betroffen sind, erleben momentan eine Art Verlust: "Mein erstes Fahrrad war ein KTM, jetzt gibt es die Marke bald nicht mehr."
Reckwitz: Verluste liegen ja nie objektiv vor, sondern sind abhängig von der subjektiven Wahrnehmung. Und gerade wenn eine Marke verschwindet, mit der man sich identifiziert hat, ruft das ein nostalgisches Verlustgefühl hervor. Das ist auch die Kehrseite des Singularisierungsprozesses, wie er für die spätmoderne Gegenwart typisch ist: Wenn man bestimmte Dinge als einzigartig empfindet, dann sind die nur schwer ersetzbar. In Berlin gibt es bereits eine Nostalgie im Hinblick auf das Berlin der 1990er-oder Nullerjahre: Die Stadt ist voller und teurer geworden, und die experimentellen Freiräume sind verschwunden.
Das ist aber kein ganz neues Phänomen?
Reckwitz: Nein. Die Moderne hat generell ein Problem mit Verlusten, die doch Teil des Menschseins sind. Warum? Weil im Kern dieser Gesellschaft ein Fortschrittsversprechen steckt: Die Zukunft wird besser sein als die Gegenwart, und die Gegenwart ist besser als die Vergangenheit. Das bedeutet jedoch: Da passen Verlusterfahrungen, die ja von einem Mangel und einer empfundenen Verschlechterung herrühren und erlitten werden, eigentlich nicht hinein. Die Moderne wiederum reagiert darauf mit unterschiedlichen Strategien, die vom Unsichtbarmachen der Opfer über politischen Konservatismus bis hin zu diversen Therapieformen und den Resilienzdiskursen der Gegenwart reichen.
Sie setzen den Beginn der Moderne vor 250 Jahren an. Damals erschienen unter anderen Goethes "Werther"(1774) und Adam Smiths "Der Wohlstand der Nationen" (1776). Zwei exemplarische Bücher?
Reckwitz: Ich verwende eine relativ konventionelle Datierung, die den Modernisierungsprozess mit Aufklärung, Industrialisierung und Demokratisierung beginnen lässt. Wobei diese gleichursprünglich mit der Kultur der Empfindsamkeit, des Sturm und Drang und der Romantik sind, für die auch der "Werther" steht. Der Roman artikuliert eine schmerzhafte Verlustempfindung und reagiert darauf mit einer Revolution des Gefühls, was damals noch ein Elitenphänomen war, mittlerweile aber eine viel größere Tragweite hat. Smiths "Wohlstand der Nationen" wiederum verweist eindeutig auf die in Aussicht gestellten Wohlstandsgewinne, die durch die kapitalistische Marktwirtschaft herbeigeführt werden sollen. Man erkennt an den beiden Büchern: Fortschrittsversprechen und Verlustsensibilität setzen historisch zur gleichen Zeit ein.
Sie schreiben über die Traumatisierung durch staatliche Gewalt im 20. Jahrhundert als ein Phänomen der Moderne. In der Frühen Neuzeit gab es aber auch Seuchen, Hungersnöte oder Kriege, die kaum weniger traumatisierend gewesen sein dürften.
Reckwitz: Zweifellos. Das Neue an der Moderne ist ihr Versprechen eines verlustfreien Fortschritts. Und diese euphorische Erwartung sickert in die Politik, die Ökonomie oder Wissenschaft ein. Zugleich bringt die Moderne eben über systematische staatliche Gewalt neue Verluste hervor. Nicht die Verluste an sich sind neu, sondern die Diskrepanz zwischen dem Fortschrittsversprechen und der Verlusterfahrung. Ihnen zufolge leben wir in der "Spätmoderne". Ich kann mich an Teach-ins mit dem ironischen Titel "Wie spät kann der Kapitalismus noch werden?" erinnern.
Reckwitz: Ich kann die Ironie nachvollziehen. Diese "Spät"-Begriffe suggerieren, dass es danach vorbei ist mit Kapitalismus oder Moderne. So meine ich das aber nicht. Es geht um eine Periodisierung: Es gibt die bürgerliche Moderne des 18. und 19. Jahrhunderts, die industriell entfaltete "organisierte" Moderne des 20. Jahrhunderts, die sich auch selbst als Gipfelpunkt verstand, und schließlich eine späte Version, in der wir jetzt leben. Ob danach noch eine andere kommt, ist offen.
Sie skizzieren drei mögliche Szenarien.
Reckwitz: Vertreter der sogenannten Kollapsologie wie Raphaël Stevens und Pablo Servigne gehen davon aus, dass die Moderne an ihren Widersprüchen zugrunde geht und darauf etwas ganz anderes folgt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die gegenteilige Ansicht besagt, dass wir nur eine vorübergehende Unterbrechung erleben und sich der Fortschrittsimperativ in zehn, 20 Jahren wieder etabliert; und das dritte Szenario wäre etwas, was ich "reparierte Moderne" nenne, also eine, die gar nicht versucht, bereits erreichte Fortschritte zu überbieten, sondern diese anzuerkennen und zu sichern, und dabei ein reflektiertes Verhältnis zu den Verlusten entwickelt.
Die klassische Fortschrittserzählung hat keinen Backlash vorgesehen?
Reckwitz: Die Soziologie kennt den Begriff des Sperrklinkeneffekts. Der bezeichnet die Vorstellung, dass es im Modernisierungsprozess keinen Rückfall hinter ein einmal erreichtes Level geben, sondern dass es nur gleich bleiben oder besser werden kann. Das ist aber doch zusehends als Illusion durchschaubar geworden. Wie man gesehen hat, sind die USA, die doch als die Wiege der Demokratie gelten, vor einer autoritären Wende nicht gefeit.
Ich bin noch Boomer, Sie sind schon Generation X: Wie brauchbar sind solche Pop-Kategorien für seriöse Soziologen?
Reckwitz: Man sollte solche Begriffe nicht überschätzen, die von den Medien ja auch genutzt werden, um Generationenkonflikte zu behaupten, die es in der Form gar nicht gibt. Vor allem sind die einzelnen Generationen in sich sehr heterogen. Wenn man vor ein paar Jahren schon von der "Generation Greta" (Thunberg) sprach, muss man dazu sagen, dass sehr viele Menschen dieser Alterskohorte überhaupt nicht sonderlich umweltbewusst sind. Nichtsdestotrotz gibt es schon generationenspezifische Erfahrungen, Erwartungen und Diskurse.
In meiner Schulzeit gab es sogar fortschrittlichen "Prog Rock", den späteren Gottseibeiuns der nihilistischen Punks. Reckwitz: Ja, Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre stand das Fortschrittsnarrativ bereits ziemlich unter Druck.
Was war denn Ihre Musik? Reckwitz: Ich habe einen eher nostalgischen Musikgeschmack: Bob Dylan und die Folkund Popmusik der Sixties.
In Ihrem Geburtsjahr 1970 sind Janis Joplin und Jimi Hendrix gestorben, und Apollo 13 hat 's nicht zum Mond geschafft. Da gab es nicht viel Grund für Fortschrittsoptimismus, oder?
Reckwitz: Nein. Bereits 1972 erscheint der Bericht des Club of Rome "Die Grenzen des Wachstums", ein Jahr später kommt es zur Ölkrise, und Anfang der 1980er konstatiert Habermas die "Erschöpfung der utopischen Energien". Das belegt eine Erosion des Fortschrittsnarrativs, die dann aber mit dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Kommunismus wieder überwunden schien. Aus heutiger Sicht erscheinen die 1990er-Jahre aber eher als ein euphorisches Intermezzo.
Das betrifft aber vor allem die großen gesellschaftlichen Erzählungen?
Reckwitz: Das betrifft die kollektiven Fortschrittserwartungen. Wohingegen die Fortschrittserwartungen der Individuen an ihr eigenes Leben seit den 1970ern massiv gestiegen sind. Nicht zufällig haben Sie die Popkultur angesprochen, die ganz stark auf individuelle Befreiung und Selbstverwirklichung abzielt. Just in der Zeit, in der die ökonomischen "Grenzen des Wachstums" aufgezeigt werden, kommt in der Psychologie der Begriff des "personal growth", also des persönlichen Wachstums auf. Eine interessante Paradoxie: Die gesellschaftlichen Fortschrittserwartungen brechen ein, aber die individuell-persönlichen werden forciert.
Ein anderer Widerspruch, den Sie aufzeigen, ist im Fortschrittsbegriff der Moderne selbst angelegt?
Reckwitz: Genau. Weil er Berechenbarkeit und Dynamik kombiniert: Der technische Fortschritt überbietet sich ständig selbst, aber die liberale Demokratie bleibt stabil. Die relativ schlichte Aussage "Den Kindern wird es besser gehen" enthält den Fortschrittsimperativ in der Nussschale. In den sogenannten Trente glorieuses zwischen 1945 und 1975 kam wirklich alles zusammen: technischer Fortschritt, Wirtschaftswachstum, sozialer Aufstieg, Bildungsexpansion Deren Schattenseite bestand allerdings darin, dass etwa die Traumatisierungen des Zweiten Weltkriegs unsichtbar gemacht wurden.
Eine Besonderheit der Trente glorieuses ist ein Moment des "Zum-ersten-und-zumletzten-Mal". Wie ist das zu verstehen?
Reckwitz: Man konnte zu dieser Zeit das Wirtschaftswachstum und den Konsum genießen, ohne sich der ökologischen Folgen bewusst zu sein; und in der demografischen Entwicklung hatten wir steigende Lebenserwartung und starke Geburtenraten. Die Trente glorieuses waren geprägt von einer sehr starken Jugendlichkeit.
Sie hingegen finden, dass die Moderne nach 250 Jahren auch mal "erwachsen" werden könnte. Was wäre darunter zu verstehen?
Reckwitz: Das ist nur eine Metapher, weil man auf Individuen bezogene Begriffe nicht ohne Weiteres auf die ganze Gesellschaft umlegen kann. Aber es würde bedeuten, mit Verlusten zu rechnen und die Verlusterfahrungen zu reflektieren.
Was die Sache hochbrisant macht, ist die politische Bewirtschaftung der Verluste?
Reckwitz: Ja. Die etablierte Politik lebt vom Versprechen einer besseren Zukunft, der Populismus hingegen knüpft ganz bewusst an existierende Verlusterfahrungen an -etwa der Deindustriealisierungsverlierer oder derjenigen, die infolge der Geschlechteremanzipation Macht einbüßen.
Da sind aber auch Phantomverluste dabei?
Reckwitz: Man könnte jetzt einwenden: "Das sind ja nur Erwartungen." Aber die Gesellschaft, ja selbst und gerade die Ökonomie lebt nun einmal von solchen: Aufgrund bestimmter Erwartungen investiert man oder nimmt Kredite auf. Erwartungen haben immer einen fiktionalen Aspekt, aber auch sehr reale Konsequenzen. Die Statusängste von Angehörigen der Mittelklasse, die vielleicht noch keine Verluste erlitten haben, solche aber für die Zukunft befürchten, werden vom Populismus aufgegriffen, in bestimmte Täter-Opfer-Narrative gepackt oder mit Retropien beantwortet -Stichwort "Make America Great Again".
Wobei individuelle Erfolge ihrerseits Verlusterfahrungen hervorbringen.
Reckwitz: Sie sprechen die sogenannte Erwartungsexpansion an. Die Moderne produziert -und das ist auch ein Effekt von Demokratisierung -in wachsenden Teilen der Bevölkerung immer neue Erwartungen auf einen sozialen Aufstieg oder gelingende Selbstverwirklichung. Die Kehrseite davon ist eine höhere Verlustaffinität: Wer mehr erwartet, hat auch mehr zu verlieren. Und gerade der Anspruch, ein singuläres, geglücktes Leben zu führen, kann nicht immer eingelöst werden.
Das wären dann quasi "Singularisierungsverlierer"?
Reckwitz: Könnte man so sagen. Wobei das immer auch eine Frage der Selbstwahrnehmung ist. Man kann nach außen ein sehr erfolgreiches Leben führen, es selber aber als Scheitern oder Sackgasse empfinden.
Auch hier setzt der Populismus an, nicht?
Reckwitz: Weil er mit Zuschreibung von Verlusten arbeitet und erklärt, wer daran schuld ist. Das ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal des Populismus. Die Frage, wer für Gewaltausübung und Unterdrückung in der Vergangenheit verantwortlich ist, wird auch in anderem Zusammenhang gestellt. Dass nicht nur Verlierer und Opfer identifiziert, sondern auch Täter zur Verantwortung gezogen werden, ist typisch für spätmoderne Diskurse. Ob das zu Restitution oder zu populistischen Rachefantasien führt, ist damit noch nicht ausgemacht.
Es gibt nicht nur Erwartungen an die Zukunft, sondern auch eine permanente Revision der Vergangenheit?
Reckwitz: Ein Moment der Verlusteskalation besteht eben darin, dass nicht nur die Verluste der Gegenwart sichtbarer werden, sondern auch die einer Vergangenheit, die schon Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zurückliegt. Das National Museum of African American History and Culture in Washington, das auch die Geschichte der Sklaverei breit darstellt, wurde erst 2016 eröffnet!
Ein Begriff, der im Zentrum der politischen Auseinandersetzungen steht, ist jener der Vulnerabilität.
Reckwitz: Die Sensibilität der Subjekte in der Spätmoderne ist gewachsen, was man ja positiv sehen kann. Allerdings erhöht sie auch die Vulnerabilität, und Verluste werden stärker als solche empfunden. Dass das zu einem Argument im politischen Diskurs wird, etwa bestimmte Redeweisen zu ändern, ist noch eine andere Sache. Zunächst einmal geht es um die Wahrnehmung von Vulnerabilität, auch der Gesellschaft selbst. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Dinge, die wir für robust gehalten haben, es gar nicht sind: etwa die liberale Demokratie, der Frieden in Europa oder auch die Lieferketten der weltumspannenden Ökonomie. Es ist also geradezu ein Akt der Klugheit, sich der Verletzlichkeit einer globalisierten Gesellschaft bewusst zu werden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Anders gesagt: Die Einsicht in die Schwäche kann selbst zu einer Stärke werden.