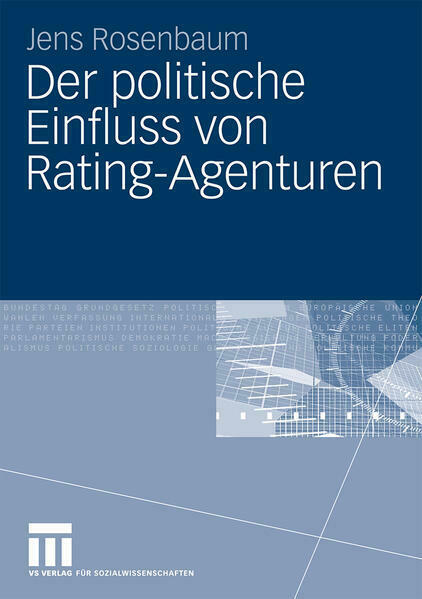Die Spuren der Agenturen
Wolfgang Zwander in FALTER 50/2011 vom 14.12.2011 (S. 10)
Ratingagenturen treiben die Politik vor sich her. Nun drohen sie auch Österreich. Wie arbeiten Moody's, Standard & Poor's und Fitch?
Stellt man sich die Welt dieser Tage als Kolosseum vor, wäre die Weltwirtschaft am ehesten mit einem Gladiatorenkampf zu vergleichen. Den Staaten kommt dabei die Rolle der kämpfenden Sklaven zu; das Publikum, zu dessen Gaudium das blutige Spektakel aufgeführt wird, sind die Investoren; den Part des Kaisers wiederum, der mit seinem gesenkten oder gehobenen Daumen über Sein oder Nichtsein entscheidet, den übernehmen die Ratingagenturen. Und das Volk, das vor den Toren der Arena wartet, muss es nolens volens ausgerechnet mit den Gladiatoren halten.
Zu den Regeln des todernsten Spiels gehört, dass derjenige Gladiator, der ohnehin schon besiegt am Boden liegt, nennen wir ihn zum Beispiel Portugal, Irland oder Griechenland, dass dieser unglückliche Verlierer am allerwenigsten auf die Gunst des Kaisers hoffen darf. Die einen nennen diese Gnadenlosigkeit Brutalität, die anderen sprechen vom Gesetz des Marktes. Der Kaiser aber sagt lapidar, er stehe nicht den Griechen, Iren oder Portugiesen im Wort, sondern nur dem johlenden Publikum vulgo dem Gewinn der Investoren. Der Cäsar wäscht, wenn man es so will, seinen mächtigen Daumen in Unschuld.
Der Vergleich mit der Sklavenhatz mag groß gewählt sein, wer aber zurzeit die öffentliche Debatte über Ratingagenturen verfolgt, kann nur den Eindruck gewinnen, dass ihre Macht an die von antiken Kaisern gemahnt. Die deutsche Wochenzeitung Die Zeit verglich die einflussreichen Unternehmen gar mit Gottheiten, die ihre Ratingblitze rätselhaft und rachsüchtig auf das verschwenderische Europa herabschleudern.
Aus der Beziehung zwischen Eurozone und den drei großen US-amerikansichen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's (S&P) und Fitch, die zusammen 95 Prozent des globalen Marktes beherrschen, so viel lässt sich sicher sagen, wird keine Freundschaft mehr. Ausgerechnet drei Tage vor dem jüngsten Brüsseler Gipfel am 8. und 9. Dezember, auf dem die europäischen Staatschefs einmal mehr die EU retten mussten, stellte S&P in Aussicht, die Kreditwürdigkeit von 15 Eurostaaten herabzustufen. Darunter auch Österreich, Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande, also die sechs Staaten, die bislang mit dem Adelsprädikat Triple-A, der besten Bonitätsnote, versehen waren. Haben die Ratingagenturen Europa den Krieg erklärt?
Der New York Times-Starkolumnist und mehrfache Pulitzerpreisträger Thomas Friedman schrieb bereits 1996, dass es in der Welt nur noch zwei Supermächte gebe, die USA und Moody's: "Die einen können dich zerstören, indem sie Bomben abwerfen, und Moody's kann dich zerstören, indem es deine Anleihen herabstuft." Und, so lautete Friedmans Nachsatz, es ist keinesfalls ausgemacht, wer von den beiden mächtiger ist.
Spätestens an diesem Punkt stellen sich Fragen wie: Wer sind "die Ratingagenturen"? Wie funktionieren sie? Warum können sie das einst so stolze Europa, immerhin die Wiege des Kapitalismus, ins Wanken bringen? Und – vielleicht am wichtigsten – gibt es Alternativen zu ihnen?
Wer sich an die Fersen der Analysten von Moody's, S&P und Fitch heftet, findet sich plötzlich wieder in einer Welt, in der die Gesetze von Raum und Zeit aufgehoben scheinen, stattdessen gelten die Regeln der flüchtigen Allgegenwart von Information. Hier herrschen nicht Cäsaren, sondern Buchhalter. Sie regieren mit Mobiltelefon und Laptop, ihre stärksten Waffen heißen "Upgrading" und "Downgrading" und die Infrastruktur ihrer Macht besteht aus Datenströmen und Tiefseeverkabelungen, Satelliten und Lichtwellenleitern.
Die Schauplätze, wo man fern des Büros auf einen Analysten treffen könnte, sind der Flughafen und der Bahnhof. Der Falter erreicht Mitarbeiter der Agenturen im Taxi in London, im Schnellzug nach Frankfurt, oder gar nicht, weil sie im Flugzeug nach New York sitzen. Die Hauptquartiere der Unternehmen befinden sich in den Citys der großen Finanzmetropolen in verspiegelten Glaspalästen, deren Baustil sich vielleicht am besten mit neoliberaler Machtarchitektur beschreiben lässt.
Tag und Nacht schießen aus den großen Presseagenturen der Welt die Meldungen, in denen Moody's, S&P und Fitch zum Sparen ermahnen und ihren Kunden damit drohen, ihnen einen Buchstaben, ein A, B, C oder gar ein D wegzunehmen, was einen Verlust von Kreditwürdigkeit bedeuten würde. Sie verteilen Lob für Einsparungen, Schuldenbremsen und Nulldefizite, sie vergeben Tadel für hohe Lohnkosten und Sozialleistungen. Bei den Kunden kann es sich um Versicherungen und Banken handeln, oder um Kommunen und Staaten, wie zum Beispiel Österreich.
Die Republik lässt sich zurzeit sowohl von den drei großen US-amerikanischen Unternehmen bewerten, als auch von drei kleinen namen DBRS, Sustainalytics und Oekom Research. Insgesamt entstehen dem Steuerzahler daraus Kosten von rund 550.000 Euro pro Jahr, der Bewertungsprozess vollzieht sich nämlich auf eigene Rechnung. In der Außenkommunikation verstehen sich Ratingagenturen als Dienstleister, die lediglich einen Service anbieten, der auf den Finanzmärkten stark nachgefragt wird.
Wer versucht nachzuvollziehen, wie dieser Service funktioniert, der erhält wenige Antworten und keine Termine. Oder zumindest keine, über die man schreiben darf. Die Länderchefs der Unternehmen bieten handverlesenen Journalisten Hintergrundgespräche an, lassen aber vorher oft per Vertrag festlegen, dass vom Inhalt der Unterhaltung nichts bekannt werden darf. "Öffentlichkeitsarbeit" nennt sich das in der Welt von Moody's, S&P und Fitch.
Wenn die Analysten der Unternehmen nach Österreich kommen, um die Bonität der Republik zu überprüfen, treffen sie hier auf vier Gruppen von Ansprechpartnern. Die Regierung, die im Finanzministerium das Budget verwaltet; die Nationalbank, die die finanzielle Solidität der nationalen Geldinstitute überwacht; die Bundesfinanzierungsagentur, die die Zahlungen des Landes abwickelt; und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die die Konjunkturentwicklung überblicken.
Pro großer Ratingagentur kümmern sich um ein Land wie Österreich zwei Mitarbeiter, die gegebenenfalls auch auf einen Expertenstab zurückgreifen können. Das Zweierteam besteht aus einem Senior- und einem Junioranalyst, die beide jeweils im Schnitt sieben bis acht weitere Staaten betreuen. Ihr Job verlangt ein Anforderungsprofil, das einer Mischung aus Detektiv und Buchhalter entspricht. Sie sitzen in der Regel in London, konsumieren Österreichs Qualitätsmedien, lesen den dicken Bericht des Staatsschuldenausschusses und so gut wie alle Veröffentlichungen der Nationalbank und des Finanzministeriums.
Die Analysten treffen gut informierte Personen zu Hintergrundgesprächen, telefonieren regelmäßig mit Wirtschaftswissenschaftlern und haben immer die aktuelle Konjunkturerwartung im Blick. Mindestens einmal im Jahr kommen sie, vollgesaugt mit Informationen, offiziell angemeldet im Doppelpack nach Wien, um ihre österreichischen Ansprechpartner im persönlichen Gespräch zu "grillen", wie es in der Branche genannt wird. Soll heißen, wie man unter der Hand erfährt, dass sie versuchen, sich in verhörartigen Gesprächen davon zu überzeugen, ob die ihnen zugänglich gemachten Datenmassen auch der Wirklichkeit entsprechen.
Über den Inhalt der Gespräche ist Geheimhaltung vereinbart. Wer im Finanzministerium anruft, um mit dem für den Kontakt mit den Ratingagenturen zuständigen Budgetsektionschef Gerhard Steger zu sprechen, wird von seinem Pressesprecher abgewimmelt. Es gebe keine Auskunft zu Ratingagenturen, man sei nicht die "Recherchezentrale der Medien". Als der Sektionschef dann doch zurückruft, sagt er nur, dass er nichts sagen könne und keine Zeit für ein Treffen habe, meint dann aber doch, dass "so lange sich die Märkte nach den Ratingagenturen richten, diese sehr mächtig sind". Die Bundesfinanzierungsagentur schreibt, dass sie zu "strengster Vertraulichkeit verpflichtet" sei, der Pressesprecher der Nationalbank will überhaupt keine Informationen weitergeben, und Bernhard Felderer, Präsident des Staatsschuldenausschusses, Leiter des Instituts für Höhere Studien und regelmäßiger Ansprechpartner für die Analysten der Ratingagenturen, sagt, die drei Ratingagenturen hätten an politischem Einfluss gewonnen, weil sie so groß geworden seien.
Felderer war es auch, der vor drei Wochen für Aufsehen sorgte, weil er öffentlich warnte, dass Österreich seinen Triple-A-Status verlieren könnte. Die Risikoaufschläge für heimische Staatsanleihen wurden im vergangenen November immer größer. Die Analysten sollen laut Informationen aus dem Bundeskanzleramt mehrmals in Wien nachgefragt haben, was die Bundesregierung plane, um den Verfall zu stoppen, woraufhin diese, nervös geworden, die deutsche Idee der Schuldenbremse kopierte.
Beim folgenden EU-Gipfel beschlossen die Chefs der 17 Euroländer, dass sie bis März kommenden Jahres einen Vertrag für nationale Schuldenbremsen und mehr Haushaltsdisziplin unterzeichnen werden. SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann und sein ÖVP-Vize Michael Spindelegger müssen nun hoffen, dass die Opposition doch noch einer Schuldenbremse in Verfassungsrang zustimmt. Was könnte andernfalls passieren?
Die Republik wird im Jahr 2012 rund 30 Milliarden Euro aufnehmen müssen, um all ihre finanziellen Pflichten erfüllen zu können. Wenn das Land sein Triple-A verliert, werden die Kredite teurer, woraufhin noch mehr Schulden gemacht werden müssen, um sie bedienen zu können, was tendenziell zu einer neuerlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit führt.
Ökonomen sagen dazu "negative Feedback-Loop", der Volksmund nennt das Teufelskreis. Dem solide aufgestellten Österreich würde ein "Downgrading" noch keinen Bankrott bringen, für die bereits am Boden liegenden Griechen oder Portugiesen würde ein weiterer Bonitätsverlust aber vermutlich das Gleiche bedeuten, um im Bild zu bleiben, wie für den besiegten römischen Gladiator der gesenkte Daumen des Kaisers. Der Tod durch fremde Hand.
Es gibt noch einen zweiten Teufelskreis, unter dem die Politik aktuell zu leiden hat. Ein guter Teil der Haushaltsdefizite, die nun von den Ratingagenturen als Grund für das "Downgrading" Europas angeführt wird, ist entstanden, weil die EU-Staaten zu Beginn der Finanzkrise die Banken vor dem Kollaps retten mussten. Laut einer Untersuchung des US-Kongresses haben Moody's, S&P und Fitch eine "erhebliche Mitschuld" an der Finanzkrise, weil sie Schrottpapiere von Multis wie AIG und Enron mit einer Topbonität ausgestattet haben. Die Finanzindustrie hat dieses Fiasko Milliarden Euro gekostet, die letztlich meist vom Staat refinanziert worden sind. Aus Sicht der Rating-
agenturen, die im Besitz von Banken und Finanzmogulen sind, war das wahrscheinlich ein "positive Feedback-Loop".
Neben diesem aus Sicht der Steuerzahler unschönen Bild steht noch der in US-Medien erhobene schwere Vorwurf, dass die drei Ratingriesen in der Vergangenheit diejenigen Papiere am besten bewertet hätten, mit denen sie selbst am meisten Umsatz gemacht haben. Hinzu kommt, dass S&P erst im vergangenen November, mitten in der Eurokrise, Frankreich mit einer fahrlässig falschen Herabstufung ins Taumeln gebracht hat, was in Paris und Brüssel auch noch nicht vergessen ist.
Oder doch? Man könnte zumindest diesen Eindruck gewinnen. Bereits 2008, direkt nach dem Ausbruch der Krise, haben Europas führende Politiker lauthals versichert, nun gehe es der Macht von Moody's, S&P und Fitch an den Kragen. Was ist passiert? Außer weiteren Forderungen nach mehr Haftung, Unabhängigkeit, Transparenz und Wettbewerb bislang nur sehr wenig. Noch immer gilt hingegen die auf die Eigenkapitalvorschrift Basel II zurückgehende Regelung, dass Versicherungen, Banken und Fonds gewisse Papiere und Anleihen abstoßen müssen, sobald sie von Moody's, S&P oder Fitch herabgestuft werden. Andernfalls würden sich die Manager der Firmen sogar strafbar machen.
So lange die EU nichts unternimmt, dass solche Regeln verändert werden, kann ein versuchter Spartacus-Aufstand der EU-Politiker gar nicht anders enden, als – um ein letztes unschönes Bild zu bedienen – in einem blutigen Gemetzel.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: