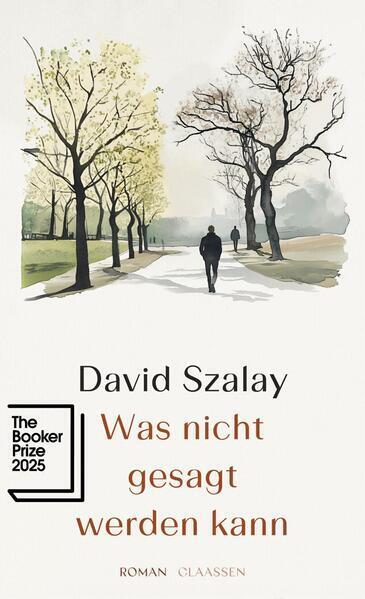Der Männerromancier
Lina Paulitsch in FALTER 52/2025 vom 24.12.2025 (S. )
David Szalay spricht so wie die meisten Menschen. Mit Füllwörtern, Gedankenpausen und Gegenfragen. Er antwortet zögerlich, nicht unfreundlich, aber ausweichend. Und sagt immer wieder: "I don't know" - "Ich weiß nicht".
"Ich weiß nicht" gehört auch zu den häufigen Sätzen von Szalays Protagonisten István. Noch öfter antwortet er mit "Okay". István findet es okay, wenn seine Arbeitgeberin ihm sagt, dass er sie heißmache. Oder wenn ihn seine Geliebte verlässt. Okay, das bedeutet alles und nichts. Zustimmung mit Schulterzucken. Hinter Okay kann sich ein tiefer Abgrund auftun.
Die diesjährige Jury des Booker Prize, des wichtigsten britischen Literaturpreises, hat Szalays knappe Prosa überzeugt. Sein Buch "Was nicht gesagt werden kann" erzählt das Leben von István, der in einem ungarischen Plattenbau aufwächst und später in die Londoner Upperclass aufsteigt. Niemand habe je etwas Vergleichbares geschrieben, schwärmte Juror und Autor Roddy Doyle: "Es ist außergewöhnlich, wie Szalay Leerräume nutzt." Königin Camilla überreichte die Sieger-Statuette.
Wenige Wochen später trifft Szalay den Falter zum Gespräch. Es ist ein vernebelter Dezembertag, das kleine Café im dritten Bezirk, in dem das Interview stattfindet, brechend voll. Szalay, 51, wohnt gleich nebenan, mit seiner Frau und einem gemeinsamen kleinen Kind. "Auch nach zwei Jahren fühle ich mich noch ein bisschen wie ein Tourist", erklärt er und lässt sich nicht zu Wien-Floskeln hinreißen. "Ich habe einen Jahrespass fürs Kunsthistorische und gehe da oft hin." Sonst kenne er die Stadt noch nicht so gut.
Szalays Vater ist Ungar, er floh 1968 von Pécs nach Wien. Dort blieb er ein Jahr und zog weiter nach Kanada, wo er Szalays Mutter kennenlernte. Aufgewachsen ist der Schriftsteller in London. Nach der Schule studierte er in Oxford Literatur. Szalay wirkt so, wie man sich einen Briten vorstellt: reserviert, höflich, manchmal ironisch.
Schon einmal, 2016, stand der Autor auf der Shortlist des Booker Prize. Wie sein damaliges Buch "Was ein Mann ist" wird auch sein aktueller Roman als Studie zur Männlichkeit rezipiert. Die Literaturkritik jubilierte unisono, der Taz-Rezensent sprach von einer "Dekonstruktion des Männerromans". Superstar Dua Lipa lud in ihren Buchclub und brachte ihm poppige Prominenz.
Rechte Politiker würden den Protagonisten István wohl als traditionellen, Frauen unter 30 eher als toxischen Typen bezeichnen. Er ist triebgesteuert, arbeitet als Security in einem Stripclub, haut seinem Stiefsohn eine rein und liest Management-Ratgeber. Keine poetische, sondern eine radikal realistische Figur, die in der aktuellen Literatur nur selten eine Bühne bekommt. Wenn er jetzt, nach der Lektüre, an Türstehern eines Clubs vorbeigehe, sagte BookerJuror Doyle, habe er das Gefühl, deren Lebenswelt besser zu kennen.
Die Erzählung beginnt mit einem harten Aufschlag: Die wesentlich ältere, über 40-jährige Nachbarin verführt den zu Beginn 15-Jährigen. Sie küsst ihn, was István zwar ekelt, aber auch erregt. Als sie sich entschuldigt, versteht er nicht, wieso: War er nicht selbst an diesem Kuss, den er nicht wollte und doch wollte, beteiligt?
Ja, heute würde man diese Beziehung als missbräuchlich bezeichnen, antwortet Szalay auf Nachfrage. Er verwende den Begriff nirgends, um die Leser selbst zu diesem Urteil kommen zu lassen. "Literarisch war die Situation interessant, weil Ambiguität, auch Schockierendes und Verstörendes, in ihr steckt." In der Realität könnten junge Opfer häufig nicht benennen, dass sie missbraucht werden. Es fehlt ihnen die Fähigkeit, zwischen eigenen und fremden Wünschen zu unterscheiden. Diese ambivalente Stimmung, die Machtmissbrauch oft ermöglicht, fängt Szalay vortrefflich ein.
Wegen Totschlags muss István mehrere Jahre ins Jugendgefängnis. Danach weiß er nicht so recht, wohin mit sich. Es sind die 2000er-Jahre, er geht zur Armee und landet im Irak. Die Handlung setzt danach wieder ein, als István nach London zieht. Durch Zufall fängt er bei einer privaten Securityfirma an, wo ihn ein superreiches Paar als Fahrer abwirbt. Dank einer Affäre mit der Ehefrau ist er nach dem Tod des Gatten plötzlich selbst superreich: Landhaus, Tennis, Swimmingpool.
Im Original trägt der Roman den Titel "Flesh". Gemeint ist damit Fleisch nicht im zu verzehrenden, sondern im organischen Sinn. Er habe eine Figur entwerfen wollen, die eins sei mit ihrem Körper, sagt Szalay, habe deren Leben als körperliche Erfahrung erzählen wollen.
István scheint alles zufällig zu passieren. Er folgt seinen Begierden, lässt sich treiben, passiv, bis ganz an die Spitze der sozialen Leiter, und sagt einfach "Okay".
"Es gibt einen Unterschied zwischen einer Reaktion und einer Entscheidung", erklärt Szalay und macht eine Pause. "Und ich glaube, dass unsere Leben viel mehr davon geleitet sind, wie wir reagieren -nicht, wie wir entscheiden. Das meiste passiert unbewusst." Der Autor gibt kaum Einblick in Motivationen oder Gedanken. Gefühle sind bei ihm äußere Zustände, die man beobachten kann. Szalays stilistischer Minimalismus setzt auf leise Andeutungen, die Spannung erzeugen.
"Ich wollte, dass sich der Charakter nicht erklärt", so der Autor. "Ich habe das Gefühl, wir alle kennen psychologische Analysen zur Genüge: in der Biografie der Menschen danach zu suchen, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Ich sage nicht, dass die Psychologie nicht recht hat. Aber dass es nicht so interessant ist, darüber zu schreiben."
Szalay läuft dabei nicht Gefahr, seine Figuren zu simplifizieren. So wird der Missbrauch, den István als 15-Jähriger erlebt, zwar nie wieder erwähnt -doch er wiederholt ähnliche Beziehungskonstellationen immer wieder. Traumatische Episoden, wie die Zeit im Gefängnis oder den Armeeeinsatz im Irak, streift Szalay nur kurz. Wie sie Istváns weiteres Handeln beeinflussen, ist trotzdem stringent erzählt.
Zwei Nationalitäten prägen Szalays Blick auf die Welt. Obwohl ihm der Vater kein Ungarisch beibrachte, lebte er in Pécs und Budapest. Aus ein paar Monaten wurden Jahre, er gründete eine Familie. Seine zweite Frau, eine deutsch-ungarische Dozentin, wollte irgendwann weg aus Ungarn.
Um nahe bei den Kindern aus erster Ehe in Budapest zu sein, entschieden sie sich für Wien. "Die politische Situation spielt auch eine Rolle. Nicht, weil man im Alltag keine Freiheiten mehr hat", sagt Szalay. "Aber ich finde die Atmosphäre in Ungarn seit einigen Jahren wütend und unangenehm."
In Interviews spricht der Schriftsteller nur selten über die Politik seiner zweiten Heimat. Er sei ja gar kein richtiger Ungar, beschwichtigt er. Als Welterklärer möchte Szalay nicht herhalten, das merkt man ihm an. Nächstes Jahr bei den Parlamentswahlen, sagt er knapp, werde er jedenfalls nicht Fidesz wählen.
Dabei ist sein großes Thema Männlichkeit für die ungarische Regierung wichtig. Premier Viktor Orbán inszeniert sich als starken Mann mit vielen Kindern, der auf Feminismus pfeift und Homosexuelle verachtet. Die traditionelle Familie - mit klar definierten Geschlechterrollen - ist Orbáns Heilsversprechen für eine gute Zukunft. Wohingegen der liberale und "queere" Westen in den Untergang steuere. "Es gibt einen Unterschied im männlichen Selbstbild in England und Ungarn", sagt Szalay, "und das Buch streift dieses Thema."
Als Debattenbeitrag im Kulturkampf verstand die Financial Times Szalays Roman. Anlässlich der Preisverleihung titelte sie: "The coup de grâce for woke" - der Gnadenschuss für Woke. Vor ein paar Jahren hätte ein Roman über einen "workingclass straight white man" keinen Booker
David Szalay wurde 1974 in Kanada geboren, er wuchs in London auf. Szalay studierte Literatur in Oxford und lebte ab 2008 in Pécs in Ungarn. Seine Bücher "Turbulence" und "All That Man Is" sind Kurzgeschichten, die für ihre verflochtene Erzählweise von der Kritik hochgelobt wurden. Sein Roman "Flesh" gewann 2025 den Booker Prize Prize bekommen, kommentierte Janan Ganesh. Die Auszeichnung stehe exemplarisch für den "Vibe shift" in der Gesellschaft, der dem progressiven Antidiskriminierungsfuror ein Ende bereite.
Szalay schüttelt den Kopf. "Mein Buch ist weder woke noch anti-woke", sagt er. "Ich möchte nicht in irgendeinen Diskurs hineinpassen. Und ich versuche, mich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen." In der Literatur betrifft Wokeness die Frage der Perspektive. Ob etwa Weiße über Schwarze dichten sollen oder damit nicht Machtverhältnisse reproduzieren. "Darüber sollten Autoren überhaupt nicht nachdenken", sagt Szalay, "sondern sich einfach der Welt, wie sie sie sehen, und der Realität der Welt, wie sie sie sehen, verschreiben."
Dass ihm die Ideen frei von diesen Diskussionen zufliegen, nimmt man ihm bei der Lektüre früherer Bücher nicht so recht ab. In "Turbulenzen", das 2018 erschien, schreibt Szalay aus der Perspektive verschiedener Menschen, die ein Flugzeug besteigen: eine schwarze Journalistin, eine weiße Autorin, eine Hongkonger Lehrerin.
Einige Themen scheinen kalkuliert. Szalay erzählt etwa von einem indischen Sklaven in Katar, der seine Frau schlägt. Von seiner Schwägerin als "toxisch männlich" bezeichnet, stellt er sich im nächsten Kapitel als heimlich schwul heraus. Ein ermüdender und irgendwie nerviger Twist. Andere Kapitel, vor allem in "Was ein Mann ist" von 2016, lesen sich wie Pornofantasien -nicht wie die von Szalay eingemahnte Realität.
Das prämierte Buch "Was nicht gesagt werden kann" fällt subtiler aus. Weibliche Charaktere sind plausibel, die männliche Lebensrealität scheint unheroisch und schmerzhaft. Jia Tolentino, Essayistin beim US-Magazin New Yorker, nannte es gar das Buch des Jahres zur viel besprochenen Krise der Männlichkeit. Während Frauen sich emanzipieren, fehlen modernen Männern die Vorbilder. Im Internet trenden hypermaskuline Influencer, im wahren Leben wollen Frauen keine Machos mehr. Junge Männer, so zeigt es die Statistik, schließen weniger oft die Uni ab - und sie lesen auch weniger.
In England hat die Sorge um die Leiden des jungen Mannes sogar zur Gründung eines eigenen Verlags geführt. Weil heute mehr Frauen Literatur publizieren, will der Brite Jude Cook nur mehr Autoren verlegen. Erzählungen einer modernen Männlichkeit, so Cooks Argument, blieben aktuell auf der Strecke. Zwar stimmt das nur so halb - Bücher von Männern sind in Medien viel präsenter. Aber im Internet, auf Tiktok, dominieren Autorinnen. Und deren riesige, global vernetzte Leserschaft ist weiblich.
Ja, es wäre gut, würden Männer mehr Literatur lesen, kommentiert Szalay. "Als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich aber keine Agenda zum Thema Männlichkeit verfolgen", fügt er hinzu. Und man fragt sich, was er gerade nicht sagt.