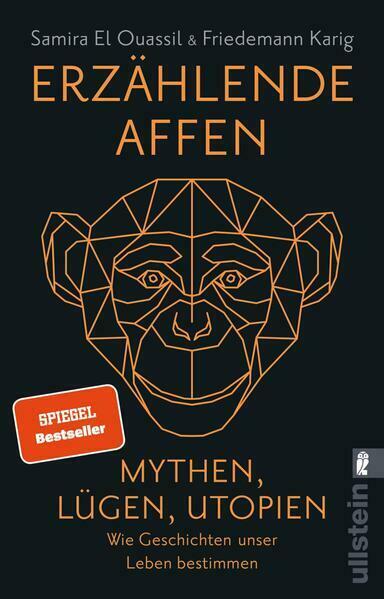in FALTER 26/2023 vom 28.06.2023 (S. 45)
Die Klimakrise sei eine Krise der Vorstellungskraft, meint der Anthropologe Amitav Ghosh. Nicht nur aufseiten der Politik, sondern auch in der Literatur. Karig und El Ouassil haben sich Gedanken über gängige Narrative gemacht, mit denen wir die Klimakrise oder Kriege erzählen. Etwa, dass der Kampf gegen den Klimawandel ein Aufbegehren gegen eine unberechenbare Natur sei -obwohl es konkrete Verursacher gebe: fossile Unternehmen.
Die unsichtbare Apokalypse
Katharina Kropshofer in FALTER 14/2023 vom 05.04.2023 (S. 24)
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ein Komet rast auf die Erde zu. Zwei Wissenschaftler warnen eindringlich, die Menschheit müsse und könne ihn aufhalten. Doch keiner hört auf die beiden.
Die apokalyptische Satire "Don't Look Up" des US-amerikanischen Filmemachers Adam McKay stieg 2021 zum Netflix-Hit auf. Kein Wunder: Egal wie platt die Metapher des unaufhaltbaren Kometen auch sein mag, fasst sie ein kollektives Gefühl gut zusammen. Wir stürzen in den Abgrund. Doch wenn es darum geht, etwas dagegen zu unternehmen, sind wir wie gelähmt.
Nicht weil wir im Unklaren darüber sind, was da auf uns zukommt. Ein Großteil der Wissenschaft ist sich darüber einig, was bei einer Erwärmung von mehr als 1,5 Grad bevorsteht. Dem UN-Generalsekretär António Guterres gehen langsam die Superlative aus: "Die Menschheit ist eine Massenvernichtungswaffe", sagte er auf einer Konferenz im Dezember.
Auch nicht, weil es an Lösungen mangelt. Wir kennen das Potenzial von Wind- und Solarenergie, wissen, dass wir den Verbrennungsmotor verbannen, den Fleischkonsum einschränken, unsere Küsten an den steigenden Meeresspiegel anpassen müssen.
Das eigentliche Problem ist, so formuliert es der indische Schriftsteller und Anthropologe Amitav Ghosh, eine Krise der Vorstellungskraft. Wir wollen etwas verändern, eine Zukunft ohne brennende Wälder und Kriege um Ressourcen. Doch der Weg dorthin bleibt neblig. Wir wollen verstehen, wie wir den Kollaps abwenden können. Doch die größte Krise der Menschheitsgeschichte ist "untererzählt": Die Gefahr angemessen darzustellen ist schwierig, an "postfossilen Narrativen" mangelt es.
Das zeigt sogar eine Studie der Organisation Good Energy. Die Forscher scannten 37.000 Drehbücher, die zwischen 2016 und 2020 veröffentlicht wurden, auf Stichwörter wie "Klimawandel", "Kohlendioxid" oder "Meeresspiegel". Lediglich 2,8 Prozent der Stoffe berücksichtigten den Themenkomplex, explizit erwähnt hatten den Klimawandel überhaupt nur 0,6 Prozent. Zum Vergleich: Der Begriff "Hund" kam 13-mal so häufig vor wie alle 36 Klimabegriffe zusammen.
Wollen wir die Klimakrise schlichtweg nicht erzählen, weil sie zu technisch ist -zu sehr Wissenschaftssprech? Oder doch zu langweilig, repetitiv, weil wir ohnehin alle wissen, wie schlecht es um die Welt steht?
Medienwissenschaftler haben eine andere Erklärung gefunden: Wir scheitern daran, den Sachverhalt in Plots zu gießen, die ihn auch emotional begreifbar machen. Allgegenwärtig und doch unsichtbar schreitet die Erderhitzung mit ihren Folgen voran, doch auf eine Landkarte zu zeigen und zu schreien: "Da ist sie!"- unmöglich. Der US-amerikanische Philosoph Timothy Morton nannte dieses Phänomen das "Hyperobjekt": Da wir selbst ein Teil der Klimakrise sind, können wir nur einzelne Aspekte begreifen. Sie ist wie ein Eisberg, der aus dem Wasser ragt, aber 90 Prozent seiner Masse unter der Oberfläche verbirgt.
Dabei hat gerade der Katastrophenfilm eine lange Tradition - nicht selten vor der Kulisse einer Natur, die sich stark verändert. In "The Day After Tomorrow"(2004) kämpft sich ein Held durch eine Welt, die durch den Klimawandel um einige Grad kühler geworden ist. Das Drehbuch impliziert: Das Ende der Welt ist nah, doch zum Glück gibt es noch Helden, die uns davor bewahren können. Oder es zumindest versuchen, wie im Falle von "Don't Look Up".
Eine Studie der Yale-Universität aus dem Jahr 2004 zeigte, dass Menschen sogar motivierter waren, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen, nachdem sie "The Day After Tomorrow" gesehen hatten. Der Effekt war aber rasch verpufft. Die reale Katastrophe passiert dann doch etwas weniger spektakulär als die fiktiven Wassermassen, die ganze Metropolen überfluten. Auch "Don't Look Up" führt zum Trugschluss: Wir werden alle sterben, aber keine Angst, es wird sehr schnell gehen.
Die kolossalen Bilder vom Ende der Welt sorgen für tolle Spezialeffekte, für reichlich Unterhaltung. Und kollidieren trotzdem oder eben erst recht mit der banalen Realität. Die vielen kleinen Apokalypsen der Gegenwart sind nicht so spektakulär wie der große Wumms auf der Leinwand.
Ressourcenvergeudung, eine wachsende Weltbevölkerung, Umweltverschmutzung kumuliert zu einer Metakrise, schreibt die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn, die an der Universität Wien forscht, in ihrem Buch "Zukunft als Katastrophe". Dass wir diese gewaltige Krise durch so Alltägliches wie Autofahren oder Schnitzelessen verschärfen, leuchtet nicht so leicht ein. Horn fordert also, die "katastrophale Zukunft als Gegenwart darzustellen".
Was aber ist mit den Darstellungen jenseits von Katastrophenfilm und dystopischem Roman? Zumindest existieren sie. Im Falle von "Das Ministerium für die Zukunft" des US-Sci-Fi-Autors Kim Stanley Robinson wurde sie sogar zu einer Art Bibel für Klimaaktivisten. Der Roman beginnt mit einer Katastrophe, Millionen Menschen, die durch eine Hitzewelle in Indien sterben. Am Ende (Achtung, Spoiler!) kriegen die Menschen doch noch irgendwie die Kurve.
Auf 700 Seiten lässt Robinson Zeitzeugen beschreiben, wie die nächsten 100 Jahre aussehen könnten -samt dem steinigen Weg dahin. "Klimafiktion kann helfen, uns diese Zukunft als gelebtes Ereignis vorzustellen. Und uns Ideen geben, was wir jetzt tun können, um das Bevorstehende weniger schädlich zu machen", antwortet Robinson auf eine Falter-Frage. Dafür brauche es keine Untergangsszenarien, keine simple Erklärung für die Gefahr: "Eine Alieninvasion ist unwahrscheinlich -das Universum ist schlichtweg zu groß -, aber der Klimawandel hat schon begonnen."
Robinsons Buch hat eine neue Ära eingeleitet, das Genre Climate-Fiction verlässt gerade die Nische und erobert die Buchhandlungen. Auch das Serienfernsehen trägt dazu bei, die Zukunft vorstellbar zu machen (siehe Seite 26). Und mit der Flut von Materialien tauchen auch jene auf, die sie analysieren wollen. "Wir sind Flöhe in dem Fell eines Hundes, der in den Abgrund rennt, und wir checken gar nicht, was gerade passiert", meint Friedemann Karig, Koautor des gemeinsam mit Samira El Ouassil verfassten Bestsellers "Erzählende Affen".
Auch er ist Verfechter der Hyperobjekt-These, der Idee, dass die Klimakrise so allgegenwärtig wie unsichtbar ist. Viele Romane und Drehbücher nutzen nun zumindest das Setting der Klimakrise. Nur: Sie erzählen in Wahrheit eine andere Geschichte. Die Erderhitzung mit ihren Folgen wird zur Kulisse, zum Aufhänger für eine Liebes-oder Familiengeschichte. Am häufigsten beobachtet Karig das bei Geschichten über Klimaaktivisten: Die Protagonisten könnten genauso für mehr Tierwohl einstehen. "Ob die Erde da 1,5 oder drei Grad wärmer wird, ist für die Geschichte völlig irrelevant", meint Karig. Am Ende steht man da und hat den falschen Schluss gezogen: dass ein besonders talentiertes Individuum das Kollektiv retten kann, auch wenn das in der Realität ein sinnloser Kampf ist. Das Kollektiv muss sich schon selbst retten.
Oder zumindest gegen die richtigen Gegner kämpfen. Denn nicht nur die Helden sind schwer zu besetzen, auch die Klimaantagonisten sind selten James-Bond'sche Bösewichte, gar eine außerirdische Macht, die am Thermometer dreht. Was aber noch lange nicht heißt, dass es nicht Menschen gibt, die mehr als andere zu diesem Schlamassel beigetragen haben.
Man nehme die US-amerikanische Ölfirma ExxonMobil. Sie hatte in den 1980er-Jahren selbst Wissenschaftler angestellt, die Prognosen über den Effekt von Treibhausgasen in der Atmosphäre liefern sollten. Nur um diese kassandrischen Vorhersagen dann mit allen Mitteln zu verschleiern. Erst kürzlich beschrieben Forscher aus Harvard, wie detailreich die Klimaprognosen des fossilen Unternehmens schon damals waren. Stattdessen schafften es die Unternehmen, die Schuld auf das Individuum zu lenken. Der Ölkonzern BP popularisierte etwa den Rechner für den ökologischen Fußabdruck. Ein Narrativ, das sich bis heute hält: Wir haben uns selbst zum Gegner erklärt.
Manche sehen in der Geschichte von ExxonMobil ein Stück Zeitgeschichte, einen Korruptionsfall. Der Autor Friedemann Karig wittert Filmstoff: "Wenn wir es schaffen zu verstehen, warum es den Ölmanager nicht interessiert, dass er für Geld die Welt zerstört, können wir ihn auch besser bekämpfen." Wieso nicht ein Drehbuch über Klimalobbyisten und ihre Methoden, einen Roman über den Ölkonzernmanager und seine Verschleierungstaktiken schreiben?
Der Kampf gegen die Klimakrise ist also kein Aufbegehren gegen eine Natur, die man sich untertan machen muss, wie es die Bibel forderte. Es handelt sich um keinen Krieg gegen die Umwelt, die uns mit Hitze, Stürmen oder Dürre bestrafen will. Die Geschichte könnte auch eine über diejenigen sein, die die Folgenbekämpfung so unglaublich schwer machen. Auch das Theater versucht, das zu vermitteln.
"Das Problem ist so komplex. Wie willst du denn CO2 auf der Bühne erzählen?", fragt der freischaffende Regisseur Calle Fuhr, der für das Wiener Volkstheater das Stück "Die Redaktion" entwickelt hat. Das Resultat seiner Überlegungen erzählt von korrupten Praktiken der OMV und der journalistischen Arbeit des Magazins Dossier, das einige davon aufgedeckt hat. "Wir erzählen eine Geschichte über die Mechanismen in einem Konzern, der ganz aktiv von der Klimakrise profitiert -und gleichzeitig die Geschichte des journalistischen Widerstands", sagt Fuhr. Ende April feiert das Stück Premiere.
Die Antagonisten sind klar benannt, doch anstatt zu resignieren, hört man auch von jenen, die versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Das ist das eine postfossile Narrativ, ein Ansatz, der funktionieren könnte. Ein anderer ist viel banaler: Wieso nicht die Klimakrise durch Repräsentation sichtbar machen? So wie sich Netflix schon durch queere und ethnisch vielfältige Besetzungen schmückt, um eine diverse Realität sichtbar zu machen.
Für die Klimakrise -und vor allem ihre Bekämpfung -hieße das zum Beispiel, Helden zu zeigen, die ihre Reise im Hollywood-Blockbuster auf dem Fahrrad antreten, anstatt mit dem neuesten, von einer Marke gesponserten Sportwagen vorzufahren.
Kunst existiere nämlich in einer kapitalistischen Welt, meint auch der Sci-Fi-Autor Kim Stanley Robinson -und reproduziert sie gleichzeitig auch, oft ohne den Status quo zu hinterfragen. Das Potenzial einer anderen Welt zu zeigen, dürfe man deshalb nicht unterschätzen. Auch seinen Roman sieht Robinson als einen Ruf zu den Waffen, ein "Best-Case-Szenario", das trotzdem realitätsnah bleibt.
Die Zukunft, so wie sie Klimafiktion zeichnet, ist also weder eine Apokalypse, die es zu akzeptieren gilt, noch eine unerreichbare Utopie. Doch um zu retten, was noch zu retten ist, müssen wir lernen, uns vorzustellen, wohin unsere Heldenreise überhaupt führen könnte. So werden Literatur und Film auch zum politischen Statement, meint Kim Stanley Robinson: "Wir können es besser und sollten es deshalb auch besser machen. So simpel ist das."
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: