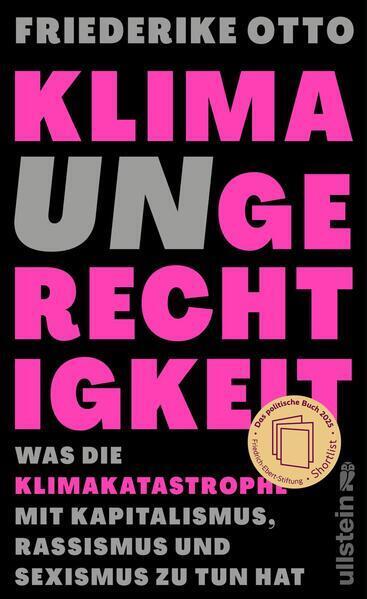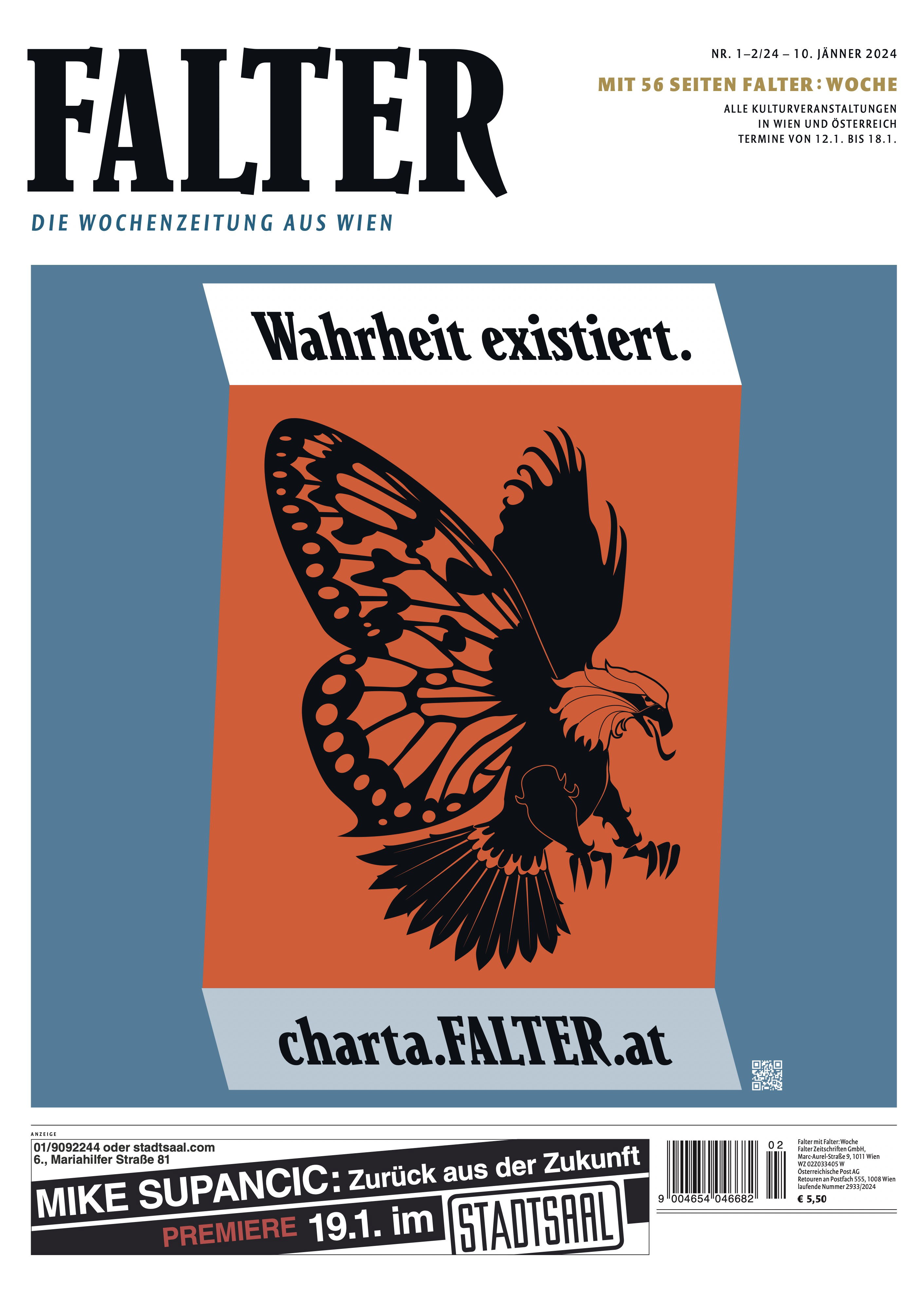
"Wie viele Tote wollen wir uns noch leisten?"
Gerlinde Pölsler in FALTER 1-2/2024 vom 10.01.2024 (S. 44)
Juni 2021, der Nordwesten Amerikas erleidet eine extreme Hitzewelle. Das kanadische Raftingparadies Lytton meldet am 29. Juni einen Temperaturrekord von 49,6 Grad. "Krankenhäuser füllten sich schlagartig mit Hitze-Patient*innen, [...] plötzliche Todesfälle schockierten die Bevölkerung", schreibt die Klimaforscherin Friederike Otto und zitiert Menschen, die mittendrin waren: "Es gab mehrere Tage, an denen ich mich nicht erinnern konnte, was ich getan hatte, ich lag einfach auf dem Boden." Auf 65 Quadratkilometern brannten Wälder, zwischen Vancouver, Seattle und Portland waren neun Millionen Menschen betroffen.
In "Klimaungerechtigkeit. Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat" beschreibt Otto extreme Wetterlagen: Die Überflutungen in Pakistan 2022. Hitze in Gambia, Dürren in Südafrika, aber auch die Flutkatastrophe 2021 mitten in Deutschland, im Ahrtal, mit mehr als 180 Toten. Penibel arbeitet sie heraus, wer am meisten litt oder gar starb. Genau das habe das Erforschen von Extremwetterereignissen sie nämlich gelehrt: wie ungerecht deren Folgen seien. Hitze zum Beispiel trifft vor allem "ältere Menschen, kleine Kinder und Personen mit bereits bestehenden Erkrankungen. Aber auch sozial isoliert lebende Menschen, Obdachlose, Leute mit geringen finanziellen Möglichkeiten sowie Menschen, die sich aus beruflichen Gründen viel im Freien aufhalten". Otto analysiert auch die Versäumnisse von Politik und Behörden, die all das verstärken: Frühwarnsysteme funktionierten in Kanada genauso wenig wie im Ahrtal.
Wer also zahlt für den Klimawandel? "Die, die immer zahlen." Mit ihrem Leben, ihrer Lebensgrundlage, ihren wenigen Ersparnissen und ihrer Gesundheit. Immer sei nur die Rede von Klimaschutz, aber wer rede von Menschenschutz? Die Frage, die wir uns stellen müssten, laute, "wie viele Tote wir uns noch leisten wollen".
Otto formuliert kompromisslos. Als verantwortlich sieht sie etwa den deutschen Energieversorger RWE oder den US-Mineralölkonzern Exxon Mobil, "die genau wissen, welche Schäden sie produzieren". Die fossile Industrie vergleicht sie mit einer "mordenden Gang". Schuld an der Misere sei das "kolonialfossile Narrativ": Es fuße auf der Idee, "dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe für den Erhalt dessen, was wir als Wohlstand bezeichnen, unerlässlich und 'Freiheit' mit Tempolimit unmöglich sei". Ein Erbe des Kolonialismus, der Ausbeutung rechtfertige.
Es ist ein rasantes Plädoyer, das Otto da auf den Tisch knallt, dicht an Fakten und erfrischend in seiner Kampfeslust und auch der Wut, die die Autorin selbst einräumt. Heilige Kühe - jedem sein Auto, so viel Fleisch essen wie möglich -sind der preisgekrönten Forscherin fremd.
Sie hat aber eine Idee, wie wir rauskommen: mit einem neuen Narrativ. "Dass nämlich unser jetziges Leben voller Härten und Entbehrungen ist und Reichtum und Überfluss erst noch kommen werden." Den meisten Menschen würden Maßnahmen gegen den Klimawandel nämlich mehr Lebensqualität und Gesundheit, grünere Städte, weniger Stress und mehr Freiheit bringen. Und wer sich fragt, was eine Person schon tun kann, dem antwortet sie: "'Hör auf, eine einzelne Person zu sein!' [] Indem die Forderung nach Veränderung geteilt wird, wird sie irgendwann unausweichlich."