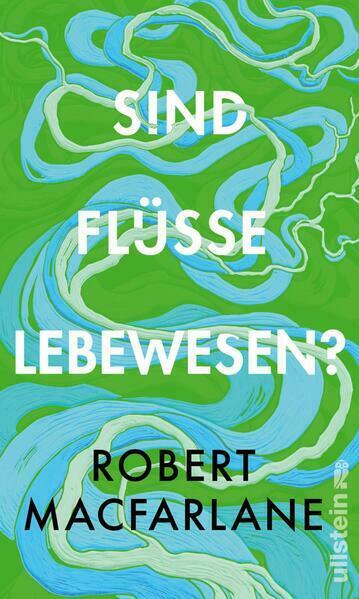"Flüsse fließen durch Menschen genauso, wie sie durch Orte fließen"
Katharina Kropshofer in FALTER 37/2025 vom 10.09.2025 (S. 50)
Es hätte ein sehr kurzes Buch werden können. Als Robert Macfarlane seinen Sohn Will eines Morgens zur Schule brachte, fragte er ihn: "Glaubst du, Flüsse sind Lebewesen?" Will antwortete, ohne lange nachzudenken: "Ja." Was für eine dumme Frage in den Augen eines Volksschulkinds!
Kinder sprechen mit Vögeln, haben Bäume als Freunde, sehen die Natur als beseelt an. Sie seien "naturals at nature", meint Macfarlane, also Naturtalente im Fach Natur. Doch für ihn, einen Realisten, Umweltwissenschaftler, Professor für Englische Literatur in Cambridge, sollte diese Frage zu einem langen Auftrag werden: "Ich habe 400 Seiten und vier Jahre gebraucht, um überhaupt mit der Fragestellung klarzukommen."
Macfarlane, 49 Jahre alt, mag vielen Österreichern kein Begriff sein. In Großbritannien ist er eine kleine Berühmtheit. Manche bezeichnen ihn gar als wichtigsten "nature writer" der Gegenwart, also Autor von Naturbeschreibungen in der Tradition von Jean-Jacques Rousseau oder Alexander von Humboldt. Was ihn auszeichnet, ist die Poesie, mit der er schreiberisch Landschaften erkundet -Berge, Höhlen, Wege - und so die Grenze zwischen Sachbuch und Roman verschwimmen lässt.
Er ist auch Aktivist, Alpinist und bekannt dafür, Wissenschaft in Kunst zu gießen. Gemeinsam mit dem Folk-Musiker Johnny Flynn hat er Liedtexte für ein Album über Flüsse geschrieben; in seinem Kinderbuch "The Lost Words" brachte er jungen Lesern Wörter wie "dandelion"(also Löwenzahn) näher, die aus der Alltagssprache zu verschwinden schienen. Es hat sich seither mehr als 100.000-mal verkauft und wird an Schulen verteilt.
In all diesen Prozessen haben ihn drei Fragen begleitet: Kann sich ein Berg erinnern? Kann ein Wald denken? Und: Ist ein Fluss lebendig? Die Beantwortung der dritten Frage öffnete Welten, die er nun in seinem zwölften Buch (siehe Marginalspalte Seite 52) verarbeitet hat -sein dringendstes Buch, meint Macfarlane. Denn die menschliche Beziehung zu Flüssen ist in vielerlei Hinsicht "toxisch": Die Dämme und Bergbauanlagen, das Mikroplastik und die Abflüsse aus der Landwirtschaft sind dafür verantwortlich, dass viele Flüsse heute nicht "lebendig" sind, sondern im Sterben liegen.
Also zog der Brite los, um drei Flüsse zu erkunden, die für ein neues Verständnis von Leben stehen: den Los Cedros in einem ecuadorianischen Nebelwald, der durch Gold-und Kupferbau bedroht ist; die verschmutzten, verstopften Flüsse, die einst durch Chennai, Indien, flossen; und den Mutehekau Shipu in Kanada, bedroht vom Bau eines riesigen Wasserkraftwerkes. Seine Frage erweiterte sich dabei: Wenn ein Fluss lebendig ist, würde das auch heißen, dass ihm anderer Schutz zusteht? Vielleicht sogar Rechte?
Falter: Herr Mcfarlane, dass Flüsse Lebewesen sein könnten, nennen Sie einen weltbewegenden Gedanken. Warum ist diese Frage so schwer zu beantworten?
Robert Macfarlane: Weil es am Ende eine Frage über das Leben an sich ist, darüber, was "lebendig" heißt - eine der ältesten und schwierigsten Fragen der Menschheit. Flüsse kondensieren diese Frage auf eine schöne, nützliche Weise. Weil sie sehr gut zum Denken sind.
Wie meinen Sie das?
Macfarlane: Wir können sie nutzen, um über unsere Ontologie, also die Grundstrukturen der Wirklichkeit nachzudenken. Würden wir die Frage rational, im Sinne der westlichen Aufklärung beantworten, wäre die Antwort natürlich Nein. Ein Fluss beinhaltet Leben, ermöglicht Leben, aber ist nicht selbst lebendig. Es gibt so viele andere Weltanschauungen und Kulturen, die diese Frage ganz anders beantworten: Für sie existiert Leben nur in der konstanten Interaktion von Lebewesen -auch mit Flüssen.
Während der Wiener Sommer im besten Fall wechselhaft, in Realität wohl eher verregnet ist, sitzt Macfarlane in Cambridge inmitten einer der längsten Dürren, die England je gesehen hat. In den Quellen hinter seinem Haus plätschert es nur, weil ein eigenes System Wasser aus dem späteren Flussverlauf nach oben pumpt.
In ganz England und Wales ist keiner der 40.000 "water bodies", der Flüsse, Bäche, Quellen, in gutem Zustand; überall wird Wasser privatisiert, werden Flüsse als Ressource behandelt. "Wenn es Ihnen schwerfällt, einen Fluss als Lebewesen zu betrachten, können Sie sich auch einen toten oder sterbenden Fluss vorstellen", schreibt Macfarlane.
All das gilt nicht nur für den Inselstaat: Nur ein Drittel der großen Flüsse weltweit kann frei fließen. Europa hat ohnehin das fragmentierteste Flusssystem aller Kontinente, mit mehr als einer Million Barrieren -von großen Dämmen bis zu kleinen Blockaden. In Österreich sind weniger als 15 Prozent der Flüsse in einem ökologisch sehr guten Zustand. "Dabei sind Flüsse extrem selten, fragil, weil sie nur 0,002 Prozent des Wassers auf der Erde tragen", sagt Macfarlane. "Die gute Nachricht ist, dass sie sich selbst heilen, wenn man sie lässt."
Das berühmteste Beispiel? Die Pariser Seine, in der die Anwohner im Juli 2025, nach 100 Jahren, wieder schwammen. Oder der Klamath River, der durch die US-amerikanischen Bundesstaaten Oregon und Kalifornien fließt. Im größten Projekt seiner Art wurden vier riesige Dämme entfernt, nun kann er wieder frei fließen.
Ohne Flüsse ginge es nicht. Sie transportieren Nährstoffe, beherbergen Millionen von pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen Lebewesen. Sie sind Wasserquelle und Klimaanlage; sie liefern Trinkwasser und reinigen unsere Abfälle, sind also untrennbar mit der menschlichen Gesundheit verknüpft. Sie bringen uns Leben, aber bergen oft auch Gefahr. Schon die alten Ägypter bauten Staudämme, um Flüsse in ihre Bahnen zu weisen.
Dass das nun im Rahmen einer Renaturierungsbewegung vielerorts rückgängig gemacht wird, ist zur Notwendigkeit geworden. Auch weil uns die Flüsse selbst, paradoxerweise, vor Hochwasser schützen können: Eine Au mit viel Rückstauraum kann überschüssigen Niederschlag speichern. Die Frage, die Macfarlane stellt, ist deshalb nur auf den ersten Blick naiv. Sie erzählt über unser Verhältnis zur Natur und davon, ob wir dieses mithilfe von Politik und Gesetzgebung verbessern können. Es ist also kein Zufall, dass Macfarlane für sein Buch als Erstes nach Ecuador reiste. 2008 wurde das Land zum Paradebeispiel für eine neue Sicht auf die Natur: Damals verabschiedeten die Ecuadorianer unter dem Präsidenten Rafael Correa eine neue Verfassung, in der sie "Pachamama", also Mutter Natur, eigene Rechte zugestanden.
Das Prinzip des "Sumak Kawsay" besagt, dass die Natur ein Recht darauf hat, zu existieren und ihre evolutionären Prozesse, Funktionen und Strukturen weiterzuführen. Wer diese Integrität angreift, etwa Wasser privatisieren will, dem drohen Strafen.
Die Nachricht schlug ein, manche Naturschützer verglichen es mit der Entstehung der Menschenrechte. Ecuador ist nicht das einzige Beispiel geblieben: Im März 2017 verabschiedete Neuseeland ein Gesetz, wonach der Whanganui River als "spirituelle und physikalische Entität" geschützt werden muss. Der Fluss ist so nicht nur als eigenständiges Lebewesen anerkannt, er kann als solches auch vor Gericht ziehen. Nur wenige Tage später urteilte ein indischer Richter, dass die Flüsse Ganges und Yamuna als Lebewesen gelten. 2021 wurde der Mutehekau Shipu in Kanada eine Rechtspersönlichkeit.
Mittlerweile hat die öko-juristische Bewegung auch Europa erreicht: Seit 2022 gilt auch die spanische Lagune Mar Menor als juristische Person. Bürger und eigens geschaffene Gremien können nun in ihrem Namen vor Gericht ziehen. Es geht nicht nur darum, dass Flüsse und Meer sauber genug sind, damit Menschen darin schwimmen können. Sondern auch darum, dass nichtmenschliches Leben erhalten bleibt. Das Ökosystem in der Nähe der Stadt Murcia erlitt in den Jahren zuvor immer wieder ein Massensterben von Tieren und Pflanzen. Seitdem ein Volksbegehren den europaweit einzigartigen juristischen Schritt ermöglicht hat, kann sich die Lagune erholen.
Macfarlanes Buch kommt also zur richtigen Zeit. Nicht nur, weil der Naturschutz das Recht entdeckt, sondern auch, weil Flüsse weltweit stark unter Druck stehen. Die Rechte der Natur werden oft dort eingefordert, wo der Mensch sie am stärksten bedroht. "Aber es tut mir leid, dass wir genau in jener Woche sprechen, in der der ecuadorianische Präsident Daniel Naboa mit Reformen die Rechte der Natur zutiefst verletzen will", meint Macfarlane. Erst Anfang August hat Naboa das Umweltministerium aufgelöst und seine Rechte dem Bergbauministerium übertragen. "Alles, was ökozentrisch gedacht wird, bedroht auch die Grundlagen der anthropozentrischen Macht", sagt der Autor.
Doch es geht in seiner Suche nicht nur um Klagen, die auf Basis dieser Rechtsprechung ausgefochten werden können. Es geht auch darum, was diese andere Sicht auf die Dinge mit unserem Denken macht.
Wie neu sind diese Ideen eigentlich?
Macfarlane: Sie sind nur für das westliche Recht neu. Diese alten, animistischen Ideen haben in den verschiedensten Kulturen und Communitys überlebt und sind dort selbstverständlich. Nun holen die westlichen Demokratien endlich auf.
Wie sehr unterscheidet sich das von Tierrechten, die es ja auch hier schon lange gibt -zumindest in der Theorie?
Macfarlane: Ich würde da stark unterscheiden. Wir können leicht erkennen, dass Tiere lebendig sind, weil sie uns ähneln. Aber Flüsse, Wälder, Berge sind eine andere Kategorie - wo beginnen sie und wo hören sie auf? Ich musste zuerst mit den Flüssen reisen, Flussmenschen auf der ganzen Welt treffen, um meine eigenen Gewissheiten über Leben und Flüsse zu verlernen. Wasser sucht sich immer Körper - und wir sind auch "water bodies", Wasserkörper. Heute bin ich mir sicher: Flüsse fließen durch Menschen genauso, wie sie durch Orte fließen.
Aber ist es nicht eine Art kulturelle Aneignung, wenn wir uns im Westen plötzlich für indigene Konzepte interessieren?
Macfarlane: Man kann Flüsse auch zu einer Rechtspersönlichkeit machen, ohne die Weltsicht zu übernehmen. Aber es ist kein Zufall, dass die Initiativen dort stattfinden, wo es weiterhin starke indigene Stimmen gibt: in Neuseeland, Quebec, Lateinamerika. Wenn wir das in Europa kopieren, müssen wir es an unseren kulturellen Hintergrund anpassen und nicht einer Art "Cosplay-Animismus" verfallen.
Was er damit meint: Die indigenen Konzepte, in denen Flüsse als Lebewesen gesehen werden, sind uns fremd. Sie zu übernehmen, fühlt sich künstlich an. Wer also Macfarlanes Buch in der Tradition der Naturwissenschaften liest, könnte ihm Esoterik vorwerfen, eine zu spirituelle oder gar verklärte Weltsicht. Doch Macfarlane ist Rationalist geblieben. "Ich arbeite in einem strengen, intellektuellen Kontext. Deswegen habe ich mich anfangs sehr gewehrt, hatte Angst, dass dieses Buch und diese Denkweise als sentimentales Hippietum abgetan werden könnte", sagt er.
Er nennt das heute "unlearning", ein Verlernen. Denn diese Weltsicht als spirituell zu deuten, sagt mehr über unsere Gesellschaft aus als über Macfarlane selbst. Er hält inne und wirft die Frage zurück: "Hat es Sie überzeugt?" Wer sich auf seine Gedankenreise einlässt, erkennt schnell: Das westliche Denken ist genauso eine Tradition wie ein vermeintlich spirituelles Weltbild. Wer das Buch liest, bewegt sich in Macfarlanes Geschwindigkeit. Was in diesem Falle heißt: in der Fließgeschwindigkeit der Flüsse, die er für seine Reise aufgesucht hat.
Der Brite versteht das nicht nur als Metapher. Was, wenn nicht ein Fluss, ist etwa das großflächige Mycelium unter unseren Füßen, durch das Pilze Nährstoffe untereinander und mit Pflanzen austauschen? Und als was, wenn nicht als Fluss, können wir die Prozesse in unseren Körpern, aber auch unseres Lebens an sich beschreiben?
In der Frage, ob Flüsse lebendig sind, geht es also nicht um eine neue wissenschaftliche Definition. Es ist vielmehr ein Experiment, durch Sprache die Grenzen des westlichen Rationalismus zu überwinden. Das Verlernen, von dem Macfarlane spricht, würde jedenfalls vieles verändern, den Menschen nicht als "Krone der Schöpfung" sehen. "Ich möchte von Flüssen und Wäldern als Personen sprechen", schreibt Macfarlane. Eine Grammatik regle immerhin die Beziehung zwischen den Dingen. Noch sind wir hier Analphabeten. Doch nur wer die richtigen Worte findet, kann daraus auch Politik und Gesetze ableiten.
Später am Tag des Gesprächs will Macfarlane nach Norfolk reisen, um zum Chalk River zu wandern und sich dort ein neues Renaturierungsprojekt anzusehen: Zehn Kilometer Fluss wurden dort schon wiederhergestellt, mehr sollen folgen.
Flüsse zu schützen, wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen, heißt auch, gegen einen Prozess des Vergessens anzukämpfen, meint er. So wie bei den Windschutzscheiben: Wer vor der Jahrtausendwende in einem Auto saß, erinnert sich an das insektenverklebte Glas. Heute ist die Abwesenheit davon zum Symbol eines rapiden Artensterbens geworden.
Mit den Flüssen sei es ähnlich. "Eltern sagen ihren Kindern: ,Berühr nicht das Wasser!' Oder: ,Wasch dir die Hände!'", meint Macfarlane. Das intergenerationale Vergessen verdecke den Schaden, den Menschen den Flüssen angetan haben. "Aber dieser Prozess ist nicht linear und kann auch wieder in eine gesunde Richtung gehen! Wasser verändert ständig seine Form." Tümpel, Teiche, Flüsse, Seen, Meere, Ozeane, aber auch Menschen. "Wir müssen verstehen, dass wir Teil davon sind."