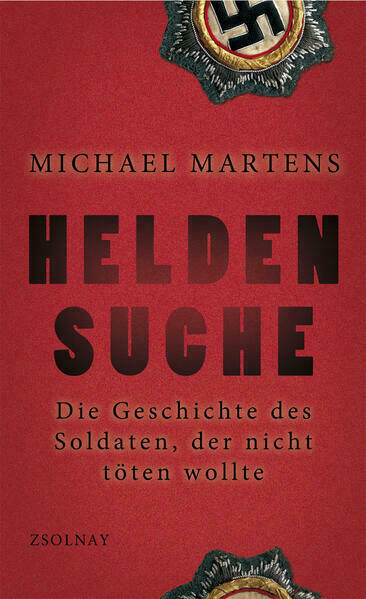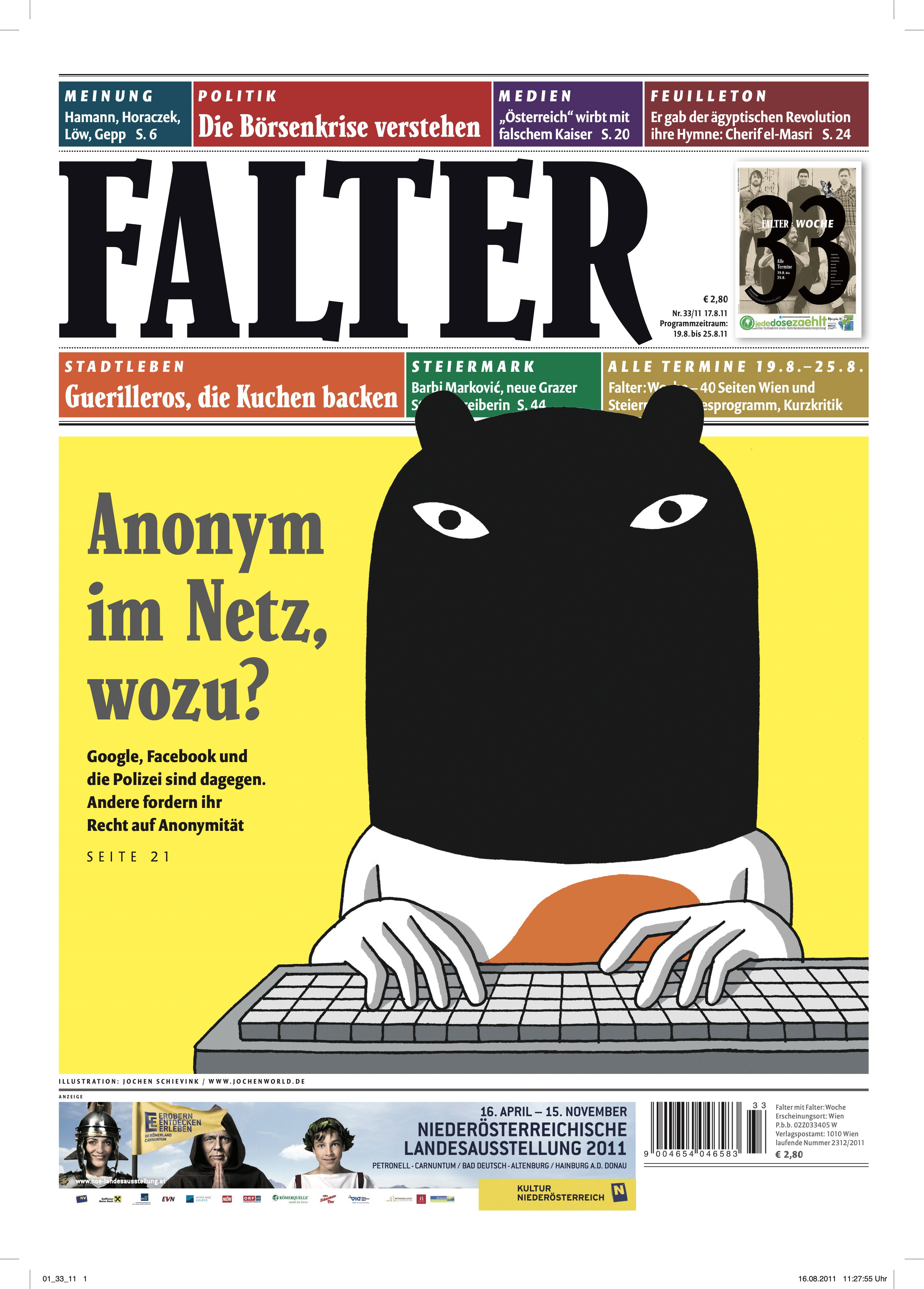
Eine Sage aus ferner NS-Zeit, schade, dass sie nicht zutrifft
Thomas Geldmacher in FALTER 33/2011 vom 17.08.2011 (S. 18)
Ein Wehrmachtssoldat wird zum antifaschistischen Helden, weil er sich weigerte, serbische Partisanen zu töten. Zu schön, um wahr zu sein
Über dem Jugoslawienfeldzug der Wehrmacht im Jahr 1941 hängen nach wie vor Nebelschwaden. Als Standardwerk gilt seit 18 Jahren "Serbien ist judenfrei!" des Politikwissenschaftlers Walter Manoschek.
Der immer schon etwas abseits gelegene Balkan kann es hinsichtlich seiner NS-historiografischen Popularität nicht mit dem Blitzkrieg oder dem Angriff auf die Sowjetunion aufnehmen. Michael Martens bemüht sich aber in seiner Fallgeschichte "Heldensuche", einen konkreten Aspekt des Krieges der Wehrmacht am Balkan näher zu beleuchten.
Es geht um eine gut dokumentierte Erschießung. Am 20. Juli 1941 ermordeten Angehörige der 714. Infanteriedivision der Wehrmacht in Smederevska Palanka, einem Dorf südöstlich von Belgrad, 16 jugoslawische Partisanen. Einer der Soldaten hatte seinen Fotoapparat dabei. Auf einem Bild ist ein Mann in Uniform zu sehen, der weder Helm noch Gewehr trägt. Dieser Mann, so hieß es in Jugoslawien bald nach dem Krieg, habe sich geweigert, an der Exekution teilzunehmen, und sei wegen Befehlsverweigerung kurzerhand erschossen worden. Sein Name: Josef Schulz.
Die Suche nach der Wahrheit um den Soldaten ist der zwischendurch recht dünne rote Faden, der sich durch Martens Werk zieht – Zweifel an der obigen Erzählung sind angebracht. Denn selbst in den Reihen der Wehrmacht wäre es kaum möglich gewesen, eine Befehlsverweigerung dieser Art ohne kriegsgerichtliches Verfahren zu ahnden. Vor allem aber hätte der Fall Schulz den Verteidigern von NS-Kriegsverbrechern nach 1945 durchschlagskräftige Munition geliefert. Denn diese bemühten in den Nachkriegsprozessen unablässig den sogenannten Befehlsnotstand und argumentierten, sie wären an die Wand gestellt worden, hätten sie sich geweigert, Geiseln zu foltern oder Juden zu erschießen. Wäre die Geschichte von Josef Schulz wahr, so hätten diese Verteidigungsstrategien einen realen Hintergrund.
Eine Vielzahl an Abschweifungen
Dieses potenzielle Problem erkannte auch die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, die 1958 eingerichtete deutsche Verfolgungsbehörde für NS-Verbrechen. Daher stellten die dortigen Staatsanwälte ab 1966 umfangreiche Recherchen in der Causa Schulz an. Das erfahren wir aber erst auf Seite 194 der knapp 400-seitigen Heldensuche. Zuvor erzählt Michael Martens, der zwischen 2002 und 2009 als Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Belgrad tätig war und seitdem aus Istanbul berichtet, wie er durch Zufall auf die Geschichte von Josef Schulz stieß. Er erzählt die semifiktive Biografie des Budapester Juden Adrian Holländer, der dem Massaker der Wehrmacht in Kragujevac zum Opfer fiel, Schulz aber nie getroffen hat.
Martens erzählt von der Beerdigung des Schriftstellers Aleksandar Tima und von den Verstrickungen des Historikers Percy Schramm in den Nationalsozialismus, von Josip Broz Titos Speiseplan, von der Suche des Industriellen Hermann Frank Meyer nach seinem Vater und von vielen anderen Dingen mehr, die mit der Geschichte von Josef Schulz nichts oder nur am Rande zu tun haben.
Das ist recht schwungvoll geschrieben, allerdings fragt man sich bald, warum Mertens sich mit solcher Vehemenz in Abschweifungen ergeht.
Keine redliche Geschichte
Die Antwort ist simpel: Im Jahr 2002 veröffentlichte der in Leipzig tätige Historiker Carl Bethke in einem Sammelband den Artikel "Das Bild vom deutschen Widerstand gegen Hitler im ehemaligen Jugoslawien", in dem er ausführlich die Legende des angeblichen Wehrmachtsopfers Josef Schulz dekonstruiert. Schulz, schreibt Bethke und bezieht sich dabei auf die Recherchen der Ludwigsburger Staatsanwälte, sei nämlich bereits am Tag vor der Partisanenerschießung gefallen.
Die Legendenbildung nach dem Krieg sei zum einen den touristischen Ambitionen des Direktors einer lokalen Mineralwasserfabrik und zum anderen den diplomatischen Interessen Jugoslawiens und Westdeutschlands zu verdanken gewesen.
Nun, so etwas ist unangenehm. Man glaubt in unerschlossene Gebiete vorzudringen und stellt fest, andere Leute waren schon vorher da. Martens hätte seine "historische Detektivgeschichte" erheblich abkürzen können, wenn er einfach die nächste Buchhandlung angesteuert hätte.
Aber es wäre ungerecht, dem Autor zu unterstellen, er habe schlecht recherchiert. In der Tat nahm er mit Bethke Kontakt auf und führte ein ausführliches Gespräch mit ihm, wie Bethke dem Falter mitteilte. Der FAZ-Journalist verzichtete aber darauf, diesen Teil der Recherchen in seinem Buch zu erwähnen. Es mag der Dramaturgie dienen, Bethkes Artikel unter den Tisch fallen zu lassen, redlich ist es nicht. Um so weniger, als Martens großspurig verkündet: "Dieses Buch basiert nicht auf einer wahren Geschichte. Es ist eine."
Diese Unterlassungen sind sehr bedauerlich, denn zwischendurch gelingen Martens berührende Passagen wie das Kapitel über die Dichterin Mina Kovacevic, die in den 1970er-Jahren in ihrem Garten ein Denkmal für Schulz aufstellen ließ und dafür von den Dorfbewohnern als Faschistin denunziert wurde. Oder Beobachtungen wie die folgende: "Die Straße war eine Sackgasse, die nach einem serbischen Forschungsreisenden benannt war."
So bleibt für den Historiker Carl Bethke die unbedankte Rolle eines Peter Mitterhofer, der einst die Schreibmaschine erfand, ohne dafür zu Ruhm zu kommen. Journalist Martens hingegen agiert wie der Konzern Remington, der die Schreibmaschine zur Serienreife brachte und weltberühmt wurde. Geschichte ist ungerecht.