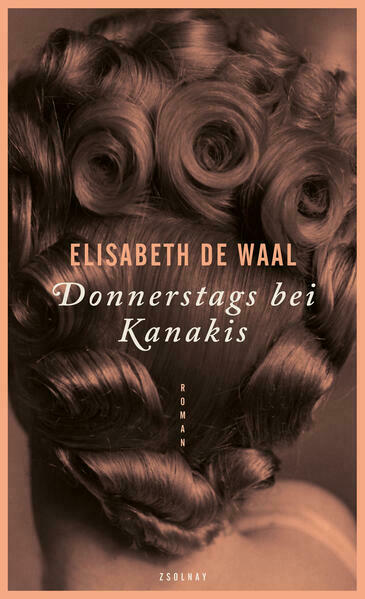Der Förster vom Heldenplatz
Matthias Dusini in FALTER 7/2014 vom 12.02.2014 (S. 31)
Ein halbes Jahrhundert nach seiner Niederschrift wurde ein Roman Elisabeth de Waals veröffentlicht. Leider
Der englische Künstler Edmund de Waal schrieb ein Buch über seine aus Österreich stammende Familie, das 2011 unter dem Titel "Der Hase mit den Bernsteinaugen" erschien. Darin spielt die Großmutter Elisabeth de Waal eine wichtige Rolle, eine gebildete Dame aus dem Großbürgertum, die mit Rainer-Maria Rilke korrespondierte und als eine der ersten Frauen überhaupt in Wien studierte.
In ihren Unterlagen fand der Enkel ein Romanmanuskript, das Elisabeth de Waal (1899–1991) nach ihrer Emigration nach England verfasst hatte. Für ihn war es eine Herzensangelegenheit, den Text gedruckt zu sehen, für den Verlag wohl auch finanzielles Kalkül. "Der Hase mit den Bernsteinaugen" ist ein Bestseller, der die Aufmerksamkeit nun auch auf den posthum publizierten Roman lenkt, in dem die Autorin von Menschen erzählt, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien zurückkehren.
Ein von den Nazis verfolgter jüdischer Wissenschaftler versucht, an der Universität wieder Fuß zu fassen. Der schwerreiche Theophil Kanakis wiederum, Mitglied der griechischen Community Wiens, kehrt aus dem Exil zurück, um es sich gutgehen zu lassen. Er kauft Antiquitäten, gibt Empfänge und sucht nach einer standesgemäßen Bleibe. Dazwischen gibt es noch einige Finis und Franzis, die den Altersschnitt der Figuren senken – und das Gefühlsleben der schon etwas angegrauten Herren durcheinanderwirbeln.
Das liest sich über weite Strecken wie ein Heimatroman. Da wird im Hochgebirge geturtelt und in Schlössern gefeiert; die Blumen sind blau wie der Himmel. "Küss die Hand, Prinzessin!" Die Erzählerin ist verliebt in den Lebensstil des Hochadels und veredelt selbst anonyme Laborassistenten durch blaues Blut zu einem heiratswürdigen Individuum.
Würde man die Biografie der Autorin nicht kennen, hielte man die Erzählung wohl für ein Produkt jener süßlichen Geschichtsvergessenheit, wie sie in den postnazistischen Filmen à la "Förster vom Silberwald" zum Ausdruck kommt: Nach dem Massenmord röhrte brunftig der Hirsch.
Was de Waals Buch von anderen Produkten der Heimatindustrie unterscheidet, ist der gebrochene Bezug einiger Romanfiguren zu eben dieser Heimat. Der Wissenschaftler wird von einem ehemaligen SS-Arzt gemobbt, im Kunsthandel tauchen die in der NS-Zeit geraubten Objekte wieder auf.
Hier fängt de Waal jene unheimliche, von Ablehnung und schlechtem Gewissen geprägte Atmosphäre ein, die viele Remigranten bedrückt haben muss, etwa bei der Passkontrolle an der Grenze: "Es war die Art dieser Stimme, einschmeichelnd und leicht vulgär, fühlbar für das Ohr wie eine bestimmte Art Stein für die Berührung – Bimsstein, grobkörnig, schwammartig und an der Oberfläche ein wenig ölig – eine österreichische Stimme."
Stilsicher skizziert die Autorin auch einige Wiener Schauplätze; etwa wenn sie den Heldenplatz als einen Ort höfisch-heroischer Präsentation beschreibt, als ein Feld, über dem sich die Wolken türmen und in das "der Wind von den grenzenlosen Ebenen im Osten hereinstreicht".
Leider sind Passagen von so plastischer Wirkung die Ausnahme. Zu durchsichtig bleibt die erzählerische Absicht, einem Zeitbild dann doch noch eine opernhafte Liebestragödie einzupassen, in der Jungfrauen in die Fänge finsterer – homosexueller! – Gesellen geraten. Es hätte auch heute noch plausible Gründe gegeben, von einer Veröffentlichung des Manuskripts abzusehen.