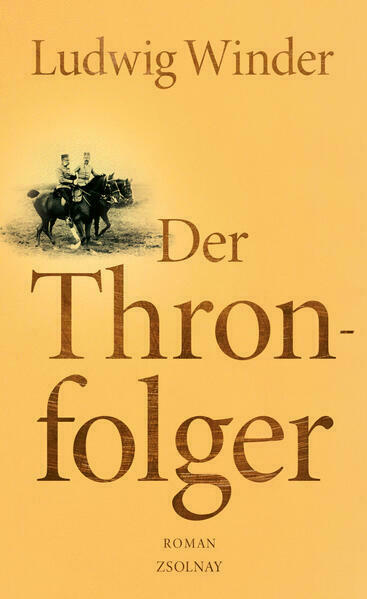Biografie einer sehr unerfreulichen Persönlichkeit
Thomas Leitner in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 9)
Dem Vergessen entrissen: Ludwig Winders Franz-Ferdinand-Roman "Der Thronfolger"
Aus der nicht ansatzweise überblickbaren Flut von Neuerscheinungen, die sich um das Jahr 1914 ranken, kommt einer Wiederveröffentlichung eine herausragende Bedeutung zu. Zsolnay legt ein 1937 in der Schweiz publiziertes Werk von Ludwig Winder neu auf. Für den größten Teil des deutschsprachigen Publikums handelt es sich um eine Erstbegegnung, war doch die Verbreitung des Buches eines jüdischen Autors in Deutschland damals undenkbar; in Österreich wurde es aufgrund des "Traditionsschutzgesetzes", mit dem der Ständestaat vor allem das Andenken an alles Habsburgische unter "Naturschutz" stellte, umgehend verboten.
Ludwig Winder war zu seiner Zeit kein Unbekannter. Ein Vielschreiber, vor allem Theaterkritiker, auch politischer Essayist, wurde er von Max Brod nach Kafkas Tod an dessen Stelle in den "Prager Kreis" aufgenommen. Dass seine Romane inzwischen vergessen sind, verdankt sich in erster Linie den Zeitumständen. Nach dem Überfall auf die Tschechoslowakei wurde er ins Exil nach England vertrieben, wo er 1946 mit nur 57 Jahren starb. Nun kann man endlich eine der hellsichtigsten Analysen einer zentralen Figur der kakanischen Untergangsgeschichte durch einen Zeitgenossen lesen.
Die Form des biografischen Romans macht zunächst skeptisch. Etwaige Bedenken zerstreuen sich jedoch nach wenigen Seiten Lektüre, schnell ist man von der Kombination akribischer Recherche und plastischer Darstellung überzeugt. Dabei macht es einem der Gegenstand des "Thronfolgers" wirklich nicht leicht.
Von einer sympathischen Figur kann bei Franz Ferdinand nicht die Rede sein. Bigotterie, Militarismus, Paranoia und Demokratiefeindlichkeit sind die Komponenten, die zu einem stimmigen System eines autoritären Charakters geschlossen werden. Wie es Winder gelingt, ohne Dämonisierung und Karikatur dieser sehr unerfreulichen Persönlichkeit näherzukommen, zeugt von einem analytischen Apparat, der Seelenkundliches von Freud und Schnitzler aufnimmt. Belastet durch ererbte TBC und psychischen Bürden wie dem manischen dynastischen Ehrgeiz der Mutter wird die Kindheit dargestellt. So werden Züge wie sein Jagd- und Sammeltrieb verständlicher.
Mehr noch fasziniert der soziologische Befund, den Winder seinem unglückseligen Helden in dessen historischer Dimension ausstellt. Bei aller kritischen Schärfe, mit der Franz Ferdinand den lethargischen Zustand des Staatswesens erkannte, das zu übernehmen er sich vorbereitete, und trotz des Strebens, eine neue Elite um sich zu scharen, bleibt es doch höchst unklar, welche Remedia außer Krieg und Unterdrückung er anzubieten gehabt hätte. In Winders Darstellung der Ausweglosigkeit wird die drückende Last der "Allianz von Thron und Altar", die mit Franz Ferdinands wahnhafter Religiosität korrespondiert, überdeutlich.
Nicht um Abrechnung mit dem Vielvölkerstaat, einer vergangenen, unmöglich gewordenen Notwendigkeit, geht es Winder, nicht um einen Nachruf wie bei Joseph Roth, sondern um Orientierung in der eigenen Wirklichkeit, in der die Dämonen des Nationalismus nach der Knebelung durch das Habsburgerreich erst so richtig losgelassen, die Gespenster des politischen Katholizismus nicht besiegt waren und dadurch erst die Fratzen der Faschismen verschiedener Provenienz auftauchen konnten.