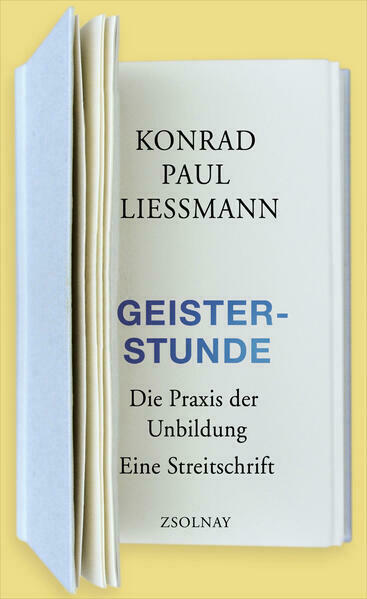Leben statt lernen, Skills statt Kenntnisse?
Matthias Dusini in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 38)
Bildung: Konrad Paul Liessmann liefert einen weiteren interes-santen Betrag zur aktuellen Debatte über Schule und Lernen
Es liest sich gut, was Konrad Paul Liessmann in seinem neuen Buch "Geisterstunde" über die "Praxis der Unbildung", so der Untertitel, zu Papier gebracht hat. Der Wiener Philosoph bereitet auf, was an der aktuellen Debatte über Schulen und Universitäten so nervt: den Mythos des begabten Kindes, den aus dem Ruder laufenden Reformismus und die Aufregung über die alljährliche Pisa-Studie.
Begriffe wie "Bildungsverlierer", "bildungsfern" und "Bildungsprivileg" verstellen den Blick darauf, was Liessmann als die eigentliche Katastrophe beschreibt: "Was heute unter dem Titel Bildung firmiert, ist deren Karikatur, ein Gespenst, das nicht um Mitternacht, sondern zur besten Unterrichtszeit sein Unwesen treibt."
Liessmann kam bereits in seinem Buch "Theorie der Unbildung" (2006) zu einem ähnlichen Befund. Die damals noch relativ neuen Reformen des Bologna-Prozesses haben inzwischen gegriffen und das Bildungssystem verändert. Stätten der Forschung verwandelten sich in Orte der Geschäftigkeit, eines sinnlosen Treibens, wie der Autor befindet. Der eigentliche Motor der Wissenschaften, das Streben nach Wahrheit, werde durch Impact-Faktoren, Zitationsindizes und das Schreiben von Projektanträgen blockiert.
Das alte Ideal selbstdenkender Mündigkeit bleibe schon vorher, beim Besuch der Volks- und Mittelschule, auf der Strecke. Hier treten Kompetenzen an die Stelle von Fähigkeiten. Ein Schweizer Lehrplan brachte es für die Grundschule auf annähernd 4000 Kompetenzen, die entwickelt, geübt, getestet und angewandt werden sollen.
Man kann dem Autor nur zustimmen, wenn er vor der Gefahr der Selbstüberforderung warnt, die diesem pädagogischen Ehrgeiz innewohnt. Lesekompetenz, Lernkompetenz und soziale Kompetenz suggerieren die Messbarkeit von Bildungsstandards, deren Inhalte und Themen verschwimmen. Festgestellt wird nur, dass eine Schülerin kompetent ist, nicht aber, wie kompetent. Skills ersetzen Kenntnisse.
Auch wenn Liessmann sein Buch eine Streitschrift nennt, argumentiert er eher abwägend als zuspitzend. Sein rhetorisches Mittel ist dabei die Antithese. Auf der einen Seite stehen "gespenstische Befunde", auf der anderen Seite Vorschläge für Auswege aus der Misere. "Dabei wäre alles ganz einfach", leitet der Autor seine Ratschläge ein. So gäbe es keinen vernünftigen Grund, den Fächerkanon an höheren Schulen substanziell zu ändern.
Und sei nicht die Selbstdisziplin – diese "gute alte Tugend" – eine Voraussetzung zur Schulung der Urteilskraft? Alles ganz einfach. Mit feiner Klinge seziert der Autor die Figur des Bildungsexperten, über dessen Befähigung meist nur bekannt ist, dass er wisse, was eigentlich zu tun wäre.
Autoren wie Richard David Precht oder Andreas Salcher treten auf den Plan, um dem Bildungssystem den Untergang zu prophezeien. "Der rhetorische Gestus des Bildungsexperten oszilliert zwischen apokalyptischer Warnung, drohend erhobenem Zeigefinger und frohlockender Euphorie angesichts der unglaublichen, aber verborgenen Ressourcen, die er in den Heranwachsenden schlummern sieht."
In diesen Experten sieht Liessmann die Propagandisten eines Erziehungsideals, das Lernen mit Leben verwechselt. Das Dogma des praktisch Anwendbaren verderbe die Lust an einem fernen, möglicherweise auch neugierig machenden Unterrichtsgegenstand wie den antiken Sprachen oder der Philosophie. Hastig räumen Lehrerinnen den Kanon in den Schrank.
Sie haben Angst, sich mit ihrem unnützen Wissen vor den digital natives zu blamieren. Antiautoritäre Pädagogik und Neoliberalismus ergänzten sich im Bemühen, alles nutzbar und messbar zu machen, so der Autor.
Wo Taferlklassler zu Usern werden, killt die App den Apoll. Mit angebrachter Skepsis beschreibt Liessmann den Siegeszug neuer Medien in den Klassenzimmern und Seminarräumen. So sei die Powerpoint-Präsentation oft nur eine Simulation von Wissensvermittlung. "Powerpoint suggeriert, dass nun auch dem geholfen wird, der nichts zu sagen hat."
Liessmanns Spott auf die Bildungsexperten hat nur einen Schönheitsfehler. Tritt er nicht selbst als solcher in Erscheinung? Sein Aufruf zum Einbremsen der Reformen drückt ein "Früher war alles zumindest gleich gut" aus. Seine Kritik verliert ihre Brisanz, wo sie der unübersichtlichen Gegenwart die Vergangenheit des Wahren, Guten und Schönen entgegenhält.
Um es mit den Worten Peter Sloterdijks, eines von Liessmann zitierten Denkers, zu sagen: Ein Gatekeeper verteidigt hier ein Tor, durch das keiner mehr gehen will.
Bildung in der Dauerreformfalle
Barbaba Tóth in FALTER 40/2014 vom 01.10.2014 (S. 19)
Wenn Konrad Paul Liessmann ein Buch mit politischem Anspruch schreibt, wird es immer unterhaltsam. Schließlich gehört er zu den wenigen österreichischen Intellektuellen, die nicht nur scharfsinnigst denken, sondern auch ebenso formulieren können und dabei stets spielerisch und lehrreich bleiben. Schon vor acht Jahren arbeitete sich der Philosoph am bildungspolitischen Mainstream ab (siehe "Wiedergelesen"). Waren ihm damals die Pisa-Studie und die neoliberalen Tendenzen im Bildungssystem zuwider, ärgern ihn heute die Bildungsexperten und die ganze Reformpädagogik mit ihrer "Kompetenzorientierung" in den Schulen, die aus diesen "sozialpädagogische Anstalten" machen. Natürlich ist das alles andere als politisch korrekt und richtig böse, wenn er all den "guten Rousseauisten" entgegenschmettert, dass eben nicht jeder talentiert und kreativ sei und daran können auch Schulen nichts ändern, selbst wenn sie "Lernateliers" werden, in denen sich Lehrer dann "Coaches" nennen und Schüler "Lernpartner".
Richtig nostalgisch bildungsbürgerlich gerät sein Plädoyer für eine Schule, die sich einfach einmal wieder darauf zurückziehe, "die zentralen Erkenntnisse und Ergebnisse von einigen Jahrtausenden menschlichen Strebens nach Wissen zu bündeln, zu systematisieren und zu vermitteln, um überhaupt erst Grundlagen zu schaffen, auf denen sich jene Kreativität und Originalität entfalten können, von denen alle schwärmen". Denn das "Konzept des lebensnahen Lernens befördert das kulturelle Vergessen". Man verzeiht Liessmann solche professoralen Ausritte, die sich inhaltlich wie Aussendungen der ÖVP-Lehrergewerkschaften lesen, weil sie richtig gut geschrieben sind. Eine Streitschrift auf hohem Niveau, auch wenn man anderer Meinung ist.