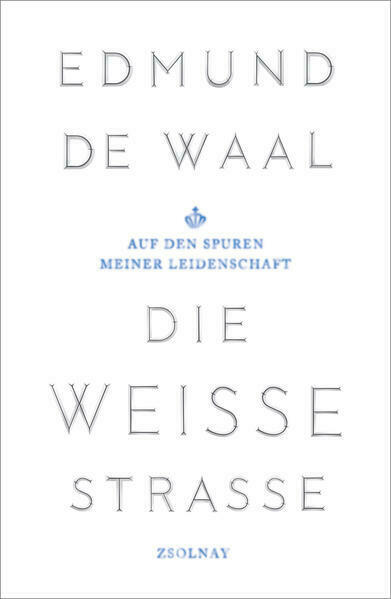Chinaerde und SS-Offiziere mit weißer Glasur
Nicole Scheyerer in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 51)
Kulturgeschichte: In seinem zweiten Buch verknüpft Edmund de Waal seine Passion für Porzellan mit Geschichte
Seit dem Erfolg seines Buchs „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ (2010), in dem Edmund de Waal die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren anhand einer Sammlung von japanischen Schnitzfiguren erzählt, ist der britische Autor und Töpfer weltweit gefragt. Er bestritt prestigeträchtige Ausstellungen in Museen und Galerien, so auch im Wiener Theseustempel.
Das Schreiben hat er dennoch nicht aufgegeben. Leider kann sein nun auf Deutsch vorliegendes Werk „Die weiße Straße. Auf den Spuren meiner Leidenschaft“ mit dem Erstling nicht mithalten.
Kurz gesagt handelt es sich um eine Geschichte des Porzellans mit Elementen der Reisereportage sowie tagebuchartigen und autobiografischen Passagen. Als prinzipielle Struktur dienen de Waal seine „Pilgerfahrten“ zu Orten in China, Deutschland, Cornwall und Amerika, die er „weiße Berge“ nennt, weil dort die für Porzellan notwendigen Minerale entdeckt wurden. Als historisch treibende Kraft schildert er die Sucht nach dem weißen Stoff, die Kaiser und Diktatoren ebenso befiel wie Alchimisten, Naturforscher und Industrielle.
Formal wechselt de Waal gern zwischen erster und dritter Person, sein Stil wirkt oft gehetzt. Er lässt uns an den Geburtswehen des Buches teilhaben, schreibt über unmäßigen Kaffeekonsum und schlaflose Nächte, archivarische Funde und Holzwege. De Waals erste Station im chinesischen Jingdezhen startet anschaulich. Er findet Hügel aus Porzellanscherben und Brennkapseln, über Jahrhunderte von Handwerkern weggeworfen. Leider lässt er sich nur wenig auf den Ort ein und schildert stattdessen, wie er als Schuljunge zu töpfern begann oder zitiert den Jesuiten Père d’Entrecolles, der im frühen 18. Jahrhundert eine Mission in Jingdezhen leitete. Aber wie gelang es den Chinesen, ihr Rezept aus Kaolin und Feldspat über 1000 Jahre geheim zu halten? De Waal gibt keine Antwort darauf.
Dafür fesselt sein Kapitel über den „porzellankranken“ Kurfürsten August den Starken. Als der Sachsenherrscher erfährt, dass der Apothekergehilfe Johann Friedrich Böttger aus Silber Gold erzeugt habe soll, lässt er ihn einsperren und hält ihn acht Jahre gefangen. Dank der Zusammenarbeit mit dem Gelehrten Ehrenfried Walther von Tschirnhaus entdeckt Böttger schließlich die rechte Mischung für „weißes Gold“.
Nach jahrelangen Experimenten wird 1707 eine brauchbare Rezeptur für weißes Hartporzellan notiert. August der Starke eröffnet wenige Jahre darauf in Dresden die unter dem Namen Meißen berühmt gewordene Manufaktur.
Die Entwicklung des Porzellans in England verläuft hingegen unspektakulärer, denn dort tritt ein Unternehmer, der Keramikproduzent Josiah Wedgwood, an die Stelle des absolutistischen Herrschers. Wedgwood zahlt für die Beschaffung von „Chinaerde“ aus dem Gebiet der Cherokee in Amerika, bevor auch in Cornwall die notwendigen Mineralien entdeckt werden.
De Waal reist in die USA und kann dort Reste des silbrigweißen Tons der Indianer finden. Die Cherokees hatten wenig von ihren Bodenschätzen, betont de Waal, und beschreibt das Schicksal der Arbeiter in Wedgwoods Fabriken, denen der Porzellanstaub die Lungen ruinierte.
Die Kluft zwischen Luxus liebenden Hegemonen und den Opfern ihres Kults findet erst im 20. Jahrhundert, in der nationalsozialistischen Manufaktur Allach, ihren Höhepunkt. Heinrich Himmler schenkte Hitler sowie SS- und Wehrmachtsgranden gerne Porzellansoldaten oder -tierchen, die ab 1940 auch im Konzentrationslager Dachau von Gefangenen hergestellt wurden.
De Waals bedeutungsschwangere Fragerei nach der Farbe Weiß wird aber recht banal, wenn er das unbemalte NS-Porzellan mit der Obsession der Nazis für Reinheit erklärt. Zudem ist es im Abschnitt über Allach noch ärgerlicher als im Rest des Buches, dass bibliografische Angaben fehlen.
Das inhaltlich dichte Buch leidet an zu wenig Struktur und zu viel Leidenschaft. Kurze Unterkapitel bewirken statt Lesefluss Häppchenkonsum. Hat de Waals Hang zur Emphase bei seiner Familiensaga noch gepasst, so wäre der Lektor von „Die weiße Straße“ besser auf die Pathos-Bremse gestiegen.