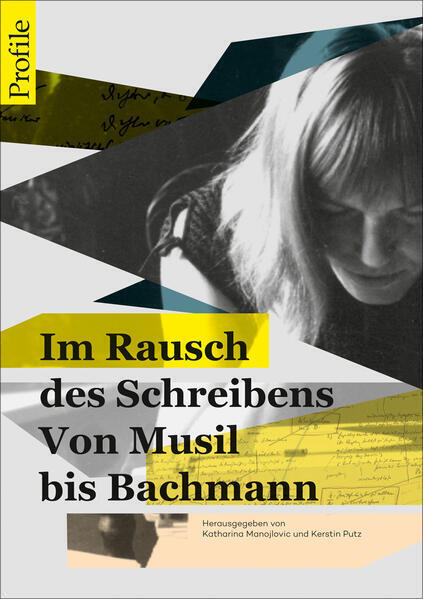Als der Rausch noch geholfen hat
Sebastian Fasthuber in FALTER 26/2017 vom 28.06.2017 (S. 29)
Heute gehen Autoren lieber joggen als saufen. Eine Themenausstellung im Literaturmuseum zeigt, wie frühere Schriftstellergenerationen mit ihren Körpern umgingen
Ein hehres Literaturverständnis sieht Autoren als notwendigen Stachel wider den Zeitgeist. Dass die meisten indes Menschen wie du und ich sind, mit der Zeit gehen und diese widerspiegeln, zeigen die Lebensgewohnheiten und Arbeitsgepflogenheiten der Schriftsteller von heute. Sehr gut lassen sie sich auf Literaturfestivals beobachten. Die besonders Eifrigen und Erfolgreichen, die am Morgen den ersten Zug zur nächsten Lesung erwischen oder einen dringend fälligen Textbeitrag abliefern müssen, verabschieden sich bereits kurz nach ihrer Lesung aufs Zimmer.
Der harte Kern derer, die Barkeeper und Kellner bis weit nach Mitternacht auf Trab halten, wird von Jahr zu Jahr kleiner. Die Wahrscheinlichkeit, einen Dichter nachts durchs Hotel torkeln zu sehen, ist heute weitaus geringer als die, ihm am nächsten Tag schon vor dem Frühstück beim Joggen zu begegnen. Wie in praktisch allen Berufsfeldern sind auch im Literaturgewerbe Produktivität, Maßhalten und Selbstoptimierung angesagt.
Die Anforderungen des Literaturbetriebs haben sich grundlegend verändert. Noch vor 20, 30 Jahren veröffentlichten Autoren einfach ihre Bücher, um danach wieder für ein, zwei Jahre von der Bildfläche zu verschwinden. Heute sind sie Handlungsreisende in eigener Sache, die mit ihren Romanen auf Tour gehen und sie dort promoten. Solche Lesereisen können bisweilen länger dauern als die Tourneen von Rockbands. Andauernde Präsenz ist gefragt. Nach unzähligen Auftritten mit „Es geht uns gut“ sagte Arno Geiger: „Irgendwann hatte ich auch ein Gefühl dafür, warum Popstars Hotelzimmer zertrümmern.“
Wie schnell und gründlich sich Maßstäbe verändern und Gepflogenheiten wandeln können, zeigt die Themenausstellung „Im Rausch des Schreibens“ im Literaturmuseum (siehe Spalte ganz rechts). Schon bei einem flüchtigen Rundgang fällt auf, wie anders frühere Schriftstellergenerationen mit ihren Körpern umzugehen pflegten. Es ist gar nicht lang her, da musste man im Grunde pausenlos eine brennende Zigarette in den Fingern haben, um überhaupt als gestandener Intellektueller durchzugehen.
Nikotinsüchtige Autoren auf Titelblättern, Ernst Jandl mit Zigarette in einem Schulbuch abgebildet – was heute einen Aufschrei nach sich ziehen würde, war einst gang und gäbe, ja sogar ein Zeichen für einen auf Hochtouren arbeitenden Geist.
Im Begleitbuch zur Ausstellung findet sich ein Aufsatz von Uwe Schütte über „Schmauchlümmel“ in der Literatur. Er zeichnet nach, wie eng die Liaison zwischen Rauchen und Schreiben mitunter sein kann: „Sich eine Zigarette anzuzünden ist eine Belohnung dafür, wieder ein paar Zeilen oder gar ein paar Seiten vorwärtsgekommen zu sein. Oder ein Versuch, mit dem Entzünden des Streichholzes jenen inspirierenden Funken zu erzeugen, der eine Schreibblockade endlich zu überwinden hilft.“
Besonders Jandl gehörte zu jenen Autoren, die eine spezielle Atmosphäre erzeugen mussten, um schreiberisch in Fahrt zu kommen. Er arbeitete am liebsten bei dröhnend lautem Jazz, ein kleiner Ausschnitt aus seiner umfangreichen Sammlung ist als Plattenwand in der Ausstellung zu sehen.
Durfte der Jazz ruhig von der etwas freieren Sorte sein, so war der Dichter in seinen Ritualen, die den Schreibprozess begleiteten, ziemlich penibel. Im „selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr, 24. juli 1980“ heißt es: „das glas mit gin tonic (…) fülle er alle 25 minuten und nehme daraus alle 4 bis sieben minuten gerade einen schluck. alle zwölf bis 14 minuten entzünde er eine zigarette. so errichte er die background-struktur für sein heutiges gedicht.“
Komplett gegenteilig sehen die Schreibvorkehrungen bei Jandls langjähriger Gefährtin Friederike Mayröcker aus, die sich jeden Tag frühmorgens bei leiser, klassischer Musik ans Werk macht.
Wenig Glück bescherte das Rauchen Robert Musil. Auch der als hochgeistig bekannte Verfasser des „Manns ohne Eigenschaften“ war letztlich seinem Körper unterworfen. Ein Jahr lang führte er penibel und unter Angabe der Uhrzeit über die von ihm gerauchten Zigaretten Buch. Er sah seine Sucht als eine Qual an, die ihn – neben Kreislaufzusammenbrüchen, Gallenkoliken und anderen gesundheitlichen Problemen – davon abhielt, seinen Roman endlich auf die Zielgerade zu bringen. Bernhard Fetz, der Leiter des Literaturmuseums Wien, ist überzeugt: „Musil fehlte der Zug und Rausch eines zielgerichteten Schreibens. Sein Schreiben war immer zirkulär, deshalb wurde er nie fertig.“
Durch Krankheit und ständige Kuraufenthalte noch beflügelt wurde dagegen Adalbert Stifter. Während es mit seiner Gesundheit stetig bergab ging und obwohl ihm die Ärzte davon abrieten, schrieb der oberösterreichische Dichter und Schulrat in rasanter Manier weiter. In seinen letzten Lebensjahren stiegen die von ihm beschriebenen Blätter und sein Output noch einmal deutlich an.
Interessant an Stifters Fall ist der Gegensatz zwischen den asketischen Figuren und dem Ideal der Mäßigung, die sein Werk prägen, und seinem eigenen, völlig maßlosen Nahrungs- und Getränkekonsum. Während in seiner Literatur alles schön, harmonisch und maßvoll angeordnet war, fraß und soff sich Stifter langsam, aber systematisch zu Tode. „Dann harrt meiner eine ganze Ente“, schreibt er während einer Reise in freudiger Erwartung. „Mich hungert aber jetzt schon so, daß ich glaube, ich esse zwei.“ Selbst auf Kur ließ er sich sein bevorzugtes Bier nachschicken, weil ihm die vor Ort offerierte Sorte kein Quell der Freude war, und sein Jahresbedarf an Wein lag bei 600 Litern.
Rausch und Schreiben lassen sich bei Georg Trakl kaum voneinander trennen. Zeit seines kurzen Lebens konsumierte der Dichter so gut wie alles, was ihm in die Finger kam: Chloroform, Kokain, Veronal, Opium, Äther und Curare. Alkohol allein konnte ihm offenbar nichts mehr anhaben, wie er in einem Brief festhielt: „Ich habe in der letzten Zeit ein Meer von Wein verschlungen, Schnaps und Bier. Nüchtern.“ Als Praktikant in einer Salzburger Apotheke und später als Pharmaziestudent in Wien hatte er leichten Zugang zu allerlei Substanzen. Auch wenn er schreiben wollte, stürzte er sich in ärgste Rauschzustände.
Was er in seinen Drogenvisionen an synästhethischer Wahrnehmung vermittelt bekam, versuchte er danach in Worte zu fassen. Er kannte jedoch keinen Ausgleich. Rauschzustände können als kreative Höhenflüge dienen, um in andere Wirklichkeiten einzutauchen und mit veränderter Wahrnehmung Neues zu beobachten. Der Abschied aus der realen Welt muss aber immer ein befristeter bleiben, irgendwann kommt es unweigerlich zum Comedown. Bei Trakl stellten sich Depressionen ein und er fühlte sich zunehmend vom „infernalischen Chaos von Rhythmen und Bildern bedrängt“. Mit 27 Jahren starb er an einer Überdosis Kokain.
Ständige Dichtheit allein macht noch keinen Dichter. Zwar ist die Literaturgeschichte reich an Säufern, doch haben die wenigsten ihre Werke im Suff niedergeschrieben – oder zumindest waren sie dabei nicht dauerhaft betrunken.
Für die meisten gilt, was Udo Lindenberg einmal als Arbeitsmotto formuliert hat: „Besoffen schreiben, nüchtern gegenlesen.“ Spätestens beim mühseligen Überarbeiten und Korrigieren von Texten wird das Schreiben sehr schnell wieder zur ernüchternden Angelegenheit. Elfriede Gerstl hielt dazu in ihrem poetologischen Gedicht „vom dichten“ fest: „dann ists kein rausch / keine droge / fast arbeit“.
Mehr als von berauschten Autoren hat der Leser ohnehin von berauschenden Texten. Diese Wirkung erzeugte Peter Rosei in dem später auch von Michael Haneke verfilmten Roman „Wer war Edgar Allan?“, einer in Venedig angesiedelten Geschichte über Wahrnehmung und alkohol- und kokaininduzierte Halluzinationen, auf virtuose Weise. Einmal versinkt der Ich-Erzähler in einem wochenlangen Delirium. „Ich verändere mich. Ich brenne“, heißt es gegen Anfang. Später stellen sich paranoide Zustände ein: „Den Siebzehnten machte mich Koks sehr hellhörig. Die ganze Stadt spricht über mich. Wenn das so anhält, werde ich Auftrag geben und fluten lassen.“
Der gegenteilige Trend zu Verzicht und Askese ist freilich keine neue Erfindung. Schon Kafka war dem Diätwahn verfallen und folgte den Thesen des Ernährungsreformers Horace Fletcher, der das minutenlange Kauen und Einspeicheln jedes Bissens Essen und sogar von Flüssigkeiten propagierte. Außerdem forderte dieser seine Jünger dazu auf, ganz auf Fleisch, Kaffee, Tee und Alkohol zu verzichten.
Hier schließt aktuell Kathrin Röggla mit ihrem Buch „Nachtsendung“ an. Protagonist einer Geschichte ist der Alkohol, der sich selbst aus der Welt schafft. Ob wir es erleben werden?