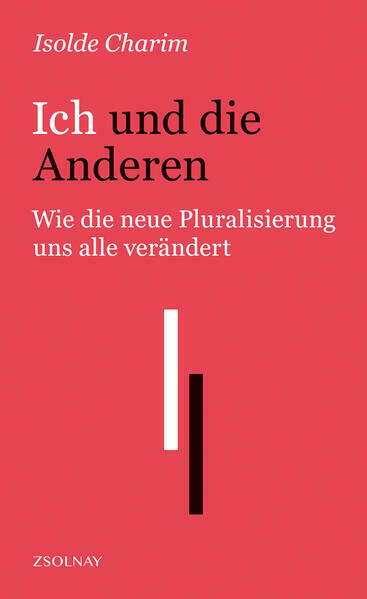Die homogene Gesellschaft ist tot
Matthias Dusini in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 36)
Wurzeln: Isolde Charim untersucht das identitäre Prekariat und forderte eine linke Identitätspolitik ein
Eine gläubige Kommunistin reiste 1939 aus der Sowjetunion nach Paris und fiel dort, durch eine Liebesgeschichte, vom wahren Glauben ab. Die Wiener Philosophin Isolde Charim zitiert Ernst Lubitschs Filmklassiker „Ninotschka“ als Ausgangspunkt einer Betrachtung über die verlorene Verführungskraft des Westens. Der konsumistische Hedonismus US-amerikanischer Prägung gilt nicht länger als überlegene Lebensform, nach der früher alle, die nicht daran teilhatten, strebten. Walzer und Champagner lassen Ninotschka nicht mehr schwach werden.
Charim verweist in „Ich und die Anderen“ auf die 9/11-Attentäter, die in salafistischen Wohngemeinschaften bewusst antiwestlich-asketisch lebten. Kriegsflüchtlinge kämen lediglich aus der Not heraus nach Europa und nicht, weil sie schon immer von der besseren Welt geträumt hätten. Eine breite Front mobilisiere gegen den „schwulen“ Westen, der die alten Werte Männlichkeit und Heldentum zugunsten einer verweichlichten Regenbogenidentität aufgegeben habe. Mit großem Engagement und in wohltuend allürenfreier Sprache beschreibt Charim den zentralen politischen Schauplatz der Gegenwart, den Kampf gegen die pluralistische Gesellschaft.
„Da müsste man nachhaken“, ist eine von Charims Lieblingsformulierungen, Ausdruck eines leidenschaftlichen Interesses an der Gegenwart. Die Autorin hält inne, dreht und wendet das allzu Offensichtliche, um ihm eine neue Bedeutung zu geben. Der Widerspruch ist dabei nie eitler Selbstzweck, sondern ein Plädoyer für eine freie Gesellschaft, in der möglichst viele Selbstentwürfe Platz haben sollen. Charim beschreibt die historische Genese des Pluralismus. Seit der 68er-Bewegung klagen immer mehr Gruppen Anerkennung ein, Frauen, Afroamerikaner, Homosexuelle und Transgender. Mit den alten Formeln des marxistischen Klassenkampfs lässt sich diese Konfliktlinie nicht mehr beschreiben. Anders als im gewohnten Gang emanzipatorischer Bestrebungen bedeutet diese Befreiung nicht, die Merkmale des Andersseins gegen eine Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei aufzugeben.
Jeder bzw. jede habe das Recht, seine Besonderheit beizubehalten. Charim analysiert die Unsicherheit, die damit einhergeht. Keine Nation, Schule oder Partei böte mehr ein Fundament, der feste Boden der Institutionen sei ins Wanken geraten. Daher müssten wir uns selbst ständig unserer eigenen Identität versichern, schreibt Charim. Sie nennt diesen Zustand „identitäres Prekariat“. Die einen begrüßen diese Entwicklung als Fortschritt, die anderen sehnen sich nach der Einheit von Nation, Rasse und Geschlecht zurück. Dieser Riss verlaufe nicht mehr entlang ideologischer Lager, sondern quer durch die Gesellschaft.
Nostalgie gegenüber der guten alten Einheit lehnt Charim als unrealistisch ab: „Es gibt keinen Weg zurück in eine homogene Gesellschaft.“ Sie bezieht sich auf die Populismus-Theorien von Helmut Dubiel oder Jan-Werner Müller, wenn sie der ausschließenden Identitätspolitik widerspricht und das Anderssein im pluralen Sinn verteidigt. Menschen rufen trotzig „Ich bin Muslim“ oder „Ich bin Österreicher“. Diesen „vollen Identitäten“ stellt sie die „nicht-vollen Identitäten“ einer pluralistischen Gesellschaft gegenüber, in der jeder bzw. jede seine Besonderheit ausleben kann, ohne daraus ein Privileg ableiten zu dürfen. Rassisten und Islamisten sind in ihren Augen nicht so sehr Feinde als vielmehr Rivalen.
Viel wurde über Identitätspolitik und religiösen Fundamentalismus geschrieben, Charim formuliert eine Haltung, die auch im Alltag greift. Eine Portion Selbstdistanz sei notwendig, um unsere Identität als nur eine Option unter anderen zu betrachten. Nur so sei ein Leben in der „Begegnungszone“ möglich. Wenn in einer Schulklasse muslimische neben jüdischen und atheistischen Schülern sitzen, ist eine dosierte Identitätsdiät ein wertvolles Werkzeug. Die Argumentation verläuft mitunter sprunghaft, doch ihren Fluchtpunkt, die offene Gesellschaft und ihre Krise, verliert die Autorin nie aus den Augen.
Mitunter würde ein Quäntchen Dialektik die Bewertung zeitgenössischer Phänomene überraschender machen. So steht die Siegerin im Bewerb Andreas Gabalier gegen Conchita Wurst von vornherein fest. Da der nostalgische Rückgriff auf eine „volle“ männliche Identität, dort das spielerische Zeichenverwischen im Geschlechtlichen – ein aufgelegter Elfmeter. Charim macht es sich dennoch nicht einfach.
In der Analyse des Rechtspopulismus etwa widerspricht sie vielen Kommentatoren, die der Meinung sind, ein bisschen Aufklärung und bessere Löhne würden die FPÖ-Wähler wieder zu Sozialdemokraten machen. Die Autorin betrachtet es als Illusion, dass Politik rein nach rationalen Überlegungen funktionieren könne. Der Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit war nicht nur deshalb so erfolgreich, weil er Vermögen umverteilte, sondern weil er Massenloyalität erzeugte. Er bot nicht nur Geld, sondern auch eine Identität, nämlich jene des Bürgers, der soziale Rechte hat. Charim hört empathisch die Brust des politischen Patienten ab und diagnostiziert hellhörig die Misstöne einer gleichzeitig übersteuerten und verunsicherten Gesellschaft.
Sie zeigt Verständnis für das „prekarisierte Weniger-Ich“, das sich etwa in Gestalt des gegen Gender-Theorie und Multikulturalismus protestierenden alten, weißen Mannes zu Wort meldet. Sie beobachtet die Gesichter von Identitätsveteranen, die auf die Diva mit Bart Conchita Wurst mit Ekel reagieren. Wenn die Selbstverständlichkeiten von Natur und Herkunft abhanden kommen, bricht das nicht mehr souveräne Subjekt in Wut aus. „Dieses Beleidigt-Sein ist die Kränkung der pluralisierten Gesellschaft“, schreibt Charim.
In der Vernachlässigung von Emotionen sieht sie ein grundlegendes Problem der Sozialdemokratie. Die ehemalige Arbeiterbewegung sei nicht mehr fähig, ihrer Wählerschaft ein Gefühl von Zugehörigkeit zu vermitteln. Gingen einmal Krankenschutz und Mindestlohn mit Würde und Stolz einher, so hätten sich die Genossen auf die rein ökonomische Seite der Experten und Pragmatiker geschlagen.
Ein linker Populismus, so das Fazit dieses intellektuell prickelnden Essays, kann kein Ausweg sein. Wer Populismus sagt, meint Feindbild, und dieses Gift emotionaler Politik will Charim nicht akzeptieren.
I. Ch. und die Anderen
Matthias Dusini in FALTER 11/2018 vom 14.03.2018 (S. 26)
Die Autorin Isolde Charim gehört zu den führenden Intellektuellen des Landes. Die Person kennen dennoch wenige. Warum?
Es dauert nicht lange, bis Isolde Charim die Stirn runzelt. Alarm schlagen, das klinge so negativ, meint sie in Bezug auf die Kritik an der neuen Regierung. Auch die Bezeichnung „heroisch“ für politischen Widerstand ist ihr nicht recht. Will hier jemand ein berechtigtes Anliegen desavouieren? In den Augenwinkeln sitzt der Schalk, der plötzlich skeptischem Ernst weicht. Es fällt der Philosophin schwer, auf dem Sessel sitzen zu bleiben, die Finger klappern auf dem Kaffeehaustisch. Im Kopf rattern die Rädchen. Provoziert nicht jede Frage eine Vereinfachung?
Seit drei Jahrzehnten gehört Isolde Charim zu den intellektuellen Spitzen der Republik. Im Jahr 2000 organisierte sie auf dem Heldenplatz eine riesige Demonstration gegen die schwarz-blaue Regierung mit. Sie schreibt Kolumnen in der Berliner taz und der Wiener Zeitung und stellt dieser Tage ihr neues Buch vor. Für Rechte ist sie der Inbegriff linken Besserwissertums, auf ihre Kommentare in der konservativen Presse reagierten Leser mit der Zusendung von Klopapier.
Den Namen Charim kennt man zumindest vom Hörensagen. Umso erstaunlicher ist es, dass über ihre Person in den Archiven kaum etwas zu erfahren ist. Der Falter ist die erste Zeitschrift, die ein Porträt der 59-Jährigen zeichnet. Das hat auch damit zu tun, dass Charim nur ungern persönliche Dinge preisgibt, über die Geschichte ihrer Familie schweigt sie lieber.
Charims Eltern stammten aus dem polnischen Galizien, wo das jüdische Leben stark von der deutschen Kultur geprägt war. Alexander Charim (1908–1968) und Blanka Charim (1921–2001) überlebten den Holocaust, fast alle Verwandten wurden ermordet. Die beiden lernten sich in Israel kennen, wo auch Isoldes älterer Bruder, der Anwalt Daniel Charim, auf die Welt kam. Alexander Charim gründete eine deutschsprachige Zeitung, ehe er als Korrespondent für die Tageszeitung Haaretz 1956 nach Wien ging. Drei Jahre später wurde die Tochter geboren.
Anders als andere Kinder von Schoah-Überlebenden hat Charim nie über ihre Eltern geschrieben. „Ich wollte meine Identität nicht zum Thema machen“, sagt sie. Oft genug wurde sie auf ihre Ähnlichkeit mit der Theoretikerin Hannah Arendt (1906–1975) angesprochen. Mit ihren schwarzen Locken und dem strahlenden Blick erinnert Charim tatsächlich an die berühmte Philosophin. Die Schablone „jüdische, politisch engagierte Intellektuelle“ wäre der Karriere förderlich gewesen, aber Charim erschien sie zu billig. Erst spät begann sie Arendts Schriften zu lesen, ein zentraler Begriff ihres neuen Buches ist Arendts Terminus der Pluralität. Während des Studiums mied Charim aus einem ähnlichen Grund reine Frauenseminare. Schließlich dissertierte sie bei einem Professor für Deutschen Idealismus, als einzige Studentin.
„Charim ist wie eine Fräse, die in die verkrusteten Denkmuster der Linken schneidet“, sagt der Berlin Autor und taz-Redakteur Peter Unfried, ein begeisterter Leser ihrer Texte. Im grün-alternativen Milieu der deutschen Hauptstadt sind die Rollen von gut und böse klar verteilt. Bei Charim bekommen nicht nur die notorischen Gegner der Political Correctness ihr Fett ab, sondern auch die allzu rigiden Anwälte von Antirassismus und Antisexismus. Sie schreibt viel über politische Emotionen und Begriffe wie Stolz und Nation, die gemeinhin als Domäne der Rechtspopulisten gelten. Charim zeigt Verständnis für jene, die sich in der pluralistischen Gesellschaft als Verlierer fühlen. „Sie fragt, was ist mit den anderen los, um zu verstehen, was mit uns los ist“, sagt Unfried.
Hannah Arendt fuhr 1961 nach Jerusalem, um über den Prozess gegen den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann zu berichten. Sie schildert einen banalen Durchschnittsbürger, der so gar nicht dem Klischee des monströsen Massenmörders entsprach. Auf ähnliche Weise bricht Charim die Erwartungen der linken Leserschaft. Die Ambiguität oder Mehrdeutigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen ist ihr großes Thema. Die bunte Gesellschaft mit ihrer Vielzahl von Identitäten wird von den einen als Befreiung, von den anderen als Bedrohung erfahren.
So viel Zweifel ist keine gute Voraussetzung für eine Karriere in der Mediengesellschaft. Wenn die deutsche Publizistin Carolin Emcke zur Feder greift, ist klar, dass sie Diversity und Queerness abfeiert. Tritt hingegen Charim in TV-Debatten auf, fällt es schwer, ihren Standpunkt in einem Einzeiler zusammenzufassen.
Statt die FPÖ-Wähler als Nazis zu dämonisieren, schreibt sie Sachen wie: „Zurückgeworfen auf sein prekarisiertes Weniger-Ich, fühlt man sich nicht gehört, unverstanden, entmächtigt.“ Im Internetaktivismus mit seinen giftigen Pfeilen lässt sich damit nicht punkten. Linke Aktivisten greifen gern auf ein antifaschistisches Pathos zurück, wenn sie in ihren Reden die Verhältnisse geißeln. Charim hingegen hört den Gegnern zu. Sie lässt das Schwarzweiß hinter sich, um die Grautöne zu unterscheiden.
Während die deutsche Theorielandschaft noch in den 1980er-Jahren von der Frankfurter Schule und ihrer marxistischen Gesellschaftskritik geprägt war, lasen Charim und ihr Studienkollege Robert Pfaller lieber die Schriften von Louis Althusser. Der französische Denker war stark von der Psychoanalyse beeinflusst und erforschte die Prägungen der Menschen durch Schule, Militär und Familie – „wie sich Macht in Körper einschreibt“, um im Jargon dieser Schule zu sprechen.
Charim, Isolde. Wie kommt eine Tochter von Schoah-Überlebenden zu so einem teutonischen Vornamen? „Nein, meine Eltern waren keine Wagner-Fans“, erklärt Charim. „Es ist viel banaler. Meine eine Großmutter hieß Ida, die andere Zelda. Daraus hat mein Vater Iselda gemacht und das als Isolde ‚übersetzt‘. So kam ich zu diesem schrecklichen Vornamen. Lustig ist nur, wie ich mich nun abkürzen kann: I. Ch.“ Sie und die anderen.
Wer als Jüdin die Kindheit im Nachkriegswien verbracht hat, kennt sich mit den Gesetzen von Ausschluss und Zugehörigkeit aus, mit „vollen Identitäten“, wie Charim sagen würde. „Die Österreicher essen um zwölf Uhr mittags“ hieß es bei den Charims zu Hause, man war andere Essenszeiten gewöhnt. Blanka Charim sagte immer wieder einen Satz, der sich in das Gedächtnis ihrer Tochter eingebrannt hat. „Glaubst du, sie weiß …“ In diesen Worten zittert die Angst der Überlebenden mit. Jede Pensionsvermieterin, jede Gemüsehändlerin könnte eine Bedrohung sein.
Charim bat ihre Mutter, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. So entstand ein Bericht, der das Trauma in literarische Worte fasst und auch humorvolle Passagen enthält. Charims ältester Sohn, der Medizin studiert, hat die Erinnerungen bereits gelesen, sein 16-jähriger Bruder, ein Gymnasiast, noch nicht. Das Schwere und Schwarze der Vergangenheit verscheucht Charim schließlich mit einer Anekdote über ihren Onkel.
Jahrelang suchte Alexander Charim nach seinem Bruder, von dem er annahm, dass er in einem Konzentrationslager umgebracht worden war. Ein gemeinsamer Freund besuchte 1960 ein Kaufhaus am Roten Platz und erkannte den verschollenen Bruder wieder. Isolde Charim beschreibt ihren Onkel als lebenslustigen Menschen, der in den 1920er-Jahren in Paris lebte und dort Josephine Baker tanzen sah. 1989 übersiedelte er aus der Sowjetunion nach Wien und beeindruckte seine Nichte durch seine Jugendlichkeit. Als 90-Jähriger staunte er: „Was, du weißt nicht, wie man skypt?“ Charim trägt die Uhr ihres Onkels, ein sowjetisches Modell mit dem Namen „Sieg über den Faschismus“, am Handgelenk. „Können wir jetzt bitte wieder über etwas anderes sprechen?“
Charims Publikationsliste ist nicht lang. 2001 erschien ihre 1994 abgeschlossene Dissertation unter dem Titel „Der Althusser-Effekt. Entwurf einer Ideologietheorie“ über den französischen Philosophen Louis Althusser. Sie gab mehrere Sammelbände heraus, aber „Ich und die Anderen“ ist das erste Werk, das sich an ein breiteres Publikum richtet. Die Basis dazu legte die Autorin durch eine Radiosendung auf Ö1. Radiomacher Rainer Rosenberg suchte nach einer Philosophin, die sechs Mal eine halbe Stunde lang über eine brennende Frage der Zeit reflektiert.
Im Radiostudio musste Charim sich erst abgewöhnen, mit den Armen zu argumentieren. Allmählich verlor sie die Angst vor dem Mikrofon und schaffte es, ihre Texte so zu lesen, als würde sie frei sprechen. Ihre Betrachtungen über das Leben in einer pluralisierten Gesellschaft waren ein Erfolg und erreichten in der CD-Version mehrere Auflagen. Charim weiß von Hörern, die auf dem Parkplatz im Auto sitzen blieben, um die Sendung zu Ende zu hören.
Theoriestars wie Peter Sloterdijk oder Slavoj Žižek werfen ihre Bücher im Halbjahrestakt auf den Markt. Charim schrieb fünf Jahre an ihrer Dissertation und sitzt mitunter tagelang an einer Kolumne. Der theoretische Hintergrund macht das Lesen ihrer frühen Texte nicht einfach, erst allmählich schrieb sie sich vom Jargon frei. „Jeden Freitag genau 3130 Zeichen abliefern zu müssen ist eine gute Schule“, meint Charim über ihre Tätigkeit für die Wiener Zeitung. Charim schreibt Feuilletons, in die sie Theorie hineinschmuggelt.
Lange Zeit hielt sie ihre Gedanken mit Bleistift auf Papier fest. Sie bezeichnete ihre Kolumnen als Brühwürfel, die gedanklichen Kondensate waren erst in verdünnter Form konsumierbar. Ihrem neuen Buch ist anzumerken, dass es Charim inzwischen gelingt, auf den Punkt zu kommen.
Eine Tätigkeit als wissenschaftliche Kuratorin im Thinktank Kreisky Forum sichert ihr ein Grundeinkommen. Zum Denken und Schreiben zieht sie sich in ihre Wohnung im vierten Bezirk oder in ein Bauernhaus im Kamptal zurück. Ohne Professur und Anstellung ist Charim auf Honorare für Texte, Vorträge und Moderationen angewiesen. „Das ist mühsam, aber auch toll: Jeden Tag denke ich mir, du hast eigentlich ein super Leben.“
Isolde Charim lässt sich gerne Zeit. Der Vater starb früh und die Mutter zog zu ihrem zweiten Mann nach Brüssel. So lebte die Gymnasiastin bereits mit 13 Jahren allein in Wien und wählte zunächst einen sicheren Weg. Charim studierte Jus und schaffte es bis zur ersten Staatsprüfung. Doch dann machte sie die Aufnahmeprüfung fürs Reinhardt-Seminar, um Theaterregie zu studieren. Für die selbstorganisierte Aufführung eines Stücks von Jean Genet bekam sie im Falter eine hymnische Kritik, dennoch hielt es die Studentin nicht lange an der damals verstaubten Theaterschule aus. Der Professor für Theorie dozierte aus einem Heft mit Goethe-Zitaten.
Charim war Ende 20, als sie ihren Verwandten eröffnete, Philosophie studieren zu wollen. „Die dachten sich, aus der wird nie was“, erinnert sich Charim an diese schwierige Phase. Sie zählt sich zu jener Generation, die zwischen den idealistischen 68ern und den pragmatischen Jahrtausendern eine Haltung der Verweigerung kultivierte.
Als sie mit der Philosophie begann, wusste sie, das ist ihre letzte Chance, und sie nutzte sie. Charim war noch nicht mit dem Studium fertig, als sie in Berlin den damals noch unbekannten Slavoj Žižek, Jahrgang 1949, kennenlernte. Den Namen hatte sie schon gelesen. Ist das nicht der von dem handkopierten Theoriefanzine aus Laibach, das in Wien zirkulierte? Das Interesse an einer psychoanalytisch geprägten Ideologiekritik führte die beiden zusammen.
So kam es dazu, dass Charim 1991 die erste deutsche Übersetzung eines Žižek-Buches anfertigte, eine harte Nuss. „Der erhabenste aller Hysteriker“, ein Text über den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, war eine wilde Mischung aus slowenisch gefärbtem Englisch und Französisch.
Dann kam die Stunde der Wahrheit. Im Winter 2000 entschloss sich der Politiker Wolfgang Schüssel (ÖVP) zu einer Koalition mit der rechten FPÖ. Charim arbeitete damals am Thinktank IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) und beschloss, die reine Abstraktion zu verlassen. „Bewegungen sind keine Theorieseminare, sondern Übertreibungen und Emotionen“, meint Charim rückblickend.
Bereits vor der Bildung der neuen Regierung gründeten Charim und der Autor Robert Misik, der damals ihr Lebensgefährte war, sowie der Schriftsteller Doron Rabinovici die Plattform Demokratische Offensive. Als dann Anfang 2000 die Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Regierungsbeteiligung einer teilweise rechtsextremen Partei zu demonstrieren, liefen bei Charim und Misik zu Hause die Fäden zusammen.
Am Küchentisch diskutierten Studenten über Hegemonie, in den Zigarettenpausen zog sich Frau Professor zurück, um ihren Sohn zu stillen. Im Februar 2000 schließlich rief die Demokratische Offensive zu einer Demonstration auf dem Heldenplatz auf, an der rund 300.000 Menschen teilnahmen. Es war eines der letzten starken Zeichen der Zivilgesellschaft.
Was damals als Tabubruch empfunden wurde, ist heute Normalität. In mehreren europäischen Staaten sitzen Rechtsextreme in der Regierung, Jörg Haiders halbseidene Truppe verwandelte sich in eine straff organisierte Partei. Charim reagiert darauf nicht mit der für viele Linke typischen Moll-Tonart. Bei ihr ist das Glas halb voll, nicht halb leer. Nur nicht jammern, weiter geht’s. Isolde Charim blickt auf die Uhr. Die Sieg über den Faschismus tickt.