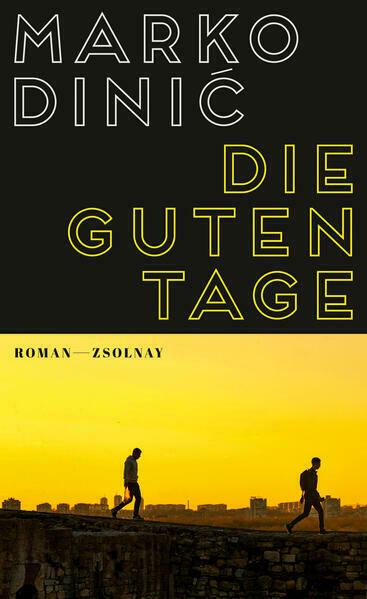Hart und weich zugleich
Sebastian Fasthuber in FALTER 9/2019 vom 27.02.2019 (S. 35)
Mit „Die guten Tage“ legt Marko Dinić einen starken Roman über die Folgen von zu viel Nationalismus vor
Die Oma ist gestorben. Lange hat er Belgrad gemieden, nun steigt ein junger Mann Ende 20 in Wien in den Bus und begibt sich auf eine Reise zurück in die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird er den verhassten Vater wieder treffen. Unterwegs rekapituliert er seine eigene Kindheit und Jugend: „Ich liebte Milošević. Ich liebte ihn, weil mein Vater, der Trottel, ihn auch liebte.“
Der in Wien lebende und auf Deutsch schreibende Serbe Marko Dinić hat eine balkanische Road Novel geschrieben, die am Vienna International Busterminal in Erdberg beginnt und in einem Randviertel von Belgrad endet. Das Unterwegssein im Bus als Nicht-Ort dient darin als Metapher für eine rastlose Form von Heimatlosigkeit. Viele Passagiere sind Gastarbeiter, die nie zu Österreichern wurden. Sie haben sich am Bau krumm gearbeitet, nun würden sie ihre Pension gern in der alten Heimat genießen. Nur gehören sie dort auch nicht mehr dazu. Dinić geht es ähnlich. In Österreich ist er der „Jugo“, in Serbien gilt er als „Schwabo“. Er kann überall ein bisschen andocken, aber nirgendwo ganz – für einen Schriftsteller gibt es kaum eine günstigere Position, um die Welt zu beobachten und sich einen Reim darauf zu machen.
In einer früheren Fassung des Romans fuhr sein Erzähler mit dem Zug nach Serbien. Irgendwann beschlich den Autor das Gefühl, dass das nicht stimmig war: „Es konnte nur ein Bus sein. Ich bin ja selber in diesen Bussen aufgewachsen. Vor zehn Jahren habe ich einmal ausgerechnet, dass ich darin schon eineinhalb Mal um die Erde gefahren bin.“ Vielleicht ist es kein Zufall, dass Dinić sich für das Treffen mit dem Café Rathaus einen Ort ausgesucht hat, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint und sich gar nichts bewegt.
Vor fast genau 20 Jahren, im Frühjahr 1999, flog die Nato während des Kosovokrieges Luftangriffe gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien, deren Präsident Slobodan Milošević war. Im Zuge der zu einem Großteil von der US Air Force ausgeführten Militäroperation wurde auch Belgrad bombardiert. Marko Dinić war damals ein Kind. Zehn Jahre später begann er intensiver über diese Zeit, den Krieg und Nationalismus nachzudenken: „Ich habe mich gefragt, was überhaupt passiert ist, wollte Worte dafür finden. Parallel dazu bin ich nach Österreich umgezogen. Der Ortswechsel und die intensive Beschäftigung mit Literatur und mit der deutschen Sprache hingen zusammen.“
In Salzburg studierte er Germanistik sowie jüdische Kulturgeschichte und begann über einem Buch über das Aufwachsen in Serbien zu brüten. Er kommt von der Lyrik und hat sich über Kurzgeschichten langsam den Weg zum Roman geebnet. Es war ein langer Prozess, erste Notizen entstanden 2012, Anfang 2017 war das Buch fertig. Dass er es auf Deutsch schreiben würde, war indes von Anfang an klar. Es ist seine Schrift- und Literatursprache, sein Serbokroatisch beschreibt er als „sehr gefärbtes Belgraderisch“. Diese forcierte Fäkalsprache versucht er in einigen Passagen des Buches auf Deutsch nachzuahmen.
Nicht nur auf den Straßen und in den Kneipen von Belgrad geht es hoch her. Auch im Bus bildet sich schnell eine klare Hackordnung mit einem Anführer, der wilde Reden schwingt und frauenverachtende Witze erzählt: „Er bestimmte die Musik, die Videos, die Gesprächsthemen. Er fraß das Essen der anderen und soff deren Bier aus. (…) Ein Bus in der Einöde als Abziehbild des ehemaligen Jugoslawien – so gesehen hatte sich nichts verändert.“
„Die guten Tage“ ist ein Debüt, das mit einem Stampfen auftritt. Trotz großer Gesten und mitunter derber Sprache betreibt Dinić jedoch keine literarische Kraftmeierei und betreibt auch kein Schwarz-Weiß-Denken. In Grauschattierungen fühlt er sich am wohlsten. Er schreibt hart und weich zugleich, beherrscht mehrere Tonlagen und spielt sie zuweilen sogar parallel.
Sein Protagonist kann in grober Manier über den Vater, einen kleinkarierten Beamten, Wendehals und Nationalisten, herziehen und damit gleichzeitig seine eigenen Gefühlsregungen bis in feinste Details offenlegen. Auch er ist kein Held: Als der Erzeuger ihm beim Wiedersehen nicht nur älter, sondern auch merklich etwas weiser entgegentritt, reagiert er regelrecht enttäuscht. Ohne den Hass auf den Vater fällt der Sohn in sich zusammen.
Als bizarrer Spiritus Rector des Romans dient der Sitznachbar im Bus. Dieser weist sich als arbeitsloser Elektriker aus, hat schlechte Zähle und verfällt in irre Lachkrämpfe. Nicht in dieses Bild passt, dass er wie ein Privatgelehrter spricht und dem Erzähler im richtigen Moment die richtigen Fragen stellt. Es sind jene, die ihn zum Nachdenken über seine Familie und über sich selbst zwingen: „Nun, Ihr Vater ist ein Schwein. Und weiter?“ Oder: „Worin besteht die Schuld Ihrer Eltern?“
Glaubt man dem Erzähler, dann besteht die Generation der Väter in Serbien fast ausnahmslos aus Kriegsverbrechern und Frauenschändern, die versucht haben, ihren Kindern ebenfalls das Gift des Nationalismus einzuimpfen. Jene Nachkommen, die im Land geblieben sind, haben sich folglich zu gekrümmten Existenzen entwickelt. Er selbst, der mit Unterstützung der Großmutter vor dem Einfluss des Vaters nach Wien floh, kam auch nicht ganz unbeschadet davon. Aber er ist immerhin unterwegs.
Marko Dinić hat einen vielschichtigen Roman und ein wichtiges Buch über Europa und Nationalismus geschrieben. Gleichzeitig verrät „Die guten Tage“ nicht alles, Fragen in der Familiengeschichte bleiben offen, vieles ließe sich noch ausbauen. Dieses Debüt schreit nach einer Fortsetzung.