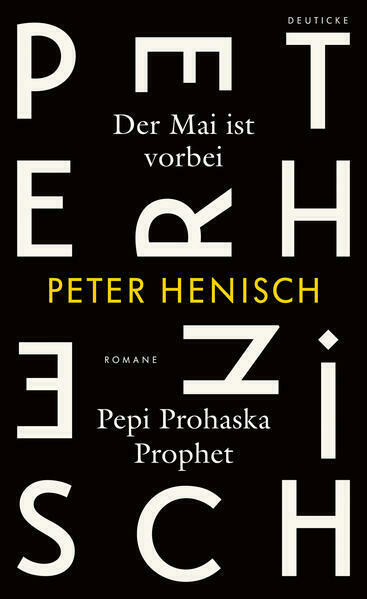„Freie Liebe war sehr schwierig“
Gerhard Stöger in FALTER 17/2018 vom 25.04.2018 (S. 30)
Der Wiener Autor Peter Henisch wird 75, gibt ein Konzert als Bluessänger und spricht über sein 1968, Sebastian Kurz und den letzten Sozialisten
Peter Henisch ist unschlüssig. Ob er einen Tee bestellen soll? Oder doch schon ein Bier, jetzt um 14.30 Uhr an diesem kalten Märztag im Café Schopenhauer im 18. Bezirk? Er wählt Tee. Welchen? Die nächste Entscheidungsfrage. „Na, einen warmen“, murmelt er, präzisiert dann aber: „Einen Schwarztee mit Rum, jetzt wiss ma’s!“
Henisch feiert im August seinen 75. Geburtstag. Seit den 1970er-Jahren ist er ein bekannter Schriftsteller, zu Beginn seiner Karriere war er mit der Gruppe Wiener Fleisch & Blut aber auch als Musiker aktiv. Der Anlass für das Gespräch ist die CD „Blues plus“, sein zweites Werk als Sänger, die Henisch am 26. April beim Festival Vienna Blues Spring im Haus der Musik präsentiert.
Der Vorgänger „Alles in Ordnung“ ist 1975 erschienen – und wurde vom deutschen Rolling Stone vergangenen Sommer als eines der „100 besten Alben (die keiner kennt)“ gewürdigt. „Mürbe und melancholisch, wie ein proletarischer, wienerischer Leonard Cohen“, hieß es da.
Falter: Herr Henisch, wie war es für Sie, nach Jahrzehnten wieder zu singen?
Peter Henisch: Tatsächlich habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt noch kann. Dann hatte ich aber gleich bei der Arbeit an der ersten Nummer das Gefühl: Schau, schau, das trägt mich und das fährt! Die Aufnahme hat mir große Freude gemacht. Freude, nicht Spaß, denn Spaß mag ich nicht.
43 Jahre zwischen zwei Platten sind eine rekordverdächtige Pause. Warum haben Sie in den 70ern nicht auch als Sänger weitergemacht?
Henisch: „Alles in Ordnung“ ist ungefähr zur selben Zeit herausgekommen wie „Die kleine Figur meines Vaters“, mein Durchbruch als Autor. Von da an war klar, dass die Literatur der Weg ist, den ich weitergehen will. Es gab auch kein Netzwerk, das sich besonders für meine Musik engagiert hätte, deshalb ist sie ein Geheimtipp geblieben.
1975 stand der Austropop kreativ in voller Blüte. „Alles in Ordnung“ hätte eigentlich gut dazu gepasst: eingänge Lieder im Wiener Dialekt, poetisch, anspruchsvoll, aber nicht verstiegen.
Henisch: Bei aller Wertschätzung für Ambros und die anderen Pioniere: Ich wollte eigentlich kein Austropopper werden. Ein paar Mal bin ich bei Fernsehgeschichten mit diesen Herrschaften in Zusammenhang gebracht worden, auch mit dem Heller natürlich, aber ich war nie in diesem Freundeskreis und bin vielleicht ein radikaler Einzelgänger. Das hat meiner Karriere als Singer/Songwriter nicht gutgetan, aber es hat mich auch nicht gereizt, da weiterzumachen, als ich die weitere Entwicklung des Austropop beobachtet habe. So wäre ich nicht gerne geworden.
Wie meinen Sie das?
Henisch: Na ja, dass man sich immer wiederholt und nach teilweise wirklich großartigen Anfängen eigentlich immer seichter wird. Es ist zwar auch Interessantes gekommen, der Danzer hat schöne Sachen gemacht. Aber traurig war ich nicht, dass ich in diesem Strom nicht mitgeschwommen bin.
In den 70ern haben Sie auch keine Verwandtschaft zu Künstlern wie Ambros und Danzer gesehen?
Henisch: Es war mir auf Dauer zu parodistisch. Es gibt diese von Artmann herrührende sprachliche Tradition, „med ana schwoazzn dintn“ und so, die ja sehr ehrenwert ist, das Wienerische im Grunde aber doch verzerrt. Wenn man jetzt den Voodoo Jürgens hört oder als man den großartigen Karl Merkatz als „Mundl“ im Fernsehen gesehen hat, ist das immer eine gewisse Verzerrung des Wienerischen. So reden die Leute eigentlich nicht und so singen sie auch nicht.
Meinen Sie mit Verzerrung eine Übertreibung?
Henisch: Eine Übertreibung, die bei der Wiener Gruppe vielleicht eine gewisse Originalität gehabt hat, auf Dauer aber ein bisschen fad wird.
Sie haben sich nicht als Liedermacher, sondern als Bluessänger verstanden. Wann ist der Blues in Ihr Leben getreten?
Henisch: Ich habe mir mit 18 eine mittelgroße Schallplatte gekauft. Darauf war eine Nummer von Mose Allison, „Young Man Blues“. Die hat mir sehr, sehr imponiert, und dieses Blues-Feeling hat mich sofort gepackt: „Oh well a young man / ain’t nothing in the world these days.“ Ich habe es später ins Wienerische übersetzt und würde es jetzt gerne wieder singen, nur stimmt der Text nicht mehr. Ich müsste auf ganz andere Weise daran anknüpfen und fragen: Pass auf, wie ist das jetzt mit den smarten jungen Männern, die uns zum Teil fürchterlich auf die Eier gehen?
Rockmusik hat Sie weniger geprägt?
Henisch: Jim Morrison war ganz wichtig, wobei ich den aber erst mit knapp 30 für mich entdeckt habe. Eines Nachts war da eine Stimme, die mich sehr angesprochen hat. „When the music’s over“ hat die gesungen und vom Schrei des Schmetterlings. Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen eingetrübt, aber ich habe in diesem Moment realisiert, dass das dieser Sänger ist, der gerade erst gestorben ist – aber das Album hieß „Absolutely Live“, das hat mich fasziniert. Die großen Inszenierungen der Doors finde ich heute noch atemberaubend.
In den Sixties gab es eine Vielzahl außergewöhnlicher Rockstars. Wodurch sticht Morrison heraus?
Henisch: Mich hat er vielleicht von seiner Mentalität her angesprochen. Wir sind jedenfalls derselbe Jahrgang. 1943 war ein guter Jahrgang.
Waren Sie selbst ein angry young man?
Henisch: Es gab da schon eine Verbundenheit, wobei der Herr Morrison natürlich ein ganz anderes Leben geführt hat. Beim Schreiben des Romans „Morrisons Versteck“ konnte ich mich Jahre später ganz gut in seine Haut versetzen. Das Buch ist ja auch eine Parodie auf die Existenz eines Rockstars, der nicht sterben darf. Wo die Leute ans Grab pilgern und „Jim is alive“ hinschreiben. Mich hat Jim Morrison jedenfalls viel mehr angesprochen als Elvis Presley. Der ist mir nie unter die Haut gegangen.
Wie war es mit Dylan?
Henisch: Den habe ich fast nie verstanden, Cohen war mir viel näher. Er ist auch als Poet großartig, seine Romane habe ich mit großer Freude gelesen. Er war so etwas wie ein Wahlonkel. Oder ein Cousin.
Sie hätten also eher ihm als Dylan den Nobelpreis verliehen?
Henisch: Vermutlich ist es Cohen gegangen wie Friederike Mayröcker, als die Jelinek den Nobelpreis bekommen hat. Sie hat sich gedacht: „Eigentlich hätte ihn doch ich kriegen sollen!“ Cohen war in einer ähnlichen Situation, dann hat ihn Gott aber hinweggenommen, bevor Trump gewählt wurde. Das war eigentlich schön von Gott, zu dem Cohen ja eine gewisse Beziehung hatte, er war ihm ein Gesprächspartner.
Wie haben Sie das Wien der mittleren 70er-Jahre in Erinnerung?
Henisch: Das Jahr 1968 hat bei uns ja tatsächlich erst ein bisschen später eine gewisse Breitenwirkung entwickelt, Mitte der 70er war es aber voll da. „Alternativ“ war kein Schimpfwort und viele Leute haben versucht, alternativ zu leben, zu schreiben und zu singen.
Dabei hört man oft, in Wien sei damals alles grau in grau gewesen.
Henisch: Das ist ein Blödsinn, der nicht einmal auf die 50er-Jahre zutrifft. Natürlich war es anders, aber nur weil es noch keine Beisln am Donaukanal gegeben hat, war es ja nicht fad! Es gab alternative Lokale noch und noch, sie waren nur ein bisschen grindiger als die jetzigen. Und nicht so kommerziell. Quantitativ gibt es heute natürlich mehr, alles steht im Internet, dadurch kennt es jeder. Damals gab es manches, das nicht jeder wusste, und das war besser.
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an das mythenumrankte Jahr 1968 denken?
Henisch: Ich habe ein Buch über das 68er-Jahr in Wien geschrieben, das heuer neu aufgelegt wird: „Der Mai ist vorbei“. Entstanden ist es zehn Jahre danach.
Der Nino aus Wien hat „Simple Twist of Fate“ von Dylan wunderbar ins Deutsche übertragen, der Song heißt bei ihm ebenfalls „Der Mai ist vorbei“.
Henisch: Na schau, und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Na ja, so bin ich. Aber ich höre „Die Kunst der Fuge“ in vielen Variationen eben auch mehr als die Wiener Popmusik. Der Nino aus Wien ist wahrscheinlich schon ganz gut, aber da besteht für mich auch das Dylan-Problem: Er ist nicht leicht zu verstehen. Im Unterschied zu Wanda. Die kann ich hören, und ich kapiere, was der singt.
Sind die nicht fast zu leicht zu verstehen?
Henisch: Vielleicht, aber das sind halt verschiedene Zugänge. Die „Amore“-Nummer ist schon super. Und nicht nur die.
Auch der Wanda-Sänger schätzt Jim Morrison und die Doors sehr. Aber zurück ins Jahr 1968.
Henisch: Der früh verstorbene Poet Christian Ide Hintze hat gesagt: Es gibt einen Kältestrom und einen Wärmestrom, der vom 68er-Jahr ausgeht. Dieses Bild finde ich sehr schön. Dem Wärmestrom fühle ich mich nach wie vor verbunden. Wenn aber allerweil wieder die Geschichte dieser Aktion im Hörsaal eins erzählt wird, weil das angeblich das 68er-Jahr in Wien war, kann ich nur sagen: So ein Scheiß!
Im wahrsten Sinne des Wortes – die Aktion „Kunst und Revolution“ von Günter Brus, Otto Muehl, Peter Weibel und Oswald Wiener ist als „Uni-Ferkelei“ in die Geschichtsbücher eingegangen.
Henisch: Mit der 68er-Bewegung hatte das doch überhaupt nichts zu tun. Es war nur dazu angetan, diese Bewegung in den Augen der braven Bürger zu dem zu machen, was sich die ohnedies darunter vorgestellt hatten. Aber das war doch ein Zerrbild. 68 und die Bewegung davor, das war in Wien zum Beispiel der Rolf Schwendter, ein Mann, der emsig daran gearbeitet hat, die Alternativbewegung nicht nur zu inspirieren, sondern auch zu dokumentieren. Handschriftlich hat er seit den frühen 60er-Jahren Einladungen an den Freundeskreis geschrieben, er hat Seminare veranstaltet, einmal zu James Joyce, dann wieder zum Krautfleckerlkochen oder Nacktbaden. Das war für mich 1968, und es gab viel Derartiges. Verfehlungen gab es allerdings auch viele. Wir haben selbst eine begangen.
Wir?
Henisch: Das Ehepaar Zenker und das Ehepaar Henisch.
Helmut Zenker, der spätere „Kottan“-Autor?
Henisch: Ja. Wir haben versucht, in einer Wohngemeinschaft miteinander zu leben, aber nach zwei Monaten waren unsere Beziehungen völlig kaputt. Es ist nichts Gescheites dabei herausgekommen, was in „Der Mai ist vorbei“ auch ein bisschen thematisiert wird. Es gab zu dieser Zeit Leute, die sich unglaublich wichtig gemacht haben, selbsternannte Kommunen-Experten. Autoritäre Typen noch und noch, die sich antiautoritär geriert haben. Tatsächlich waren es nur Machos, die nichts anderes wollten, als unter ideologischen Vorwänden möglichst viele Frauen pudern. Von wegen: „Du kannst mich nicht leiden, das heißt aber eigentlich, dass du mit mir vögeln willst.“
Nach „Wärmestrom“ klingt das nicht gerade.
Henisch: Es war trotzdem etwas Richtiges dran, auch an diesem großen Befreiungsversuch. „We Shall Overcome“, dieses Lied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, das natürlich einen viel ernsteren Hintergrund hat, war für uns ein Leiblied. Rolf Schwendter hat es ins Wienerische übersetzt und zur Kindertrommel „Wia weans scho dapockn“ gesungen. Das hoffe ich nach wie vor. Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo man sich denkt: Wahnsinn – was ist da passiert?
Was ist tatsächlich passiert – und wann?
Henisch: Na ja, in den 80er-Jahren ist es passiert, wo die Manager an die Macht gekommen sind. Jungspunde damals auch, die gesagt haben: Wir machen jetzt alles anders. Humanität, Menschenrechte, diese ganze schöne Idee, dass die Welt freundlicher werden könnte, wurde in der Folge als „Gutmenschentum“ verunglimpft. Wenn ich spüre, wie fremd Funktionären angeblich christlicher oder sozialdemokratischer Parteien so etwas wie Nächstenliebe oder Solidarität ist, frage ich mich, wie die überhaupt den Mund aufmachen können, ohne sich tief in den Boden hinein zu genieren. Der einzige Sozialist und Christ, der übrig geblieben ist, ist der Papst.
Tatsächlich?
Henisch: Na klar. Für Leute, die sich „bürgerlich“ nennen, ist der Papst schon fast ein Kommunist. Ich habe große Hochachtung vor ihm. Wenn ich dann höre, dass dieses kleine Arschloch Kurz von der Audienz zurückkommt und einzig und alleine zu berichten hat, dass der Papst Verständnis für unsere Fremdenpolitik habe, denke ich mir: Den Kurz soll der Blitz beim Scheißen treffen!
Na servas, ob wir das drucken können?
Henisch: Warum, weil ich schuld bin, wenn es eintritt? In meiner Zeit als Autostopper war ich im Iran, noch unterm Schah. Ich konnte überhaupt kein Farsi und habe eine Zeitlang bei einer Familie gewohnt, die mir alle möglichen persische Flüche beigebracht hat. Einer davon heißt „Ein Blitz soll deinen Gipfel treffen“. Ich habe zuerst „Ein Blick soll dein Kipfel treffen“ verstanden. Das wäre natürlich auch blöd, wenn man gerade beim Frühstück sitzt … Die wienerische Übersetzung davon ist aber „Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen“.
Was speziell stört Sie an Sebastian Kurz?
Henisch: Er ist der Heuchelprinz, es stimmt doch alles nicht, was er erzählt. Und wie kann man bitte sehenden Auges solche Partner in die Regierung nehmen und dann „für mich ist das Strafgesetz die Grenze“ sagen? Ist er so blöd? Wahrscheinlich nicht. Also ist er so gewissenlos. Die Rolle des Über-Schüssel, dass er jetzt noch besser schweigt als dieses Aas, ist wirklich zum Kotzen.
Die Umfragewerte geben ihm recht.
Henisch: „Wir nehmen den Fremden da und dort noch etwas weg“, sagt die türkis-blaue Partie, daraus wird eine Schlagzeile und schon ist alles super. Das Schüren von Ressentiments gab es auch früher, aber jetzt ist es noch viel ärger: Dieser Geifer, der sich im Internet ergießt, wird durch jedes zweite Wort gefördert, das dieser Schweigekanzler nicht spricht. Taktisch verstehe ich ihn schon, aber mir ist das halt von Kopf bis Fuß nicht nur unsympathisch, sondern ich finde das auch katastrophal für die Mentalitätsentwicklung der österreichischen Bevölkerung.
Wie wird es weitergehen?
Henisch: Wenn man hört, was die Leute etwa über das Schicksal der Flüchtlinge im Mittelmeer reden, wird klar, dass schon längst eine faschistoide Entwicklung in Gang gesetzt wurde. Es ist aber ein Unterschied, ob das von oben bestätigt und sogar gutgeheißen wird oder ob man etwas dagegen sagt. Leider haben das auch die Sozis verabsäumt, sie sind in den letzten Jahren nur mehr hinter denen her gehechelt. Ich bin seit Jahren viel in Italien, und dort hat Berlusconi die Mentalität einer ganzen Generation ruiniert und so beeinflusst, dass viele Junge seinen Schmarren glauben.
Diese Gefahr sehen Sie auch bei uns?
Henisch: Die Verantwortung einer Regierung besteht nicht darin, ein Nulldefizit zu erreichen, sondern sie besteht darin, ein Beispiel zu geben, den Leuten vielleicht auch Wege zu weisen und zu sagen, woran man glaubt. Der Letzte, der das in Österreich konnte, war Kreisky. Spricht man heute von moralischer Verantwortung, wird man nur mehr ausgelacht. Die gegenwärtig Regierenden sind himmelschreiend verantwortungslos.
Reisen wir noch einmal zurück in die Zeit vor Bruno Kreiskys Kanzlerschaft, als Sie Ihren antibürgerlichen WG-Versuch unternommen haben. Woran ist der denn so schnell gescheitert?
Henisch: Das hatte ganz banale Gründe. Helmut Zenker hat eine Wohnung in der Rauscherstraße bekommen, aus der seine Eltern ausgezogen sind. Allerdings unter einer Bedingung: Die Oma musste drin bleiben. Das hat er anfangs gar nicht erwähnt, sondern nur von der Fünf-Zimmer-Wohnung gesprochen, mit der wir doch etwas machen könnten. Meine Exfrau Sonja und ich hatten eine recht schöne Sozialbauwohnung im zehnten Bezirk, aber wir wollten halt auch etwas Alternatives machen, dem Zeitgeist entsprechend. Also sind wir da hingezogen.
Klingt doch gut.
Henisch: Die Zenkers hatten ein Baby, was auch nicht ganz einfach war, und die Oma ist der Entfaltung der Alternativkultur ein wenig im Wege gestanden, unter anderem auch, als sich zwischen uns gewisse sexuelle Interaktionen ergeben haben. Einmal wollten meine Frau und ich endlich wieder miteinander schlafen, zur Versöhnung. Nur konnte man sich dort nicht intim zurückziehen. Wir haben es trotzdem probiert, aber dann kam die Oma, setzte sich neben uns aufs Bett und erzählte, wozu das alles führen wird, diese Promiskuität und so weiter. Sie hatte im Triestingtal nämlich ein Frau gekannt, die irgendwie gesündigt und dann junge Hunde geboren hat. Aufbauend war das nicht gerade.
Ihre kleine private 68er-Utopie ist also an der Zenker-Oma gescheitert?
Henisch: Dann hat das Baby wieder geschrien und man hat es im Teamwork gewickelt, weil man zeigen musste, dass man kein Macho ist und nicht nur die Frauen bügeln und wickeln lässt. Ich habe mich binnen kurzem als sehr bürgerlich erwiesen, weil ich den Wunsch hatte, mir den Bart mit einer Serviette und nicht mit dem Handrücken abzuwischen. Oder ich wollte ein Bier zum Mittagessen trinken, es gab aber nur Saft. So hat sich beim Zusammenleben schnell herausgestellt, dass wir doch sehr verschiedene Bedürfnisse und Gewohnheiten haben. Und dann gab es natürlich Konkurrenzverhältnisse.
Zwischen den Autoren Zenker und Henisch?
Henisch: Es gab Auseinandersetzungen, die ideologisch geführt wurden, aber im Grund genommen auch sehr viel damit zu tun hatten, dass wir einander sexuell in die Quere gekommen sind. Da gibt es eine Konkurrenz, und das hat nicht gutgetan. Dann war ich auf einmal der große Bürgerliche. Vor allen Dingen habe ich den Fehler gemacht, eine Kolumne in der Presse zu schreiben. Die anderen hätten das eh auch gerne gemacht, nur hat die halt keiner gefragt. Mit unserem guten Einvernehmen war es dann bald aus.
Die freie Liebe war eine schwierige Sache?
Henisch: Freie Liebe war sehr schwierig, ja. Vor allem, wenn dauernd irgendwelche Leute da sind, die dabei stören. Wir hatten dann noch ein Sorgenkind, den Friedemann, das war ein alter Freund aus meiner Kindheit. Jahre später, als die Zenkers und Henischs angefangen haben, die Literaturzeitschrift Wespennest zu machen, ist er plötzlich wieder in meinem Leben aufgetaucht. Mir wurde gesagt, ihm geht’s so schlecht, er war auf der Psychiatrie, und ich habe ihm geschrieben: „Lieber Friedemann, wenn du eine Ansprache brauchst, dann rühr dich.“
Und er hat sich gerührt?
Henisch: Tatsächlich war er sehr schnell da, genau zu der Zeit, als wir die Wohngemeinschaftsidee entwickelt haben. Friedemann war dafür auch ein Kandidat, aber er hat vor allen Dingen freie Liebe und Gruppensex im Kopf gehabt, denn da gab es zwei Frauen: die Christl Zenker und die Sonja Henisch. Beide haben ihm gut gefallen, und irgendwie hat sich dann einmal die Christl erbarmt und die Sonja nicht – solche Sachen. Hat man dann gesagt, dass das so nicht passt, war es auch nicht gut, weil es gleich wieder als bürgerlich gegolten hat. Helmut Zenker hat das überhaupt nicht gut gepackt, aber er hat es zähneknirschend akzeptiert. Aber ich glaube, das führt etwas zu sehr in Bereiche, die zum Tratsch ausarten.
Im Gegenteil, es ist sehr spannend, von diesen Schattenseiten damaliger alternativer Lebensentwürfe zu erfahren.
Henisch: Uns ist es ziemlich bald misslungen. Zwei Amerikaner waren noch beteiligt. Einer hat sich in diese WG-Geschichte reinfallen lassen und mitgemacht, der andere hat immer nur „it’s amazing!“ gesagt, was gruppendynamisch aber auch schwierig war. Wie gesagt: In „Der Mai ist vorbei“ habe ich das aufzuarbeiten versucht. Nicht ohne Ironie, was mir bei vielen bierernst linken Freunden keine große Sympathie eingebracht hat. Die 68er-Bewegung ironisch betrachten, das darf man gar nicht.
Haben sich die Ehepaare Zenker und Henisch nach dem Scheitern der WG wieder zusammengerauft?
Henisch: Nein, es war ein fundamentales Zerwürfnis. Der Zenker ist inzwischen nicht mehr unter den Lebenden. Jahrzehnte später haben wir uns getroffen und ganz gut miteinander reden können, aber gewisse Sachen waren nicht verheilt. Wunden, die man sich gegenseitig zufügt, für nichts und wieder nichts.
Konnten Sie über „Kottan ermittelt“ dann überhaupt lachen?
Henisch: Ach ja. Aber hier war es halt wie mit dem Austropop: Am Anfang ist es gut, mit der Zeit wiederholt es sich aber und wird seichter. Wahrscheinlich ist man dann auch verführt, geschwind etwas zu schreiben, dadurch wird man oberflächlicher, was nicht gut ist. Der Helmut hätte literarisch mehr und Besseres machen können, wenn er sich nicht darauf eingelassen hätte. Aber es nährt natürlich auch.
Ihre neue CD „Blues plus“ beginnt mit demselben Lied wie Ihr erstes Album. Wie fühlt es sich an, mehr als ein halbes Leben später wieder „Hallo Welt, heut reiß i dir an Haxen aus“ zu singen?
Henisch: Für mich stimmt das nach wie vor. Einerseits diese Lebenslust, andererseits auch dieses „Hallo Tod, heut hab i ka Angst mehr vor dir / Hallo Tod, heut lach i dir ins Gsicht“, wie es in der Folge heißt. Es betrifft mich jetzt natürlich auf ganz andere Weise als damals. Den Tod habe ich mir damals auch schon gut vorstellen können, aber so nah wie jetzt war er mir halt nicht. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen über den Gesundheitszustand des Herrn Henisch, aber so ist es eben, rein arithmetisch, und ich habe es ganz bewusst als Statement an den Anfang der CD gesetzt.
Wird Ihr Konzert beim Festival Vienna Blues Spring eine einmalige Sache bleiben?
Henisch: Schauen wir einmal. Die Lust, noch öfter aufzutreten und weitere Lieder zu machen, ist erweckt. Ich muss natürlich schauen, dass ich mit meinen literarischen Arbeiten weiterkomme, das ist doch die Hauptsache, und ich mag auch nicht herumtingeln. Es soll nicht inflationär werden, aber es wäre schön, wenn man sagt: Ah, super, jetzt haben wir noch einmal die Gelegenheit, den singenden Peter Henisch und seine großartigen Musiker zu hören.