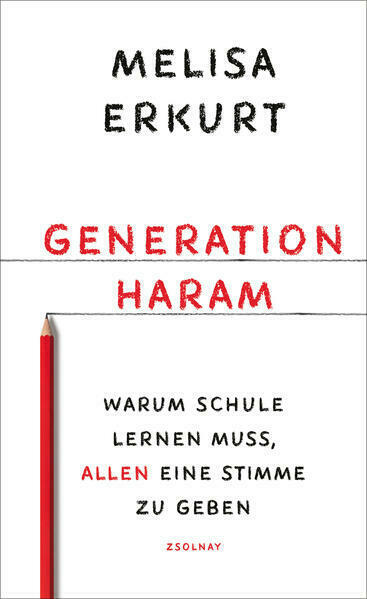Wie ich zwei Mal sprechen lernte
Melisa Erkurt in FALTER 32/2020 vom 05.08.2020 (S. 16)
Meine ersten Schritte und Worte machte ich noch in Sarajevo. Davon gibt es Videoaufnahmen und Fotos, die mir heute völlig fremd vorkommen. Ich begreife nicht ganz, dass ich das bin, wie ich meinen ersten Geburtstag im Kreise einer glücklichen Familie feiere, die nur Monate später für immer auseinandergerissen wurde. Wie wir da in unserem eigenen Haus sitzen mit Hund Boro, der mich bei meinen ersten Schritten stützte und später bewachte, als wir uns vor den Soldaten im Keller versteckten. Ich kann auch 28 Jahre später nicht fassen, dass zwei Monate nach diesen Aufnahmen mein ganzes Leben, das meiner Familie und aller Bosnierinnen und Bosnier nie wieder so sein sollte, wie es hätte werden können. Die Frage „Wie wäre mein Leben, hätte es diesen Krieg nie gegeben?“ hat mich meine gesamte Jugend lang begleitet. Menschen, die mich zurück in meine vermeintliche Heimat Bosnien wünschten und meine Andersartigkeit thematisierten, machten die Sache nicht einfacher. „Woher kommst du?“-Fragen nach einem Blick auf meinen Namen bestätigten mich in meiner Identitätskrise. Jedes Mal, wenn eine Lehrerin meinen Namen falsch aussprach oder die anderen Kinder mich beim Vorlesen meines Religionsbekenntnisses anstarrten und tuschelten, wurde ich als anders markiert. Und das sind noch die unabsichtlichen, vermeintlich harmlosen Diskriminierungserfahrungen, die mir begegneten.
Meine erste eigene Erinnerung an mein Leben setzt in Österreich ein. Alles, was ich kenne, kenne ich also aus Österreich. Es ist absurd, wenn mir Menschen meine Zugehörigkeit zu diesem Land absprechen, wenn es doch alles ist, was ich jemals erfahren habe. Ich erinnere mich an das kalte Pfarrheim in der Gemeinde, in der wir untergebracht wurden. Ich erinnere mich an die Nachbarn, die uns argwöhnisch beobachteten. Wieso trug meine Mutter eine Goldkette, wenn wir doch arme Flüchtlinge waren, denen man Kleidung spenden sollte? Meine Mutter hat die Kette nie abgelegt, sie war ein Geschenk von meinem Vater, von dem sie in dem Moment nicht wusste, ob er noch am Leben oder im Krieg gefallen war. An meinen Vater konnte ich mich damals schon nicht mehr erinnern, ich wusste nicht einmal, was ein Vater ist, ich kannte nur das Leben und die Menschen in Österreich, alles davor war nicht in meiner Erinnerung verankert.
Ich werde nie alte Kleider meiner Mutter tragen können, ihren weißen Hochzeits-Hosenanzug oder ihre schicken Hüte, die ich nur von den paar wenigen Fotos kenne, die den Krieg überlebt haben. Sollte ich mal eigene Kinder haben, kann ich ihnen nicht mein erstes Kuscheltier schenken oder meinen ersten Strampler anziehen. All das musste meine Mutter in unserem Haus zurücklassen, das ausgeraubt und verwüstet wurde, das ich in seiner vollen Pracht nur noch von Fotos und Erzählungen kenne. Den großen Garten, in dem ich meine Kindheit hätte verbringen sollen, in dem ich schaukeln und mit Boro spielen hätte können, habe ich seitdem nie wieder betreten – zu groß ist die Angst vor Landminen, die sich noch immer dort befinden könnten. In Österreich sollten wir nie wieder ein eigenes Haus oder gar einen Garten haben, wir wohnten die ersten Jahre in Unterkünften, die für Ausländer wie uns gut genug sein mussten. Jemand, der vor dem Krieg flieht, für den muss das reichen, so als wären wir plötzlich keine Menschen mit normalen Ansprüchen mehr, als bräuchten nicht gerade Menschen, die vor Krieg fliehen, einen sicheren Rückzugsort, in dem sie Mensch sein können.
Aber meine Mutter schaffte es, aus nichts alles zu machen, immer schon und heute noch. Ich sollte in all der Zeit nie spüren, wie wenig wir hatten. Dass es so war, wurde mir erst rückblickend bewusst. Damals dachte ich, ich hätte eine normale Kindheit. Ich fragte mich nicht, wieso ich keinen Vater hatte, und wunderte mich nicht, wieso ich im Kindergarten kein Wort sprach. Mir machte es nichts aus, dass meine Kleidung und mein Spielzeug nicht neu, sondern gespendet waren, und als mir ein nettes österreichisches Ehepaar meine erste Puppe schenkte, war das ein sehr besonderer Moment für mich.
Aber trotz allem war ich anders als die anderen Kinder, meine Vergangenheit war anders, mein Zuhause war anders, ich hatte einen Vater, der im Krieg war, während ich normal in den Kindergarten gehen und spielen sollte, so als wäre nichts. Die anderen Kinder sprachen eine Sprache, die bei mir daheim nicht gesprochen wurde, sie mussten ihre Freizeit nicht in dunklen Magistratsgängen verbringen – das alles muss mich unterbewusst sehr mitgenommen haben, also hörte ich meine Kindergartenzeit über auf zu sprechen. Manchmal glaube ich, ich habe aufgehört zu sprechen, weil ich nicht wusste, für welche Sprache ich mich entscheiden sollte – Deutsch oder Bosnisch. Vielleicht war es aber auch nur meine kindliche Art, all das zu verarbeiten. Ich weiß es nicht, meine Familie hatte kein Geld, um eine Psychologin aufzusuchen.
Nicht sprechen erschwerte den Umgang mit anderen Kindern. Ich verbrachte also viele Stunden allein in der Bücherecke im Kindergarten. Zu allem Überfluss entwickelte ich mich zur Linkshänderin und fing an, von rechts nach links zu schreiben, weil ich versuchte, die anderen nachzuahmen, was wohl irgendwie schiefging – ich war, vorsichtig ausgedrückt, ein wirklich „besonderes“ Kind und hatte damit wahrlich nicht die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bildungsweg. Die Pädagoginnen aber sahen das nicht so, zumindest ließen sie es mich nie spüren. Sie ließen mir Zeit und lasen mir vor.
Die Wichtigkeit von frühkindlicher Bildung und die Bedeutung von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen wird in Österreich noch immer massiv unterschätzt. Obwohl ich nicht sprach, war die Zeit im Kindergarten unglaublich kostbar für meinen Spracherwerb und das Kennenlernen dieses Landes und seiner Leute. Wer nicht spricht, hat außerdem viel Zeit, um zuzuhören und zu beobachten. Ich beobachtete, dass Mädchen oft Röcke und Kleider trugen und dann beim Abholen manchmal von ihren Eltern geschimpft wurden, wenn diese schmutzig geworden waren oder Löcher bekommen hatten. Das passierte bei den Buben nie. Ich beobachtete, dass den Mädchen gesagt wurde, wie sie in den Kleidern sitzen sollen, und dass man ihnen die ganze Zeit an ihrem Haar herumfummelte. Ich sah, wie grob die Buben die Mädchen anfassten und ihren Puppen den Kopf abrissen. Ich selbst wurde im Kindergarten „Puppe“ genannt, weil ich große blaue Augen hatte und nicht sprach. Ich weigerte mich, Kleider anzuziehen, ich wollte mein Haar nur zusammengebunden und unter einer Mütze tragen, und bei Mutter-Vater-Kind-Spielen stellte ich mir vor, der Sohn zu sein. Ich stellte früh fest, dass man es in dieser Welt leichter hat, wenn man kein Mädchen ist.
Die Kindergartenzeit prägte mein Verhältnis zu Bildungseinrichtungen. Wäre ich bei weniger geduldigen und geschulten Pädagoginnen gelandet, hätte man mich vielleicht als das Ausländerkind, das kein Deutsch kann, abgestempelt. Hätte mich meine Mutter erst gar nicht in den Kindergarten gegeben, ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre. Weil ich aus dem Kindergarten so bücherbegeistert nach Hause kam, aber auch, weil es niemanden gab, der sich mit mir beschäftigen konnte – meine Mutter war mit Amtswegen für unsere Aufenthaltserlaubnis, der Übersetzung ihrer Zeugnisse und mit Putzen, um uns über Wasser zu halten, beschäftigt –, schrieb sie mich in die kleine Bücherei der Gemeinde ein.
Die Frauen, die dort arbeiteten, erinnerten mich an die „Golden Girls“, nur dass sie nicht annähernd so fröhlich waren. Sie beobachteten immer genau, ob ich eh nichts mitgehen ließ, und schimpften, ich solle nicht so viele Bücher ausleihen. Ich hatte fürchterliche Angst vor ihnen, aber meine Liebe zu Büchern war stärker – so ging ich, als ich in der Volksschule endlich lesen lernte, wöchentlich in die Bücherei.
In der Klasse hing eine Liste mit unseren Namen, wir durften für jedes gelesene Buch einen Sticker hinkleben. Ich führte die Liste mit zwei weiteren Mädchen an. In der ersten Klasse Volksschule war ich noch das einzige Kind mit Migrationshintergrund. Als in der dritten Klasse zwei Mädchen aus Bosnien dazukamen, wurden wir drei beste Freundinnen. Heute noch ist es so, dass ich mich an einem Ort automatisch den anderen anwesenden Migrantinnen und Migranten verbunden fühle und ihre Nähe suche. Ich mache das nicht bewusst und meine es schon gar nicht böse, es ist nur verdammt einsam, wenn man immer die Einzige ist, deren Name anders klingt, die bestimmte Bräuche und Redewendungen nicht kennt, die misstrauisch angeschaut wird, wenn sie von Diskriminierung berichtet.
Umso weiter man die Karriereleiter hinaufsteigt, desto weniger von diesen Menschen gibt es und umso einsamer und fehl am Platz beginnt man sich zu fühlen. Später im Gymnasium sollte ich kaum noch auf andere Migrantinnen oder Migranten treffen, denn meine zwei Freundinnen kamen in die Hauptschule, wie es für „Ausländerkinder“ üblich war und immer noch ist. Meine Cousins kamen in die Sonderschule, obwohl sie keine speziellen sonderpädagogischen Bedürfnisse hatten. Doch in Österreich wird Mehrsprachigkeit, sofern sie nicht gerade Prestigesprachen wie Englisch oder Französisch umfasst, als Handicap gesehen. „Türkisch lernt man nicht, Türkisch verlernt man“, brachte es die deutsche Autorin Kübra Gümüşay auf den Punkt.