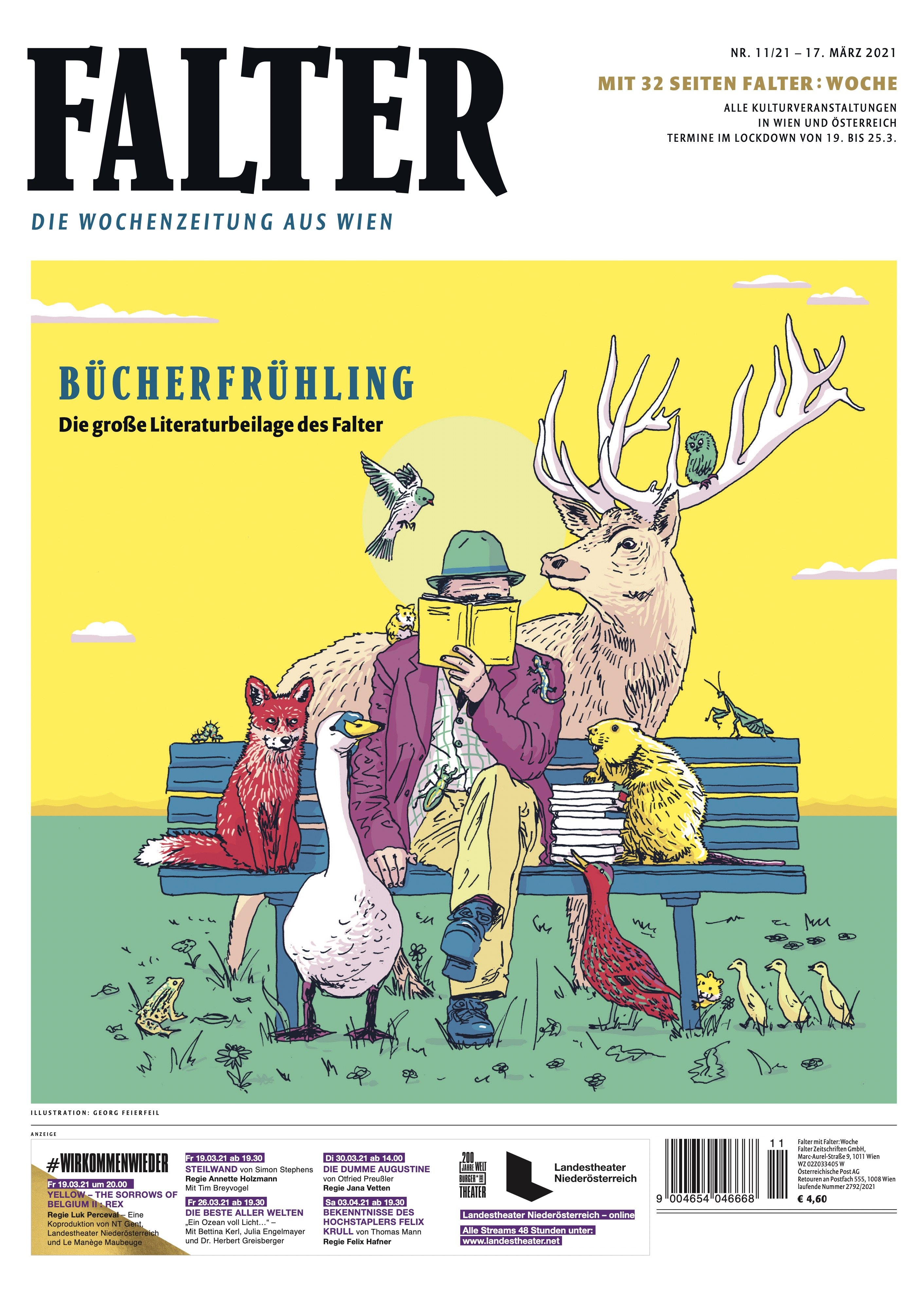
Die Kinder des Roten Wien
Kirstin Breitenfellner in FALTER 11/2021 vom 17.03.2021 (S. 12)
Auf der Insel im Fluss Seym, die in der russischen Stadt Kursk jedes Jahr überschwemmt wird, stehen Holzhäuser, die keinerlei Komfort bieten. Wir schreiben das Jahr 1927. Anastasia hat keine Augenbrauen, aber seherische Fähigkeiten, zumindest glauben das die Nachbarinnen, die sich gerne Rat von ihr holen. Sie heiratet den zehn Jahre jüngeren Fjodor, der sich bereits im zarten Alter von fünf Jahren in die hübsche Gehilfin im Lebensmittelgeschäft ihres Onkels verliebt hat.
Die gemeinsame Tochter Nina wird geboren, die zukünftige Frau von Karli, der im folgenden, sieben Jahre später spielenden Kapitel nach den Wirren des Bürgerkriegs im Weinviertel mit seinem Bruder Slavko aus einem Postbus aussteigt, um mit anderen Schutzbund-Kindern über die grüne Grenze in Sicherheit gebracht zu werden. Karlis Mutter, die überzeugte Sozialistin Eva, wird danach zum dritten Mal verhaftet, verhört und gefoltert. Ihr Plan für die Buben aber scheint aufzugehen, die Kinder werden in Moskau in einem komfortablen Heim untergebracht und bekommen von den Repressionen, die vor dessen Toren ablaufen, nicht viel mit. Sie machen sogar jedes Jahr Urlaub auf der Krim, doch als sie 1939 von dort zurückkehren, ist das Heim geschlossen. Die Buben werden getrennt und eine Odyssee beginnt.
Karli lebt als Straßenkind und kommt schließlich in Lagerhaft. Dort lernt er Nina kennen und folgt ihr nach seiner Freilassung 1953 auf die Seym-Insel, wo im Jahr darauf ein Mädchen geboren wird, das nach ihrem vermissten Onkel Slavoljub Ljuba genannt wird.
Aber die Geschichte geht weiter und nicht gut aus, obwohl Karli seine Mutter wiederfindet und mit seiner kleinen Familie drei Jahre später nach Wien emigrieren kann. Zu heftig sind die erlittenen emotionalen Wunden und die kulturellen Brüche.
Mit dem Schicksal ihrer eigenen Familie beleuchtet Ljuba Arnautović gleichzeitig einen Teil der österreichischen und sowjetrussischen Geschichte, der bislang kaum zur Kenntnis genommen wurde.
Zum Teil lässt sie dabei einfach die historischen Dokumente für sich sprechen und erreicht damit eine Dichte, die einem beim Lesen den Atem nimmt und einen Abgrund eröffnet. Die Wirkung auch des neuen Romans verdankt sich der Fähigkeit der Autorin, empathisch zu bleiben und dennoch Widersprüche zuzulassen.
Das spiegelt sich auch im Titel „Junischnee“ wider: Die Metapher für den Flug der flaumigen Pappelsamen im Frühsommer, die den Boden wie Schnee bedecken, verdichtet die Gegensätze, Sommer und Winter, das Weiche der „Pappelwolle“ und die eisige Kälte von Schneekristallen, zu einem einzigen, poetischen Begriff.




