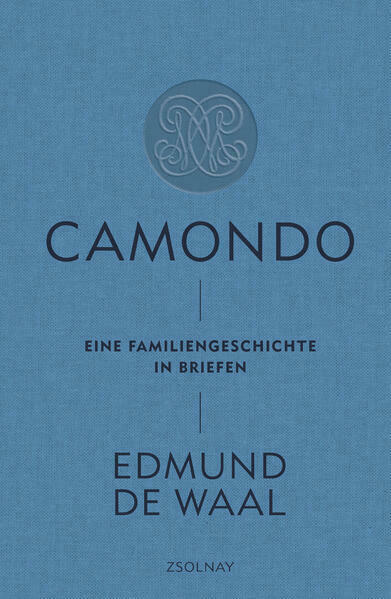Exquisiter Staub, der auf Nippes fällt
Barbaba Tóth in FALTER 42/2021 vom 20.10.2021 (S. 10)
In „Camondo“ rekonstruiert Edmund de Waal einmal
mehr die versunkene Welt der jüdischen Belle Epoque
Wie erzählt man Familiengeschichten? Man kann sie klassisch chronologisch schildern, aus verschiedenen Perspektiven berichten oder man kann sie wie Edmund de Waal in seinem neuen, schlanken Buch „Camondo“ als Briefesammlung anlegen. De Waal ist in Wien ein Begriff, vielleicht sogar mehr als in anderen europäischen Hauptstädten. In seinem bekannten Roman „Der Hase mit den Bernsteinaugen“, der im November im Rahmen der Gratis-Buch-Aktion der Stadt Wien verteilt werden wird, erzählt er die Geschichte seiner Familie, der Ephrussis. Sie waren, wie die Rothschilds, eine der berühmten jüdischen Familien der Belle Epoque. Sie besaßen prachtvolle Wohnsitze in Wien, Paris und an anderen Orten der Hautevolee. Sie verstanden sich als Mäzene und Patrioten.
De Waal zeichnet den Aufstieg der Ephrussis nach, ihre intellektuellen und sehr weltlichen Leidenschaften, etwa das Sammeln kleiner japanischer Miniaturfiguren, Netsukes oder Netzkes genannt. Eine davon ist der titelgebende Porzellanhase, der im Jüdischen Museum Wien als Dauerleihgabe zu sehen ist. Er steht für eine Welt, deren Bewohner von den Nazis vernichtet und vertrieben wurde. De Waal erzählt die Geschichte als großen Epochen- und Generationenroman, aber die Hauptrolle spielt besagte Sammlung, die ihre jüdischen Besitzer überlebt.
Auch in „Camondo“ geht es um das Erinnern einer versunkenen Welt. De Waal tritt als Verfasser von Briefen selbst auf, die er an den jüdischen Bankier Moise de Camondo schreibt. Die Ephrussis und Camondos kannten einander gut. Letztere stammen aus Istanbul, in Paris lebte man im gleichen schicken Viertel in eigens gebauten prachtvollen Palais.
Moise de Camondos Wohnsitz in der Rue Monceau ist ein Juwel der Zeit, ein Denkmal des ausgesuchten Geschmacks, der Weltgewandtheit und des Reichtums seines Besitzers. Bis ins letzte Detail durchkomponiert und ausgestattet mit den feinsten Tapisserien und Möbeln materialisiert sich in ihm Camondos Selbstverständnis als jüdischer und französischer Großbürger.
Das Palais ist vollständig erhalten, weil Moise es nach dem Tod seines Sohnes Nissim im Ersten Weltkrieg mehr oder weniger „einfrieren“ ließ. Er erklärte es zum Museum und schenkte es dem Staat, mit der Auflage, es exakt in dem Zustand zu erhalten, in dem er es übergeben hatte.
Heute ist es Teil des Kunstgewerbemuseums Paris. De Waal seziert das Museum regelrecht, sein fachlich geschulter Blick – er ist selbst Keramiker – registriert auch Details, die dem durchschnittlichen Besucher wohl verborgen bleiben. Etwa wenn er über den feinen Staub sinniert, der sich überall niederlässt. Liest man de Waals Briefe, in denen sich dieser vom Lichteinfall und der Gartenbepflanzung begeistert zeigt und seine Rückschlüsse auf die Bewohnerinnen und Bewohner zieht, und betrachtet man die im Buch abgedruckten Fotos und Pläne des Hauses, dann bekommt man unweigerlich Lust, einen Flug (oder ein Bahnticket) nach Paris zu buchen, um diesen magischen Ort der Verschwendung zu besuchen.
Man könnte „Camondo“ also auch als überaus kunstvollen Museumsführer lesen, aber einen solchen zu verfassen, war nicht die Absicht des Autors. Der wollte vielmehr ein Buch über das Vergessen und Erinnern schreiben, über das Trauern und das Weiterleben. Die Welt Camondos, die de Waal in seinen wunderschön nachdenklichen Briefen auferstehen lässt, wird brutal ausgelöscht. Auf die vielen Seiten, die in Auslassungen über die Kunst der Furnierarbeiten, die passende Service-Auswahl, Nippes und Dragees schwelgen, folgen einige wenige beklemmende Passagen, die nüchtern und präzise die Enteignung, Deportation und den Massenmord der Nazis schildern.
Wenn man, am Ende des schmalen Bandes angelangt, einen Blick zurück auf Camondos Museum wirft, dann sieht man Prunk und Pracht, Mord und Schande zugleich.