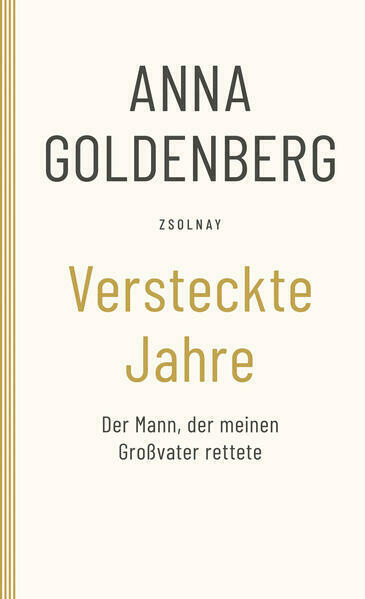Lücken der Erinnerung
Anna Goldenberg in FALTER 4/2025 vom 22.01.2025 (S. 25)
Eva Ribarits erzählt in Schulen gerne die Sache mit dem Heurigen. Ribarits kam 1943 als Tochter jüdischer Flüchtlinge in London zur Welt. Als sie vier Jahre alt war, folgten die Eltern, überzeugte Anhänger des Kommunismus, den Aufrufen der KPÖ, nach Wien zurückzukehren. Dort wollten sie den Sozialismus vorantreiben -doch stattdessen landeten sie mitten in der desillusionierten Nachkriegsgesellschaft. "Die Leute haben den Krieg und ihre Ideologie verloren", sagt Ribarits. "Das hast du in ihren Gesichtern gesehen."
Die Familie fiel auf, auch optisch. Eva und ihre Schwester hatten dunkles, fast krauses Haar. "Ich habe gespürt, dass man mir feindlich gegenüberstand", sagt sie. Als Jüdin, als Kommunistenkind, als vermeintlich Fremde. "Wir wären als Familie nie zu einem Heurigen gegangen."
Mit ihren Erfahrungen als Flüchtlingskind könne sie zu den jungen Menschen, denen sie über ihr Leben und das ihres Vaters erzählt, eine Verbindung aufbauen, führt Ribarits aus. Und vielleicht sei das ja 80 Jahre nach Kriegsende eine Möglichkeit, zu vermitteln, warum es wichtig ist, sich mit der NS-Zeit im Allgemeinen und dem Holocaust im Speziellen zu beschäftigen. Vor allem in einer Gesellschaft, die längst nicht mehr so homogen ist wie in den 50er-Jahren, als sich die Familie Nürnberger - so hieß Ribarits' Familie - nicht in Heurige traute. Es gibt in Wien kaum mehr eine Schulklasse, in der nicht zumindest eine Person eine Fluchtgeschichte hat.
Ribarits bezeichnet sich selbst als der "eineinhalbten" Generation zugehörig. Ihrer Mutter Hilde gelang 1937 die Flucht nach England mithilfe eines gefälschten Passes. Ihr Vater Arthur überlebte die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald und konnte 1939 nach England ausreisen. Schon ihr Vater, ein umtriebiger, redseliger Mensch, erzählte zu Lebzeiten jüngeren Freunden bereitwillig seine Geschichte.
Nicht nur Menschen wie Nürnberger, die als Erwachsene während der NS-Zeit verfolgt wurden, sind längst gestorben; die sogenannte erste Generation, also jene Menschen, die sich überhaupt aus erster Hand an die Verfolgung erinnern können, ist verschwindend klein geworden. Erinnern.at, das Programm von Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), das für Lehren und Lernen über den Holocaust und die NS-Zeit verantwortlich ist und Zeitzeugenbesuche organisiert, listet nur noch zwölf Personen, die für Schulbesuche zur Verfügung stehen. Zwei sind 1932 geboren, alle anderen frühestens 1936, waren also, so wie auch Eva Ribarits, während der Kriegsjahre (Klein)Kinder.
Die Erinnerung an die NS-Zeit befindet sich an einem Wendepunkt, am Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Die mündlichen Überlieferungen einzelner Personen werden durch ihren Nachlass ersetzt, durch Aufzeichnungen und Nacherzählungen. Material gibt es genug. Der Holocaust und die NS-Zeit sind das wohl am besten aufgearbeitete Ereignis der jüngeren Geschichte.
Allein die Shoah Foundation an der University of Southern California hat über 50.000 Interviews mit Überlebenden aufgenommen. Auch dank der auf perverse Weise akribischen Bürokratie der Nazis sind viele Dokumente erhalten geblieben. Gerade in Österreich gibt es zudem kaum einen Straßenzug, der von der NS-Zeit nicht berührt wurde. Das Bundesdenkmalamt listet rund 2100 sogenannte Opferorte auf. Kriegsgefangenen-und Zwangsarbeitslager, KZ-Außenstellen und Euthanasie-Standorte.
Aber wird das alles reichen? In einem Land, in dem eine Partei, die von ehemaligen SS-Männern gegründet wurde, demnächst den Kanzler stellen könnte? In dem laut repräsentativer Umfrage des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) vom Vorjahr 42 Prozent finden, Diskussionen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg sollten beendet werden? Gerade deshalb scheint es so wichtig wie nie, der nächsten Generation zu vermitteln, wie es zum größten Massenmord der Menschheitsgeschichte kam.
Der österreichische KZ-Überlebende Hermann Langbein überzeugte das Unterrichtsministerium davon, 1978 den "Referentenvermittlungsdienst für Zeitgeschichte" zu starten. Mit dem sogenannten Biographical Turn in der Geschichtsforschung, der ab den 1980ern autobiografische Schilderungen aufwertete, stieg auch das Interesse an den Erzählungen von Opfern.
Es folgten die Waldheim-Affäre 1986, das Eingeständnis der Mitschuld Österreichs an den NS-Verbrechen durch den damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky von der SPÖ 1991 und die Gründung der Shoah Foundation durch den US-Regisseur Steven Spielberg 1994. Mit der Konsequenz, dass Zeitzeugenbesuche aus der zeitgeschichtlichen Bildung nicht mehr wegzudenken sind.
Dabei beruht das Konzept auf einem unscharfen Begriff. Was ist das überhaupt, ein Zeitzeuge? Im Englischen wird stattdessen entweder von witness, dem Zeugen, oder survivor, dem Überlebenden, gesprochen. Von welcher Zeit sollen die Überlebenden Zeugnis ablegen -der vergangenen oder der aktuellen? Der Begriff scheint eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen. Für den Historiker Daniel Schuch von der Universität Jena dient die Figur des Zeitzeugen einem Erlösungsversprechen, und zwar "einer verbesserten Zukunft ohne Hass, Vorurteile und Indifferenz". Von den Überlebenden wird eine moralische Botschaft erwartet.
Doch viel wichtiger ist ein anderer Aspekt. "Wenn sie einmal angefangen haben zu fragen, dann fällt ihnen immer mehr ein, das sie noch wissen wollen", berichtete die jüdische NS-Überlebende Gertraud Fletzberger in einem Interview über einen Schulbesuch, der vier Stunden dauerte. Fletzberger, Jahrgang 1932, entkam 1938 mit einem Kindertransport nach Schweden. "Je mehr sie fragen, umso mehr Abgründe, übertrieben gesagt, machen sich auf."
Fragen zwingt zum Nachdenken - und zum Herstellen einer Verbindung zu sich selbst. Es entsteht somit eine "Erzählung von Geschichte als Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt", so der Schweizer Wissenschaftler Peter Gautschi. Die USC Shoah Foundation experimentiert mit interaktiven Videos, die mittels Spracherkennungssoftware die Fragen erkennen und ein authentisches Zeitzeugengespräch simulieren. "Da sind wir kritisch", sagt Patrick Siegele, der Erinnern.at leitet. "Es suggeriert etwas, das es nicht gibt. Dahinter steckt nämlich nicht die Begegnung mit einem echten Menschen, sondern mit einer Maschine, die der Logik von Algorithmen folgt."
Bei den persönlichen Gesprächen hingegen geht es um das Lernen aus Lebensgeschichten. Erzählen die Überlebenden vom erzwungenen Umzug, vom Verlust eines Freundes oder vielleicht einfach nur davon, gefroren zu haben, weckt das Assoziationen bei den Schülern. Durch geteiltes Erleben entstehen Verbindungen.
So kann auch Eva Ribarits bei den Schülerinnen und Schülern andocken. Die Flucht, das Fremdsein, das Trauma der Eltern, das sind Themen, die auch im 21. Jahrhundert noch präsent sind. "Die Kinder fragen oft, ob ich lieber in einem anderen Land gelebt hätte", sagt Ribarits.
Erinnern.at, das als Einrichtung des Bundes Holocaustvermittlung organisiert und fördert, setzt nun auf Menschen wie Ribarits, die Erzählungen ihrer Eltern und teils auch Großeltern weitergeben - die sogenannte zweite und dritte Generation. Schließlich lässt sich auch hier Authentizität herstellen, und, vielleicht noch wichtiger, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ein solches Projekt mit Schulbesuchen von Nachkommen wird seit vergangenem Jahr auch wissenschaftlich begleitet.
"Nachkommengespräche können auch eine gute Möglichkeit sein", sagt Daniela Lackner. So viel Erfahrung hat sie damit noch nicht gemacht, fügt sie hinzu. Lackner ist Lehrerin für Geschichte, politische Bildung und Englisch an der BAfEP 10, der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Wien-Favoriten. Im Schuljahr 2022/23 startete sie erstmals ein Gedenkprojekt mit einer Schülergruppe.
Gemeinsam erarbeiteten sie einen Erinnerungsweg durch Favoriten: Sechs Stationen gab es, darunter den ehemaligen Humboldt-Tempel, eine Synagoge mit 700 Sitzplätzen, die während der Novemberpogrome 1938 zerstört wurde, und den Baranka-Park, einst Lagerplatz für Roma, Sinti und Lovara. Einen Gedenkstein im Böhmischen Prater setzte die Schule selbst. Die Schüler übersetzten die Inhalte auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Russisch, Arabisch und Türkisch.
Für eine Begegnung mit dem 1933 geborenen Kurt Hillmann, der die NS-Zeit als sogenannter "Mischling" überlebte, reiste die Gruppe damals nach Berlin. "Kaum hat er den Raum betreten, ist es ganz still geworden", erinnert sich Lackner. "Er hatte noch gar nichts gesagt." In den Folgeprojekten wird Lackner auf solche Begegnungen wohl verzichten müssen. Was sind die Alternativen?
Je weniger Zeitzeugen sprechen, desto größere Bedeutung erhalten die Orte der Verfolgung. Schließlich vermitteln auch sie Authentizität, sind ein Zeugnis der Zeit. Und sie helfen, Menschen mit unterschiedlichen Geschichten zu verbinden. In Lackners Gruppen liegt der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund bei gut 80 Prozent. Immer wieder, erzählt Lackner, höre sie dann von einigen Schülern, dass sie sich für die Erinnerung an die NS-Zeit nicht wirklich verantwortlich fühlen. "Das ist nicht unsere Geschichte, wir waren nicht beteiligt."
Oft wird dann erst einmal gemeinsam erarbeitet, welche Rolle ihre Herkunftsländer während der NS-Zeit spielten. Waren es Verbündete von Nazi-Deutschland, so wie die Türkei? Wurden auch dort Kriegsverbrechen verübt, wie auf dem Balkan? Verortet man die Geschichte im eigenen Grätzel, im eigenen Schulbezirk, entsteht etwas Verbindendes. "Dann ist es plötzlich ihre Geschichte, weil sie davorstehen", sagt Lackner.
Historische Orte haben eine eigene Kraft. Die meisten Menschen, die das erste Mal die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen besuchen würden, seien überwältigt von dem Anblick, sagt Gudrun Blohberger, die pädagogische Leiterin der Gedenkstätte. Die Größe des Areals, wie es auf dem Hügel thront, weithin sichtbar, die liebliche Landschaft rundherum. "Die Menschen sehen, dass es eine wahre Geschichte ist." Gut 4300 Vermittlungsprogramme finden jedes Jahr dort sowie in den ehemaligen Außenlagern Melk und Gusen statt.
Bei den Rundgängen ist der ehemalige Fußballplatz der SS eine der ersten Stationen. Heute ist dort nur noch eine Wiese, im Frühling blühen Wildblumen. Alte Aufnahmen zeigen, dass es Zuschauertribünen gab. Menschen aus der Umgebung sahen also regelmäßig zu. Der Fußballplatz war mit einem Stacheldraht vom ehemaligen Sanitätslager des KZ abgetrennt, jenen Baracken, in denen nicht mehr arbeitsfähige Menschen untergebracht wurden. "Wir bezeichnen es heute als Sterbelager", sagt Blohberger.
Wer zum Fußballspiel kam, sah also ins Lager hinein. Täter, Opfer und Zuseher trafen auf kleinstem Raum aufeinander. Wie konnte das sein?"Viele Besucher vermuten, dass die lokale Bevölkerung gezwungen wurde, die Spiele anzusehen", erzählt Gudrun Blohberger. "Dafür gibt es in der Geschichtsschreibung aber keine Indizien."
Der Ort zwingt zur Auseinandersetzung und zum Fragenstellen, an die Geschichte und an sich selbst. "Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung" nennt die österreichische Kulturwissenschaftlerin Nora Sternfeld solche Anlässe und Räume in ihrem gleichnamigen Buch -und wirft die Frage auf, welches Verhalten dort angemessen ist.
Sie zitiert einen Überlebenden des KZ Bergen-Belsen: "Angemessenes Verhalten an diesem Ort - was ist das? Als ich hier war, wurde hier gemordet und gestorben. Das war das angemessene Verhalten in Bergen-Belsen "
Die meisten jungen Menschen, die erstmals kommen, seien eher ängstlich und angespannt, erzählt Blohberger. Dabei dürften Besucher ohnehin alles sagen und fragen. Vergleicht beispielsweise jemand Gaza mit einem KZ, wird die Gruppe eingebunden. Wer denkt anders? Wie kommt die Person zu dieser Ansicht?"Wir brauchen Vergleiche, um uns in der Geschichte orientieren zu können", sagt Blohberger. "Aber wir müssen herausarbeiten, was heute anders ist."
Das ist auch Eva Ribarits wichtig. Wenn sie den Schülerinnen und Schülern erzählt, dass sie als Kind die Ablehnung ihrer Umgebung spürte, fügt sie immer hinzu, dass sich die Zeiten geändert haben. Die Gesellschaft ist nun diverser und offener. Auch beim Heurigen.
Die vielen Leben der Helga Feldner-Busztin
Anna Goldenberg in FALTER 44/2024 vom 30.10.2024 (S. 19)
Das muss es gewesen sein", sagte meine Großmutter. Sie stand vor einem gelben Wohnhaus in Terezín. Das ehemalige Garnisonstädtchen im Norden Tschechiens hieß einst Theresienstadt, in der NS-Zeit war hier ein Konzentrationslager. 1943 hatten die Nazis meine damals 14-jährige Großmutter Helga aus Wien dorthin verschleppt, weil sie Jüdin war. Durch diverse glückliche Fügungen überlebte sie bis zur Befreiung über zwei Jahre später.
Und nun befanden wir uns wieder an diesem Ort. Es war August 2013, ich sollte über unseren gemeinsamen Ausflug eine Reportage schreiben. Helga, damals 84, brauchte keine Motivation meinerseits, die eher trostlosen Straßen zu erkunden. Im Gegenteil. Die Kasernenfenster, die Kirche, der Marktplatz, das Stadttor - wenn sie etwas wiedererkannte, erzählte sie bereitwillig.
Auch über L414, das ehemalige Mädchenheim, vor dessen Fassade wir nun standen. Auf Strohsäcken hatten sie geschlafen, die Bettwanzen waren ebenso eine Qual gewesen wie der ständige Hunger. Immer war sie auf der Suche nach Essbarem, seien es Reste oder Heruntergefallenes.
Das Eingangstor des gelben Wohnhauses war unversperrt, sie trat ein. Das Haus schien bewohnt, aber verwahrlost, Spinnweben, Tauben, Gerümpel. Selbstbewusst stieg Helga den Halbstock hinauf und blickte aus dem Fenster.
Ja, das sei es gewesen. Sie war zufrieden, weiter ins Haus vordringen wollte sie dann doch nicht.
Lange Jahre hatte ich meine Großmutter nur als Großmutter gesehen. Und diesen Job erfüllte sie in meinen Kinderaugen sehr gut: Sie holte mich von der Volksschule ab, hatte stets Süßigkeiten dabei und strickte bunte, warme Socken. Ihre Geschenke waren großzügig; wer krank wurde, bekam mindestens einen täglichen Anruf.
In anderen Belangen war sie aber eher untypisch. Sie nahm bis Mitte 80 an Aerobic-Stunden im Fitnesscenter teil und achtete auf ihr Gewicht. Sie war schonungslos ehrlich und sprach aus, wenn sie den Lebenswandel anderer nicht guthieß. Weh dem, der rauchte! Außerdem arbeitete sie bis in ihr 90. Lebensjahr hinein als Ärztin.
Erst als ich älter wurde, begann ich, über den Zusammenhang mit ihrer Vergangenheit nachzudenken. Der Hunger hatte wohl ihr eigenartiges Verhältnis zum Essen geprägt, die Lügen des NS-Regimes vielleicht das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit. Und dieser Ehrgeiz stammte möglicherweise von jenem Erlebnis, das sie stets zu den schlimmsten ihres Lebens zählte: der Tag im Frühjahr 1938, als sie, gerade einmal neun Jahre alt, aus ihrer Volksschulklasse geworfen wurde, weil sie Jüdin war.
Allen zu beweisen, dass sie kein Mensch zweiter Klasse sei, das trieb sie an. Im Nachkriegswien lernte sie meinen Großvater Hansi kennen, sie 16, er 19. Den Holocaust hatte er hier überlebt, weil ihn sein ehemaliger Schularzt versteckt hatte; die Eltern und der jüngere Bruder waren im KZ ermordet worden.
Hansi hatte gerade sein Medizinstudium begonnen, Helga ging noch zur Schule. Doch weil sie gleichauf sein wollte, brach sie die Schule ab, besuchte stattdessen einen Maturakurs - und parallel die Medizinvorlesungen.
Vereint im Willen, aus diesem Leben, in dem schon so viel zerstört worden war, etwas zu machen, blieben Hansi und Helga 50 Jahre lang ein Paar. Helga wurde Oberärztin, sie bekamen vier Kinder und zogen aus der Gemeindewohnung in ein Haus.
Was sie erlebt hatten, war präsent und doch nicht. Bei den Abendessen sprach man eher über medizinische Fälle als über die Vergangenheit. Doch die Familie kannte die Geschichten, trugen die Kinder doch Namen der ermordeten Verwandten, und auch wir Enkelkinder wussten, dass mein Großvater im Werkzeugkeller unter dem Linoleumboden ein mannsgroßes Versteck gebaut hatte.
Der Holocaust hatte seinen selbstverständlichen Platz im Hintergrund des Lebens. Sie sei nun einmal nicht sentimental, sagte Helga. Aber vielleicht hatte sie nicht den Raum, um sich auszudrücken. Den bekam sie sehr spät. Erst Ende der 1980er-Jahre war die österreichische Öffentlichkeit bereit, sich mit der Täterschaft während der NS-Zeit zu beschäftigen. 1998 gab Helga ihr erstes längeres Interview - der von Steven Spielberg gegründeten US-amerikanischen Shoah Foundation.
Nach und nach kamen in Österreich immer mehr engagierte Menschen, die sie befragten und einluden. Besonders gerne ging sie an Schulen. Wieder und wieder erzählte Helga dort ihre Geschichte. Mit ihrem ruhigen, aber beharrlichen Ehrgeiz machte sie sich an die neue Lebensaufgabe. Sie genoss die ehrliche Aufmerksamkeit und die interessierten Fragen.
Ihre letzte Schulklasse besuchte sie heuer im März.