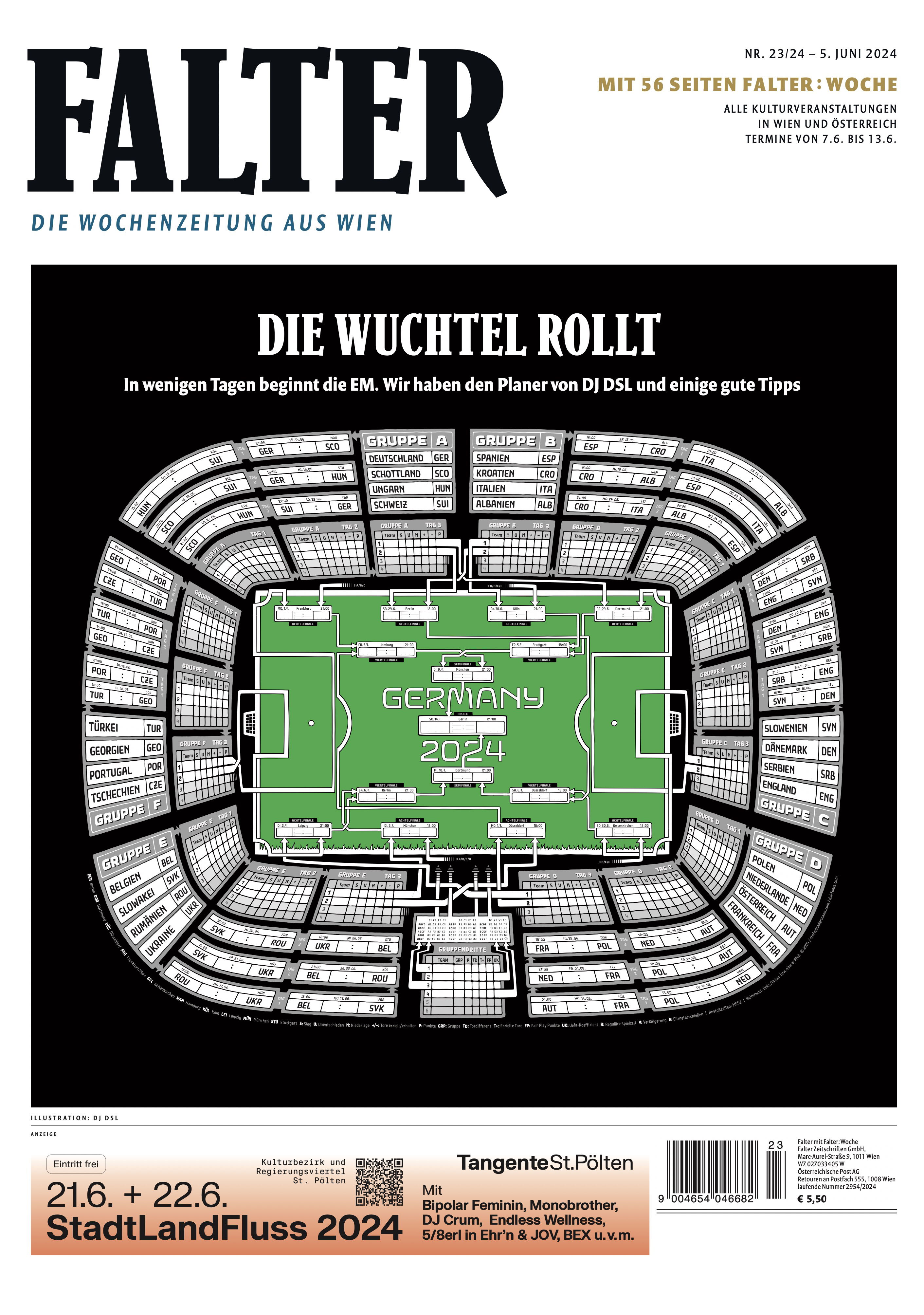
Mäuse, Bücher, Rappelköpfe
Armin Thurnher in FALTER 23/2024 vom 05.06.2024 (S. 25)
Das Folgende ist kein kritisches Interview, sondern ein Gespräch unter Freunden. Der Zsolnay Verlag und der Falter Verlag haben, es soll nicht geleugnet werden, ein Naheverhältnis.
Seit der im Gespräch beschriebenen Neugründung des Verlags gehören zahlreiche Falter-Mitarbeiter nicht nur zum Umfeld des Verlags, dort erschienen auch ihre Bücher, seien es welche von Melisa Erkurt, Isolde Charim, Florian Klenk, Anna Goldenberg oder Armin Thurnher. Autoren wie Franz Schuh und Konrad Paul Liessmann publizierten früher im Falter, kurz, es ist ein kreativer Austausch und manchmal auch ein freundschaftlicher Wettbewerb zweier Wiener Institutionen und jedenfalls Grund genug, zum Hunderter herzlich zu gratulieren.
Falter: Wir feiern heuer, in wenigen Tagen, 100 Jahre Zsolnay Verlag - welche Frage willst du nicht mehr hören? Herbert Ohrlinger: Wie der reiche Erbe dazu kam, einen Verlag zu gründen.
Welche Frage wurde noch nie gestellt, hätte aber gestellt werden müssen?
Ohrlinger: Buchverlage gibt es doch wie Sand am Meer. Wozu braucht eine Stadt wie Wien, wozu braucht ein kleines Land wie Österreich einen starken unabhängigen Verlag?
Gute Frage. Also wozu braucht es ihn? Ohrlinger: Weil es in der Mitte von Europa sehr viele originelle Köpfe gibt und gab, die auch 35 Jahre nach 1989 von Berlin oder Paris aus, wenn überhaupt, nur als Exoten oder Desperados zur Kenntnis genommen werden. Dabei kann man mit einigem Recht behaupten, dass die Zivilisation - mitsamt vielen Irrtümern und Verheerungen -von Osten und Südosten auf uns gekommen ist und hier äußerst fruchtbar geworden ist. Mit den Möglichkeiten der Verbreitung und des Vertriebs, die wir haben, gelingt es nun schon eine Zeitlang, die Bücher dieser klugen Köpfe in einer vorher nicht gekannten Qualität und Quantität international bekannt zu machen. Und mit ihnen ihre Autorinnen und Autoren. Wien war und ist ein früher melting pot, Wien ist die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum, von hier aus lässt es sich gut über Träume und Wirklichkeiten nachdenken.
Das klingt nun beinahe nach extraterritorialer Position. Oder ist "Exoten oder Desperados" die Zsolnay-Definition von "österreichisch"? Und wenn ja, hätte das vielleicht doch mit der Vorgeschichte des Verlags zu tun? Wir reden ja von einem Verlag, den Michael Krüger und du Mitte der 1990er-Jahre neu gegründet habt.
Ohrlinger: In gewisser Weise war die Rolle des Außenseiters ja gerade unser Vorteil. Rebellengeschichten aus Alaska und Antiglobalisierungsmanifeste gab es schon zuhauf. Aber die Erzählungen eines surrealistischen Baumeisters, der im Nebenberuf einmal Belgrader Bürgermeister gewesen ist und dann von seinen Landsleuten ins Exil getrieben wurde, ein melancholischer Kommissar, der gezwungen ist, Fälle zu lösen, die ihre Ursachen im Zerfall des schwedischen Sozialstaates (der dem österreichischen nicht unähnlich ist) haben, ein eigensinnig-rappelköpfiger Essayist, der die Vielfalt Europas preist -da schaut die schwäbische Buchhändlerin eher hin, und sei es, weil sie es nicht fassen kann, dass ein Verlag ein so irrsinniges Programm anbietet. Der Neuanfang 1996 war Risiko und Chance zugleich. Wir konnten Bücher machen, von denen wir glaubten, die Leute sollen sie lesen, also - mit Kurt Wolff gesprochen -die ureigene Aufgabe eines Verlags erfüllen, und wir haben Bücher gemacht, von denen wir glaubten, die Leute wollen sie lesen. In beiden Fällen haben wir uns oft geirrt, aber öfter noch haben wir es hingekriegt. Hätten wir es aber nicht innerhalb von drei, vier Jahren geschafft, einigermaßen schwarze Zahlen zu schreiben und halbwegs bella figura zu machen, würden wir uns heute nicht darüber unterhalten.
Du sprichst von Bogdan Bogdanović, Henning Mankell und Karl-Markus Gauß, nehme ich an. Wie bist du zu Zsolnay gekommen? Und wie kam Michael Krüger, der langjährige Hanser-Chef, auf die Idee, Zsolnay zu kaufen und dich als Verlagsleiter zu installieren?
Ohrlinger: Spätestens nach dem Erfolg von Umberto Ecos "Der Name der Rose" ist der Hanser Verlag, ein Münchener Familienunternehmen, in die erste Reihe der deutschsprachigen Verlage aufgerückt, als Literaturverlag und Heimstatt der Zeitschrift Akzente stand er schon vorher dort. Untrennbar verbunden ist dieser Aufstieg mit Michael Krüger, der nicht zuletzt durch Alfred Kolleritsch und Peter Handke, aber auch schon viel früher, etwa durch den Kunsthändler Wolfgang Georg Fischer und andere österreichische Emigranten in London, mit der österreichischen Szene vertraut war. Er wusste, dass bei Zsolnay die deutschsprachigen Rechte von Leuten wie Graham Greene, John le Carré, Colette und noch ein paar anderen liegen. Zsolnay versank um 1990 herum immer tiefer im Nirgendwo. Krüger ist ja nicht nur ein enthusiastischer Leser, sondern auch ein enthusiastischer Liebhaber Wiens und seiner Traditionen. Warum er dann auf mich kam, weiß ich so recht bis heute nicht, vielleicht weil ich als Literaturredakteur des Presse-Spectrum nicht viel mehr konnte, als Rezensionen zu schreiben, Beistriche zu setzen und Titel zu machen, also als reiner Tor anfangen musste. Das war gut so, denn hätte ich gewusst, was mich erwartet, ich hätte wohl anders entschieden (auch wenn es für mich mit einem Presse-Chefredakteur namens Andreas Unterberger schwer geworden wäre).
Also gut, er hat dich angerufen. Wie war das erste Treffen? Habt ihr gleich über Programme geredet oder gar welche gemacht oder euch erst beschnuppert? Ich sage, was du immer zu deinen Autoren sagst: Erzähl!
Ohrlinger: Die Pressedame, Susanne John, hat mich angerufen und gefragt, warum ich nicht zu Krügers erstem Umtrunk nach dem Kauf von Zsolnay in der Prinz-Eugen-Straße gekommen sei, er hätte mich gerne kennengelernt. Wahrheitsgemäß antwortete ich ihr, dass ich Ski fahren war, im Grödnertal. Ich bin dann nach München gefahren, und wir haben zwei Stunden geredet, geraucht, geredet. Über Canetti, über Theodor Kramer, über Philip Roth und Joseph Roth. Als ich nach Mitternacht wieder in Wien war und den Anrufbeantworter abhörte, war er drauf: Wir wollen, dass Sie das machen. Da ich aber sehr gerne mit Karl Woisetschläger und den anderen Kollegen vom Spectrum arbeitete, sagte ich erst zu, als klar war, dass ich zur 1996er-Buchmesse in Frankfurt noch als Redakteur fahre.
Krüger erzählt oft von den Mäusen im Zsolnay-Keller, das war seine erste Erfahrung in Wien. Was ist deine erste Erinnerung an diesen damals doch offenbar sehr schrulligen Verlag?
Ohrlinger: Der Keller, von dem Krüger gerne spricht, war nicht der im Haus des Verlags, sondern das sogenannte Festlager ein paar Häuser weiter stadteinwärts. Dort waren die Fixbestände untergebracht: Lizenzverträge waren teils damals so lange gültig, als noch 500 oder 1000 Exemplare vorrätig waren. Also stapelten sich da im Souterrain abertausende Bücher, die Frau Kaindl alljährlich inventarisierte und von der zentimeterdicken Staubschicht befreite. Peter Matić, der im Haus oberhalb dieses Kellers wohnte, schaute einmal durch die niedrige Tür und konnte nicht fassen, was da alles lagerte - von Martin Amis und Noah Gordon, von Pearl S. Buck und Trude Marzik, alles leicht entzündbar. Irgendwann um die Jahrtausendwende haben wir den Keller räumen lassen. Fixbestand als Vertragsgarant, das klingt heutzutage nach Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer.
Als Erstes kamst du nicht in diesen Keller.
Ohrlinger: Als ich am 1. Dezember 1996 den Verlag betrat, hielten zwei nette ältere Damen, Frau Kaindl und Frau Heindl, eine Stehleiter, auf der eine junge Frau dabei war, ein Tannenzweiglein über der Tür zum Sekretariat zu befestigen. Sie wussten ja, dass ich kommen würde, begrüßten mich freundlich, hielten sich aber jede mit beiden Händen an der Stehleiter fest, auch als die Praktikantin schon von der Leiter herabgestiegen war. Die Szene hatte etwas von Herzmanovsky-Orlando oder von den Wirtshäusern bei Thomas Bernhard. Von der Presse her war ich alles andere als verwöhnt, was die Büroausstattung anging, in der Prinz-Eugen-Straße 30 schien die Zeit jedoch irgendwann in den späten 40ern stehengeblieben zu sein. Als ich eine Karte aus der Pressekartei herauszog, stand da der Name Piero Rismondo. Das rührte mich zum einen, war er es doch, der Italo Svevos "Zeno Cosini" in ein herrliches Triestiner Deutsch gebracht hatte, aber es schockierte mich auch, da er seit Jahren tot war.
Das klingt ja wirklich nach Habsburgerwelt. Daraus wolltet ihr einen modernen österreichischen Verlag machen. Was war die Idee, das Ziel, der Auftrag, was konnte investiert werden, und wer waren außer den Genannten die ersten Autoren (ich habe da so ein paar Ideen)?
Ohrlinger: Fürs erste Programm hatte Krüger ein paar Hanser-Verträge umschreiben lassen, darunter Jules Vernes lange als verschollen gegoltener Roman "Paris im 20. Jahrhundert", übersetzt von der damals noch nicht berühmten Elisabeth Edl, und eine Neuauflage von Ivo Andrićs "Wesire und Konsuln". Richtig losgegangen ist es dann mit Jean-Dominique Baubys "Schmetterling und Taucherglocke", mit dem wir erstmals auf der Spiegel-Liste landeten, und Gauß' "Europäischem Alphabet", für das er den prestigeträchtigen Prix Charles Veillon bekam, und dann, 1998, kam Mankell. Und dann schrieb einer davon, dass "jeder Denker, nicht nur der Österreichdenker", an der "Zähigkeit der Verhältnisse verzweifeln" müsste, "die sich auch von außen nicht von ihrer Trägheit aufscheuchen lassen"."Das Trauma, ein Leben. Österreichische Einzelheiten" hieß das erste Buch, das wir beide miteinander gemacht haben. Es erschien vor der Nationalratswahl 1999, die bekanntermaßen zu der ersten schwarz-blauen Regierung führte, und es erschien zum 75-jährigen Gründungsjubiläum unseres Verlags. Jetzt gibt es wieder sowohl ein Jubiläum als auch Nationalratswahlen. Du erinnerst dich an deine Antwort an die von Schüssel und Haider vereinbarte Koalition? Sie lautete: "Heimniederlage. Nachrichten aus dem neuen Österreich."
Daran denke ich nicht ohne Dankbarkeit. Du hast nicht widersprochen, als ich "moderner österreichischer Verlag" sagte. Was genau unterscheidet denn Zsolnay neu von Zsolnay alt?
Ohrlinger: Ein Buchverlag, wie ich ihn verstehe, hat auch eine gesellschaftspolitische, eine aufklärerische Aufgabe, wie das früher hieß. Sehr gute belletristische Bücher können sie fraglos leisten, gut geschriebene Sachbücher können das aber auch, manchmal in pointierterer, aktuellerer Form. Diese Schiene zu einer Publizistik, die nicht mit der Tagespublizistik zu verwechseln ist, war und ist mir sehr wichtig. Konrad Paul Liessmann, Franz Schuh, Martin Pollack, Isolde Charim, Gauß, Florian Klenk, Lisz Hirn, du selbst nicht zuletzt - individuell komplett unterschiedlich, aber alle inspirierend und nie ausweichend, und wenn's sein soll, dann mittendrin im Schlamassel, das war ein Ansatz, den es vorher nicht gab. Vor ein paar Jahren haben wir zum Beispiel innerhalb von drei Wochen das Textbüchlein zu Doron Rabinovicis und Klenks Textcollage "Alles kann passieren" über die europäischen Rechtspopulisten gemacht, die ausgehend vom Burgtheater an vielen deutschsprachigen Bühnen gezeigt wurde; Franzobels Intervention "Österreich ist schön" über die Abschiebung des albanischen Mädchens Arigona, vor ein paar Wochen erst kam Gernot Bauers und Robert Treichlers ausgezeichnetes Buch über Sein und Werden eines Herrn namens Herbert Kickl heraus -keine und keiner kann behaupten, über die Ziele der FPÖ im Unklaren gelassen worden zu sein.
Was würdest du als deinen persönlichen Erfolg nennen?
Ohrlinger: Schwierig! Wer spricht von Siegen? Am ehesten, Zsolnay wieder zu einer festen Adresse für erstklassige Schreiber gemacht zu haben, die sich mit dem Verlag bis zu einem gewissen Grad identifizieren können, auch im internationalen Maßstab: Edmund de Waal und Mircea Cărtărescu, Drago Jančar und Gianfranco Calligarich usw. Dass ich Friedrich Achleitner wieder zum Schreiben animieren konnte, Heinrich Treichl, Barbara Coudenhove-Kalergi ihre Erinnerungen abgetrotzt habe, die Wiederentdeckungen von Ernst Lothar bis Hertha Pauli und ein paar Bücher, die sonst keiner gemacht hätte, Ari Raths Memoiren zählen dazu. Mehr als 900 Bücher haben wir seit 1996 gemacht, wir, weil fast alle meiner Kolleginnen und Kollegen zehn, fünfzehn Jahre und mehr mitarbeiten und mitgestalten, mich drängen und auch triezen, Neues, anderes ernst zu nehmen -Toxische Pommes kannte ich nicht, auch Gaea Schoeters ist eine Entdeckung der Lektorin Bettina Wörgötter.
Wie entsteht so ein Programm? Und wer ist außer dir aller an den Programmentscheidungen beteiligt?
Ohrlinger: Leserinnen kaufen keine Programme, Leser kaufen ihre Bücher in der Regel auch nicht nach dem Namen des Verlags. Das Ziel des Verlags ist es aber, dem Buchhandel ein Programm anzubieten, dessen Bücher er haben muss, weil die Leserschaft danach fragt. Nicht jedes Buch wird zum Bestseller, wir bemühen uns aber, dass der potenzielle Leser darauf aufmerksam gemacht wird, dass es dieses Buch für ihn gibt. Das funktioniert noch immer über Medien und vertriebliche Sichtbarkeit. Je besser die Buchhändlerin informiert ist, desto besser verkauft sie, desto eher ist sie bereit, beim nächsten Mal wieder und vielleicht mehr einzukaufen. Erfolgreiche Bücher ziehen andere, schwierigere, Debüts etc. mit. Und über Jahre hin verlässlich erfolgreiche Bücher eines Verlags erhöhen seine Glaubwürdigkeit. Umso wichtiger ist die Vorbereitung.
Wie lange wird vorausgeplant?
Ohrlinger: Bis Herbst 2028 gibt es mehr oder weniger konkrete Programmlisten. Darin sind Titel, Abgabe-und Erscheinungstermine der Autoren verzeichnet, mit denen abgeschlossene Verträge existieren. Ein-bis zweimal im Quartal setzen wir uns - Lektorat, Vertrieb, Lizenzen, Presse, Veranstaltungen - zusammen und schauen genau hin, ob unsere Planung realistisch ist: was fehlt, was ausfällt, was verschoben, was ergänzt werden muss. Haben wir Platz und Kapazität für einen Schnellschuss? Dann kommt die erste Frage: Verdienen wir damit genug, um die Miete und sowohl die Autorenhonorare als auch unsere eigenen Gehälter zahlen zu können? Dann, ja dann wird's oft hektisch.
Wie viele Angebote kommen herein?
Ohrlinger: Das lässt sich nur schätzen, zwischen 2000 und 3000 etwa im Jahr. Wir haben Scouts in GB, den USA und in Italien, die für uns ihre Märkte beobachten und regelmäßig Reports schicken, Agenturen bieten an, Übersetzer sind für kleinere Sprachen sehr wichtig. Die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung fällt immer im Haus, beteiligt sind fast alle Abteilungen, im Wesentlichen sind es Lektorat und Vertrieb, bei Übersetzungen reden auch Gutachter mit, mit denen wir lange zusammenarbeiten.
Noch eine ganz leichte Frage: Kann ein Verlag die digitalen Medien nutzen, oder muss er mit und in ihnen untergehen?
Ohrlinger: Wir können es uns gar nicht leisten, diese Angebote nicht zu nutzen. Wir werden zum Beispiel DeepL verwenden, um uns einen Eindruck über den Roman eines moldawischen Autors zu verschaffen, zwei der Buchcover unseres aktuellen Programms sind bereits KI-generiert. Gleichzeitig werden wir Bücher von Maschinen veröffentlichen, was wir aber gar nicht merken. Herr Permaneder, "ein netter, spaßhafter Mann in gesetzten Jahren", wird im Tonfall von Joaquin Phoenix um die Hand von Scarlett Johansson anhalten, die sich dann als Nachfahrin von Tony Buddenbrook entpuppt. Ich sehe nicht, wie wir das aufhalten könnten. Dennoch bin ich mir sicher, dass es weiter Autoren aus Fleisch und Blut geben wird, die Bücher schreiben, die von Verlagen verlegt und von Lesern gekauft und gelesen werden. Wir reden weiter bei Zsolnays 125. Geburtstag, du auf alle Fälle.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen:




