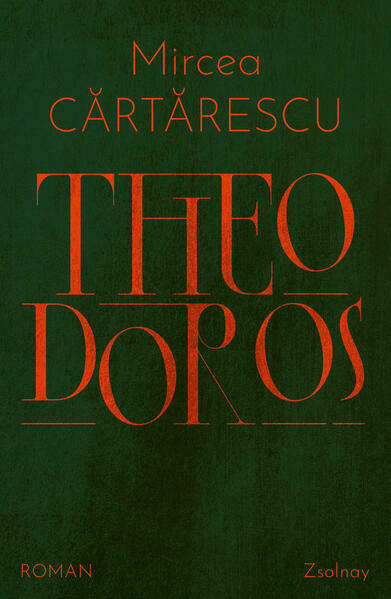Für eine Handvoll Tote mehr
Christoph Bartmann in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 11)
Der junge Mann will hoch hinaus. Von früh auf treibt Tudor ein Ehrgeiz an, den Größenwahn zu nennen eine Untertreibung wäre. Sein Vater ist zwar nur ein Mützenmacher im Dienst eines walachischen Bojaren gewesen, die griechische Mutter vertreibt ein Mittel gegen Spulwürmer, den Sohn dagegen drängt es, Herrscher über Himmel und Erde, ja, der „blaue Kaiser des Seienden“ zu werden. Und der junge Barbar hat zweifellos das Zeug dazu. Einen kampfeslustigeren Mann hat man jedenfalls zwischen Walachei und Äthiopien noch nicht gesehen.
Äthiopien? Ja, der junge Tudor wird dort als Theodoros II. oder äthiopisch Téwodros im Jahre 1855 zum Kaiser gekrönt werden. Das geht eine Weile gut, ehe er es sich mit Königin Victoria verscherzt und mit jener Pistole entleibt, die ihm in besseren Tagen die Königin geschenkt hatte.
Das alles ist natürlich frei erfunden, wenn auch nicht von Mircea Cărtărescu selbst. Der rumänische Staatsmann und Dichter Ion Ghica habe bereits im Jahre 1883 die Geschichte vom jungen Tudor und seiner Odyssee nach Äthiopien in die Welt gesetzt, erläutert der Autor. Nach ersten Untaten in der Heimat sei der einstige Bojarenknecht als Seeräuber durch die Ägäis geirrt, habe dann tatsächlich das afrikanische Kaiserreich unterworfen, um aber schließlich an den Briten und seinem eigenen Wahnsinn zugrunde zu gehen.
Cărtărescu hat den pseudohistorischen Stoff zu einer, wie er schreibt, „kontrafaktualen, fiktionalen, mythischen und archetypischen“ Geschichte weiter ausgesponnen. Bukarest, die Walachei, die griechischen Inseln und das ferne Äthiopien, sie bilden dann aber doch nur die Rampe für ein manichäisches Endspiel zwischen Himmel und Hölle. Ausgetragen wird es freilich erst am 4. Februar 2041, wenn am Tage des Jüngsten Gerichts final über die Taten und Untaten des walachischen Wüstlings entschieden wird.
Das klingt alles ziemlich verrückt. Aber was sonst hätte man vom Großmeister des psychedelischen Surrealismus erwartet? Dass ihm die Mittel zur detailgenauen Ausgestaltung solcher Fabelwelten fehlten, lässt sich nicht behaupten, im Gegenteil: Cărtărescu kann erfinderisch erzählen wie sonst kaum jemand. Es stellt sich bloß die Frage, was es bei dieser literarischen Wunderkammer außer Staunen für Leser noch zu tun gibt.
Ein anderer Autor hätte aus dem Stoff vielleicht eine halbwegs realistische Abenteuergeschichte gemacht, etwa diese: Wir befinden uns im 19. Jahrhundert; das britische Empire regiert die Welt; Queen Victoria wird auf die Talente des aufstrebenden Irren mit der Weltherrscher-Allüre aufmerksam, manipuliert ihn zunächst in ihrem Sinne … – und so fort.
Aber Cărtărescu steht der Sinn weniger nach Handlung als nach Vision. Seine Welt ist ein Tableau, ein Wimmelbild aus Gewaltakten. Albrecht Altdorfers Gemälde „Die Alexanderschlacht“ (1528–29) habe ihn ästhetisch beeinflusst, sagt Cărtărescu, ebenso wie die byzantinische Kunst in rumänischen Kirchen. Man könnte auch von Manierismus sprechen, einer barocken Kunsttendenz, die Opulenz entschieden über Ökonomie stellt. In „Theodoros“ macht sich eben dieser Stilwille geltend. Wenn sich irgendwo die Chance zu mehr Schwulst und Üppigkeit auftut, wird sie beherzt ergriffen.
Im Grunde ist „Theodoros“ wohl ein Fantasy-Roman, und zwar einer, der sowohl aus ganz alten Quellen schöpft wie auch an die Neo-Archaik heutiger TV-Formate à la „Game of Thrones“ andockt. Was den jungen Wüstling umtreibt, ist nämlich eine „Quest“, also die umweg- und aufgabenreiche Erledigung eines Suchauftrags, mit der Weltherrschaft als letzter Prämie. Nicht nach dem Gral wird hier gesucht, sondern nach der Bundeslade, die einst der Sage zufolge von Menelik, Sohn des Königs Salomo und der Königin von Saba, ins heimische Äthiopien verbracht wurde. Für den Zugriff auf die Bundeslade, den MacGuffin des Romans, ist Theodoros notfalls bereit, die ganze Welt in Brand zu stecken. Blut fließt in Strömen, und Cărtărescu wird niemals müde, noch eine weitere Gräueltat farbig auszumalen. Spannung kommt dabei keinen Moment lang auf. Bei maximaler Ausstattung fehlt dem Roman der Motor einer großen Erzählung. Stattdessen zerfällt er in lauter Mosaiksteine.
„Wenn du dich mit drei blutverschmierten Fingern bekreuzigst, dir mit dem Blut die Stirn beschmierst“, so der Beginn des allerersten Satzes. Bald werden wir erfahren, dass Theodoros nicht mehr lange zu leben hat. Von wem? Es handelt sich um Wesen, die den König der Könige mit „du“ ansprechen, die wissen, was geschah und geschehen hätte können, die den Schrecken der Meere vor einer tödlichen Kugel bewahren, indem sie ihren Lauf beeinflussen (ein erzählerisches Kabinettstück des Romans). Menschen sind es nicht, auch keine Götter, sondern Sendboten zwischen Himmel und Erde.
Der Text, den wir lesen, trägt – abgesehen von Theodoros’ Briefen an seine Mutter – die Handschrift der sieben Erzengel, er ist gewissermaßen deren Kollektivroman. Auf wessen Konto, fragt man sich, geht dann die altherrenhafte Erotik, die den Roman durchwirkt, etwa im nimmermüden Beschwören von „Titten“ und „Zitzen“ (sogar Jesu Brustwarzen werden nicht vergessen)? Sind das auch die Engel, ist es vielleicht doch ihr Autor oder hat der tapfere Übersetzer Ernest Wichner selbst diese Vokabeln gewählt? Und warum können die Engel gar nicht aufhören mit der Schilderung von Foltern und Todesarten der exquisitesten Art? Faszinierter von Grauen und Gräueln hat sich lange kein Roman mehr gezeigt. Das macht „Theodoros“ bei aller Fabulierkunst über weite Strecken zu einer ziemlich quälenden Lektüre.