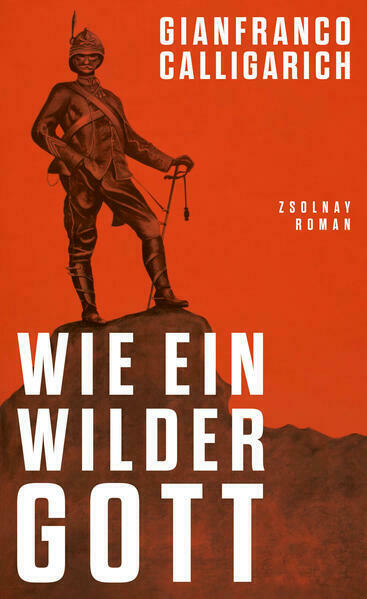Spaziergang ins Inferno
Matthias Dusini in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 6)
Auf der Suche nach aktuellen Versionen von Dantes „Inferno“ bringen Schriftsteller gern den Topos Afrika ins Spiel. Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ gilt als Maß aller Dinge, verbindet dessen aufwühlende Prosa doch kolonialen Albtraum mit psychischem Ausnahmezustand. In dieser Tradition ist auch Gianfranco Calligarichs Roman „Wie ein wilder Gott“ zu sehen, der ein reales Ereignis aufgreift: die Expedition des Afrikaforschers Vittorio Bottego (1860–1897) in das Ende des 19. Jahrhunderts noch kaum erforschte Abessinien.
Im deutschsprachigen Raum wurde Calligarich durch eine literarische Kuriosität bekannt: „Der letzte Sommer in der Stadt“, eine zauberhaft melancholische Liebesgeschichte im Rom der 1960er-Jahre, war im Erscheinungsjahr 1973 ein Bestseller, verschwand aber bald wieder in der Versenkungen. 2022 veröffentlichte der Zsolnay Verlag die deutsche Übersetzung und verhalf dem heute 77-Jährigen zu einem späten Comeback. An die wunderbare Leichtigkeit seines Frühwerks vermag der Autor allerdings nicht anzuschließen.
Calligarich greift ein verdrängtes Kapitel der italienischen Geschichte auf. Auf der Suche nach kolonialen Gebieten sandte das Königreich Italien Truppen nach Eritrea und Abessinien (Äthiopien). Beide Vorstöße endeten mit einem Desaster. Sowohl in der Schlacht bei Dogali (1887) als auch in jener von Adua (1896) bezogen die Italiener Prügel, eine schwere Kränkung des Nationalgefühls.
Genau in diesen gefährlichen Jahren unternahm Bottego Expeditionen, um den Lauf von Flüssen zu vermessen. Während die erste Reise mit einem gefeierten Triumph endete, starb der Abenteurer 1897 bei einem Überfall von Indigenen. „Wie der französische Dichter Arthur Rimbaud verfiel Bottego dem dunklen Herz Afrikas“, notierte der bekannte Journalist Indro Montanelli 1957.
Selbst aus Eritrea gebürtig, rekonstruiert Calligarich Bottegos Biografie – teilnahmsloser und sprachlich schütterer als Joseph Conrad. Das liegt auch an dem erzählökonomisch fragwürdigen Kunstgriff, die Handlung aus der Sicht eines Zeitgenossen erzählen zu lassen. Der pensionierte Präsident der Geographischen Gesellschaft lernt Bottego Anfang der 1890er-Jahre kennen und lässt dessen Leben anhand von Tagebüchern Revue passieren, räsoniert wiederholt über Alter und Gedächtnis. Der Kniff hat allerdings den Nachteil, dass das Herz nicht in der Finsternis, sondern am Schreibtisch einer römischen Villa schlägt.
Recht trocken werden die Strapazen referiert: Hunger, Hitze, Fieber und die Überfälle lokaler Stämme erschweren das Weiterkommen. Dazu kommt die beständige Angst vor dem äthiopischen Kaiser, der Italien den Krieg erklärt hat. Realistischer wirken jene Szenen, in denen der Afrikaforscher wegen der Finanzierung seiner Expedition bei Politikern vorstellig wird oder die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern kolonialer Expansion. König Umberto I. schmäht die Gegner überhaupt als primitive Affen.
Francesca Melandri ist mit ihrem Roman „Alle außer mir“ (2018) eine informative Lektion über Italiens von Kriegsverbrechen und Rassismus geprägte Kolonialzeit geglückt. Auch „Wie ein wilder Gott“ erinnert an Strafexpeditionen und Folter. Der aufklärerische Impuls geht freilich verloren, wenn der Autor auf klischeehafte Formulierungen zurückgreift. So versinkt eine Einheimische „in ihrer schwarzen Wildheit“ und ist „auf afrikanische Weise“ entschlossen.
Der bürokratische Tonfall wird dem Protagonisten nicht gerecht. Bottego wird zwar als ehrgeiziger Militär vorgestellt, der „nichts und niemanden je würde lieben können, außer sein Entdeckerleben“. Das Porträt dringt aber selten in das Innenleben dieses Fanatikers vor, der in der Wildnis die bürgerliche Herkunft abstreift. Die Altersmilde des Erzählers speckt die Etappe des kolonialistischen Ironman zum Verdauungsspaziergang ab