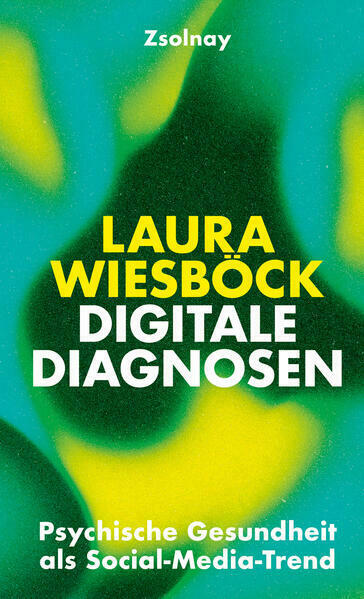"Es geht darum, funktionsfähig zu bleiben"
Felice Gallé in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 26)
Laura Wiesböck hat in den vergangenen Wochen viele Zuschriften erhalten – von Leserinnen und Lesern, die sich in ihrem Ende Jänner erschienenen Buch wiederfinden. „Digitale Diagnosen“ stößt im gesamten deutschen Sprachraum auf viel Interesse. Im Interview berichtet die Wienerin, dass es für Betroffene psychischer Leiden entlastend sein kann, wenn auch andere sich öffentlich dazu bekennen; sie schreibt aber auch über „Depressionsromantik“ und Menschen, die sich dadurch noch einsamer fühlen. Und sie erklärt, was psychische Gesundheit mit Neoliberalismus zu tun hat.
Falter: Frau Wiesböck, Sie steigen ein mit der Idee der amerikanischen Psychiatrievereinigung, die Trauer um einen Menschen schon nach zwei Wochen als depressive Episode zu klassifizieren. Was sagt uns das?
Laura Wiesböck: Dass Leistungsfähigkeit im Zentrum des modernen gesunden Menschseins steht. Diese gilt es aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen. Aber Trauer, Traurigkeit und unangenehme Gefühle gehören schlicht auch zum menschlichen Dasein. Stellen wir uns vor, dass die eigene Mutter stirbt oder ein anderer Mensch, zu dem man eine sehr enge Bindung hatte: Das zu verarbeiten dauert einfach seine Zeit.
Wobei derzeit Social-Media-Plattformen voll sind mit Inhalten, die gerade nicht volle Leistungsfähigkeit thematisieren: User und Influencerinnen bekennen sich öffentlich zu psychischen Erkrankungen, die Wahrnehmung seelischer Leiden ist stark gestiegen. Ist das nicht erfreulich?
Wiesböck: Doch, daran gibt es viele positive Aspekte, etwa dass belastete Menschen sich verstanden fühlen und sich vielleicht selbst auch eher Hilfe suchen. Gleichzeitig werden Bilder von psychiatrischen Erkrankungen auf Social Media überwiegend durch begehrenswerte Körper popularisiert. Man sieht zum Beispiel junge, attraktive Frauen, die in stylischen Wohnungen vor der Kamera weinen oder tanzen und dabei erklären, wie gut Ritalin für ihr Leben ist. Für klinisch Betroffene kann das zusätzlichen Druck ausüben, wenn ihre Erkrankung sich anders darstellt als derartige Bilder.
Sie sprechen von „Depressionsromantik“.
Wiesböck: Genau. Es gibt Menschen, die an Depressionen oder Angsterkrankungen leiden und für die es die schlimmste Vorstellung wäre, sich damit öffentlich zu exponieren. Sie haben vielleicht keine Kraft, ihren Hygienebedürfnissen nachzugehen, verlieren durch ihre Erkrankung Freundschaften, das geht bis hin zu suizidalen Gedanken. Ein solcher Leidenszustand ist existenziell und stellt sich ganz anders dar als vorherrschende Bilder auf digitalen Plattformen.
Ein Grundproblem, das Sie am Trend des Sich-öffentlich-Outens auch sehen, ist, dass es oft fließend in Kommerz übergeht. Was kann man denn damit verkaufen?
Wiesböck: Unzählige Produkte. Von ADHS-Gummibären über Pullover mit dem Schriftzug „My Anxiety has Anxieties“ bis hin zu Ketten und Ohrringen, auf denen Diagnosen stehen. Damit findet auch eine Bagatellisierung von klinischen Belastungslagen statt. Im Buch erwähne ich das Beispiel einer Person, die unter einer Angststörung leidet und sich die meiste Zeit schwertut, überhaupt das Haus zu verlassen. Sie empfindet es als Hohn, wenn andere Menschen ein T-Shirt tragen, auf dem „Anxiety“ steht. Weil es für sie kein ironisierbares Label ist und sie sich nichts sehnlicher wünschen, als diese Diagnose nicht zu haben.
Gerade bei jungen Menschen kann das Darstellen psychischer Probleme auch Dramatisches auslösen, wie Sie am Fall der Britin Molly Rose zeigen.
Wiesböck: Ja, die Jugendliche ist in einen Sog depressiver Inhalte gekommen und hat schließlich Suizid begangen. Durch Whistleblower etwa des Meta-Konzerns wissen wir: Laut internen Forschungsergebnissen kann die Art, wie die Algorithmen gestaltet sind, zu schädlichen psychischen Effekten führen, besonders bei jungen Frauen. Das nehmen diese Unternehmen bewusst in Kauf. Es ist paradox, dass Diskussionen über psychische Gesundheit besonders auf jenen Plattformen stattfinden, die sich erwiesenermaßen nachträglich auf das Wohlbefinden auswirken, besonders bei Jugendlichen und bei hohem Konsum.
Was müsste da geschehen?
Wiesböck: Eine einfache Lösung gibt es hier nicht. Die Plattformen sind jedenfalls darauf ausgelegt, dass Personen so viel Zeit wie möglich darauf verbringen und ein Suchtverhalten entwickeln. Daher finde ich es überlegenswert, Social-Media-Plattformen als Suchtmittel zu kategorisieren und auch so zu behandeln, von Kennzeichnungen bis hin zu Risikoklassifizierungen.
Sie kritisieren auch die Tendenz, dass jede und jeder als allein verantwortlich für den eigenen psychischen Zustand gilt. Man soll „Selfcare“ betreiben und „seine Themen bearbeiten“. Über alledem hätten die Leute kaum noch Zeit und Energie, sich politisch zu engagieren oder für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen – also dort anzusetzen, wo vielleicht die Ursache für manches psychische Leiden liegt.
Wiesböck: Der Imperativ, „Selbstfürsorge“ zu betreiben, zielt auch darauf ab, gesellschaftliche Mangelzustände in den individuellen Bereich zu verschieben: ob jemand aufgrund einer prekären Arbeitssitution überlastet ist oder ein Kind in einer lärmbesetzten Wohnumgebung lebt, die sich negativ auf das Konzentrationsvermögen auswirkt, eine ADHS-Symptomatik bestärkt und Medikamente nahelegt. All das wird zur individuellen Privatsache gemacht, mit dem Ziel, dass man ein funktionsfähiges Subjekt bleibt und andere nicht belastet. Insbesondere Frauen werden damit adressiert. Und das kann sehr zynisch sein, zum Beispiel für eine alleinerziehende Mutter, für die es kein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot gibt, die ihren Job mit der Mutterschaft kaum vereinbaren kann und letztlich selbst für die Überlastung verantwortlich gemacht wird: weil sie sich nicht genug um sich selbst gekümmert habe.
Wobei es ja nicht prinzipiell schlecht ist, wenn Frauen ermuntert werden, sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
Wiesböck: Die Frage ist aber, warum Männer nicht im selben Ausmaß dazu ermutigt werden. Eine Antwort darauf lautet: weil sie diese Zeit bereits haben. Daher wäre es zielführender, Strukturen zu schaffen, in denen Frauen sich nicht erst individuell Zeit erkämpfen müssen. Viele können das auch gar nicht, das ist ein Wohlstandsphänomen. Ich habe eine Studie über Haushaltsreinigungskräfte auf dem Wiener Schwarzmarkt gemacht: Sie haben weder Zeit und Geld für einen Yogakurs noch einen Raum in der Wohnung, wo sie sich zurückziehen könnten.
Meditationen und Achtsamkeitstrainings sind für Sie „neoliberale Spiritualität“. Was ist denn neoliberal daran, wenn jemand sich am Abend mit ein paar Kerzen hinsetzt und meditiert? Vielen Leuten hilft das ja.
Wiesböck: Es ist neoliberal, weil es auch hier darum geht, Spiritualität konsumierbar und mit dem neoliberalen System kompatibel zu machen, funktionsfähig zu bleiben und mit den schädigenden Auswirkungen von kapitalistischen Gesellschaften individuell umzugehen. Nicht die Welt muss sich ändern, sondern man selbst.
Sie berichten vom Achtsamkeitsprogramm von Amazon, genannt „AmaZen“.
Wiesböck: Ein besonders plakatives Beispiel, ja. Arbeiterinnen und Arbeiter können in Kabinen für ein paar Minuten Platz nehmen und Achtsamkeitsübungen ansehen, um danach wieder motiviert unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, Überwachung und Druck weiterarbeiten zu können.
A propos „weiterarbeiten können“: Sie schreiben, der ständige Leistungsdruck bringe Menschen auch dazu, in psychische Leiden zu flüchten.
Wiesböck: Ja, ein Krankheitsstatus führt dazu, dass Leistungserwartungen verringert werden. Man ist dann auch nicht mehr selbst daran schuld, es nicht geschafft zu haben, sich glücklich zu machen, sondern man ist Patientin oder Patient. Das kann entlastend wirken.
Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn man erst krank werden muss, um endlich einmal entspannen zu können?
Wiesböck: Sehr viel, und insofern stellt sich die Frage: Sollten wir gesellschaftlich nicht anerkennen, dass Verletzlichkeit, persönliche Krisen, ganz banales Traurigsein oder Phasen der Orientierungslosigkeit Teil des Lebens sind – und es dafür auch legitime Räume außerhalb von medizinischen Klassifikationen braucht? Während es diese in religiösen Gesellschaften gibt, lassen moderne Zwänge das Ausleben dieser Zustände kaum zu.