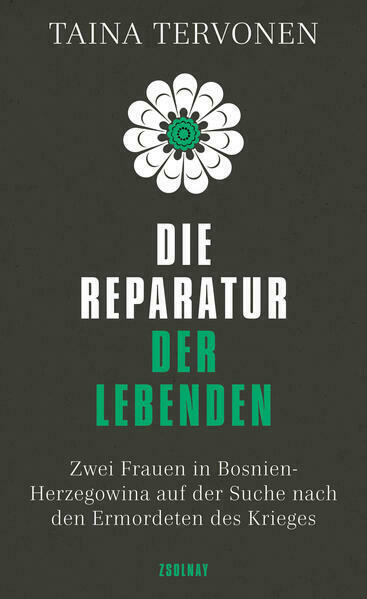Vom Glück, nicht mehr hoffen zu müssen
Stefanie Panzenböck in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 33)
Drei Generationen liegen in übereinander gestapelten Särgen: die Großeltern, der Vater, der Onkel, der Bruder und zwei Cousins. Für Mirsad, einen Mann, der die ethnischen Säuberungen in seiner Heimat Bosnien und Herzegowina überlebte, hat das Warten nun ein Ende. 22 Jahre nach ihrem Tod kann er sieben seiner Angehörigen endlich bestatten.
Der Krieg in Bosnien und Herzegowina dauerte von 1992 bis 1995. Den „ethnischen Säuberungen“ im Land fielen vor allem Nichtserben zum Opfer, allein in der ostbosnischen Stadt Srebrenica 8000 bosniakische Buben und Männer. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden vertrieben, 100.000 getötet. 30.000 von ihnen galten nach Kriegsende als vermisst, heute sind es noch 7500.
Die freie Journalistin Taina Tervonen beschäftigt sich im Buch „Die Reparatur der Lebenden“ mit den vermissten Toten dieses Krieges. Von 2010 bis 2020 begleitete sie zwei Frauen, deren Beruf es ist, diese Menschen zu finden: Senem, eine forensische Anthropologin, und Darija, eine Ermittlerin. Wird ein Massengrab gefunden, exhumiert Senem die Leichen und setzt die Skelette zusammen. Die DNA der Toten wird mit jener der Lebenden abgeglichen. Darija fährt dafür von Dorf zu Dorf, spricht mit Hinterbliebenen und nimmt Blutproben. Gibt es in der Datenbank ein Match, werden die betroffenen Familien informiert.
„Mit jedem geborgenen Knochen, jedem gesammelten Blutstropfen stellen Senem und Darija in geduldiger Kleinarbeit das Band wieder her, das immer dann reißt, wenn die Toten ihrer Würde beraubt werden und den Lebenden der Abschied verwehrt bleibt, ohne den sie kaum weitermachen können“, schreibt Tervonen.
Dem Land, dem Krieg und den Massengräbern nähert sie sich mit großer Vorsicht. Sie beobachtet, stellt Fragen, versucht zu verstehen – und erleichtert es den Leserinnen und Lesern so, ihr in dieses Grauen zu folgen.
Senem und Darija arbeiten beide für die International Commission of Missing People (ICMP), die der damalige US-Präsident Bill Clinton 1996 nach Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina gegründet hat. Im Buch geht es in erster Linie um das Massengrab, das im August 2013 in Tomašica in der Nähe von Prijedor im Nordwesten des Landes gefunden worden war. Möglich war das erst durch das Geständnis eines Mannes, der die Leichen im Jahr 1992 dorthin gebracht hatte.
Ein Mitarbeiter erklärt, was sich damals wahrscheinlich zugetragen hat: „Die Toten, die mit Lastwagen transportiert wurden, hat man wohl in ihren Dörfern erschossen. Danach hat man sie in den Gärten, Höfen und Häusern zurückgelassen. Später beschwerten sich die anderen Dorfbewohner über den Gestank. Erst dann wurde veranlasst, dass die Leichen mit den Lastwagen abgeholt und hierhergebracht wurden, nach Tomašica.“
Es waren 900 Tote, vor allem Bosniaken. Aber nicht mehr alle Leichen lagen im Grab, als man es 2013 öffnete. Aufgrund der Beschaffenheit der Erde konnte festgestellt werden, dass im Jahr 1993 etwa 300 Tote 30 Kilometer entfernt erneut vergraben worden waren, um Spuren zu verwischen.
Diese sogenannten Sekundärgräber machen es Senem und ihren Kollegen noch schwerer, die Skelette zu vervollständigen. Oft finden sie nur wenige Knochen einer Person. Die Angehörigen können selbst entscheiden, ob sie noch warten oder eine Bestattung durchführen wollen. Werden noch weitere Knochen gefunden, muss „der bereits bestattete Leichnam exhumiert und ergänzt werden“, erklärt Senem. „Wie oft kann man wohl einen nahen Angehörigen beerdigen?“, fragt sich Tervonen.
Während Senem und ihr Team graben, kommen Menschen zu ihnen, die noch immer hoffen, dass ihre Familienmitglieder dieses Mal gefunden werden. Oder verzweifeln, wie jene junge Mutter, die einen Freund begleitet, der seine Frau und seine Tochter sucht. „Man bringt doch kein Kind auf die Welt, um es an einem solchen Ort suchen zu müssen“, sagt sie unter Tränen.
Und Tervonen wundert sich, wie oft das Wort „Glück“ fällt. Er habe Glück gehabt, seinen Vater, der 1992 verschwunden ist, schon 2005 zu finden, erzählt ein Mann. „Denen, die kein Glück hatten, bleibt nur die Hoffnung“, schreibt die Autorin.
Im Sommer werden die Leichname für die große Zeremonie vorbereitet, die jedes Jahr am 20. Juli stattfindet. Die Angehörigen kommen und ehren gemeinsam die Toten. Senem geht dort nicht mehr hin, erzählt sie Tervonen. Politiker würden große Reden schwingen, „sich aber stets verleugnen lassen, wenn es um den Kauf von Kühlbehältern geht“. Denn Senem kann die Leichname nicht kühlen, weil es kein Geld für die dafür notwendige Anlage gibt. Um die Funde besser erhalten zu können, bedeckt sie sie mit Mull und Salz.
Darija gräbt auf andere Weise. Mit ihrem Auto ist sie in ganz Bosnien und Herzegowina unterwegs und besucht die Hinterbliebenen. Anhand eines Fragebogens versucht sie, mehr Details über die Getöteten herauszufinden. Wie groß war die Mutter? Welche Haarfarbe hatte der Sohn? Hatte die Tochter Zahnoperationen? Wann wurde der Vater zum letzten Mal gesehen?
Danach nimmt Darija Blut ab und erfährt, was der Krieg auch lange nach seinem Ende anrichtet. Ein Mann, der mit seinen vier Kindern allein lebt, erzählt, dass seine Frau die Familie verlassen hat. „Wie soll eine Ehe auch halten, nach allem, was hier passiert ist?“, sagt er.
Tervonen gelingt es mit ihrem Buch, ein vergessenes Kapitel dieses Kriegs aufzuschlagen. Sie porträtiert Menschen, die sich in mühevoller Detailarbeit darum bemühen, dass eine Gesellschaft wieder zusammenwachsen kann, und erzählt davon, wie wichtig die Würde der Toten für die Würde der Lebenden ist