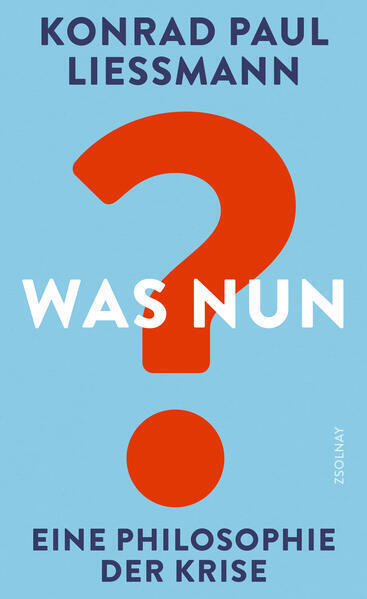Der digitale Traum und die Krise des Menschen
Konrad Paul Liessmann in FALTER 37/2025 vom 10.09.2025 (S. 26)
Die Zukunft ist seit langem bekannt. Im Jahr 1909 veröffentlichte der britische Schriftsteller E. M. Forster die Kurzgeschichte "Die Maschine steht still". Auf wenigen Seiten wird darin eine Welt skizziert, die manchen aktuellen Prognosen in einer verblüffenden und erschreckenden Weise ähnelt. Die Erde ist wüst und leer geworden, die Menschen leben unterirdisch, isoliert in Wohneinheiten und Schlafkammern, alle Bedürfnisse werden durch ein ausgeklügeltes technisches System befriedigt.^
Kommuniziert wird über Videotelefonie, Hauptbeschäftigung ist die Produktion von Ideen und der Austausch darüber. Körperliche Bedürfnisse sind zweitrangig, persönliche Begegnungen selten, Reisen an die Erdoberfläche mit Flugzeugen und Atemmasken zwar möglich, aber unpopulär. Sich in der virtuellen Welt zu bewegen, ist wichtiger und anregender, als unmittelbare Erfahrungen zu machen. Erst als nach einem Defekt die Maschine, eine Art künstliche Hyperintelligenz, zusammenbricht, erkennen die sterbenden Protagonisten, dass es ein Irrweg war, alles Leben einer unkontrollierbar gewordenen Technologie anzuvertrauen.
Forsters Erzählung ist eines der frühesten Dokumente, in denen sich zwei Aspekte verdichten, die unsere moderne Zivilisation begleiten: die Faszination, die von der Vorstellung einer vollkommen technisch gestalteten Lebenswelt ausgeht, und die Angst, dass darin alles Menschliche zuerst marginalisiert und dann vernichtet werden könnte.
Die aktuellen Debatten über die künstliche Intelligenz und ihre Bedeutung für unser Leben und Zusammenleben sind eine weitere Erscheinungsform dieser ambivalenten Haltung. Der Wunsch, dass uns immer mehr Arbeiten und Tätigkeiten von intelligenten Apparaten, Robotern und Algorithmen abgenommen werden, die Hoffnung, dass klug designte und selbstlernende Programme bessere Entscheidungen für Mensch und Umwelt treffen werden, als wir es je könnten, die Perspektive, mithilfe avancierter Automatisierungstechniken die Kosten für Unternehmen drastisch zu senken und dadurch die Profite zu steigern, und nicht zuletzt die Lust, Wunderwerke der Technik zu erschaffen und zu verwenden -all das erzeugt einen sich beschleunigenden Sog, dem sich kaum jemand entziehen kann.
Allein die Trägheit und die Wissenschaftsskepsis mancher Menschen bremst diese Tendenz, aber die Propagandaabteilungen der Digitalministerien tun alles dazu, dass solche allzu menschlichen Besorgnisse überwunden werden.
Natürlich gibt es die medienwirksam inszenierten Warnungen vor einer Technologie. Abgesehen davon, dass diese apokalyptischen Töne dazu dienen, die Internet-Konzerne medial präsent zu halten, schließen diese an eine Denkweise an, die das Verhältnis von Mensch und Maschine seit jeher problematisierte.
Der Philosoph Günther Anders hat dieses vor über einem halben Jahrhundert als "prometheisches Gefälle" beschrieben: Die von uns geschaffenen technischen Apparate übertreffen ihre Schöpfer in vielerlei Hinsicht. Mensch und Maschine bilden keine symbiotische Einheit, wie eine technikfreundliche Rhetorik verheißt, sondern überall, wo wir moderne Technologien verwenden, eröffnet sich eine Diskrepanz. Wir passen nicht zueinander. Deshalb die Forderung, dass wir uns überhaupt erst an jene Gerätewelt anpassen müssen, die angeblich zu unserem Besten entwickelt wurde: Nicht die Maschinen müssen fit für uns, wir müssen fit für die Maschinen gemacht werden.
Günther Anders ging noch einen Schritt weiter: Die Tendenz aller Technik, so seine provokante These, lautet: "Ohne uns." Technik fungiert zwar oft als Verbesserung unserer Organe, sie eröffnet neue Möglichkeiten der Naturbeherrschung, letztlich führt dies dazu, wenn nicht den Menschen als Gattung, so doch den Menschen in seinen vielfältigen und konkreten Tätigkeitsfeldern zu ersetzen. Das bedeutete nicht die spektakuläre Ausrottung der Menschheit durch intelligente Roboter, sondern die sukzessive Marginalisierung menschlichen Seins. Angesichts der Potenziale fortgeschrittener Technologien ist der Mensch in seiner aktuellen Gestalt zu einer antiquierten Spezies geworden.
Man kann das Verhältnis von Mensch und intelligenter Maschine aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Die Forderung nach Anpassung bedeutet in diesem Zusammenhang, sich den Maschinen in gewisser Hinsicht überhaupt erst gleich und damit vergleichbar zu machen. Gerade im Zusammenhang mit den viel diskutierten Chat-Programmen der künstlichen Intelligenz stellt sich die Frage, wie sehr wir uns auf ein mittleres Niveau, auf standardisierte Phrasen, auf wenig originelle Gedanken einlassen müssen, um in der Arbeit dieser Algorithmen so etwas wie Intelligenz am Werk zu sehen.
Der Philosoph und Wissenschaftsjournalist Jörg Phil Friedrich spricht von einer "degenerierten Vernunft", die zum Maßstab für die Arbeit dieser Maschinen wird. In den Resultaten der künstlichen Intelligenz begegnen wir den reduzierten und banalisierten Formen unseres eigenen Intellekts. Das Material, aus dem die künstliche Intelligenz ihre Produkte zusammenschustert und an dem sie trainiert wird, besteht ja aus der Summe von Daten, die von Menschen produziert und dann der digitalen Verwertung zugänglich gemacht werden. Voraussetzung für die Arbeit mit diesen Datenmengen ist deren Formalisierbarkeit.
Die künstliche Intelligenz wird der menschlichen umso ähnlicher, je mehr wir uns selbst auf schematisierte Gedankengänge und Sprechweisen beschränken. Die kurzsichtige Bildungspolitik der letzten Jahre hat mit ihrer Fokussierung auf zentral überprüfbare Kompetenzen dazu wahrlich einen unseligen Beitrag geleistet.
Erst diese Restriktion menschlicher Möglichkeiten erlaubt es, die künstliche Intelligenz als einen veritablen Konkurrenten auch in Tätigkeitsbereichen zu sehen, die bisher dem Menschen vorbehalten schienen. Manche Wirtschaftsforscher warnen deshalb vor einem "Deskilling": Menschliches Wissen und menschliche Fähigkeiten werden immer seltener gebraucht, der Mensch verliert allmählich entscheidende kognitive Kompetenzen, da er diese nicht mehr einsetzen und üben muss. Eine KI, die auch komplexe Programme schreiben kann, ersetzt Dutzende gut ausgebildeter Programmierer. Aus einem einstigen Zukunftsberuf wird ein Ladenhüter.
Ging es in einer frühen Phase der technologischen Revolutionen darum, die begrenzten körperlichen Fähigkeiten des Menschen zu erweitern und zu steigern - man denke an die ersten Motoren -, geht es nun um den Geist und das, was wir lange als Ausdruck einer einzigartigen menschlichen Kreativität gewertet hatten: Kommunikation, Kunst, Musik, Literatur, aber auch wissenschaftliche Forschung.
Die spektakulären Erfolge der künstlichen Intelligenz, die imstande ist, in Sekunden nach Vorbildern und mithilfe komplexer Wahrscheinlichkeitsberechnungen sinnvolle Texte zu synthetisieren, Musik in unterschiedlichen Stilen zu komponieren und Bilder und Grafiken aller Art zu generieren, führen zu erregten Debatten über die Zukunft menschlicher Kreativität. Galt diese einst als gefeit gegen Automatisierungsansprüche, stehen wir heute vor der paradoxen Situation, dass unliebsame körperliche Tätigkeiten noch immer nicht von Robotern erledigt werden, aber Kurzgeschichten, Musikvideos und Werbegrafiken künstlich und auf Knopfdruck hergestellt werden können.
Für die Arbeitswelt hat dies, wie neuere Studien zeigen, den paradoxen Effekt, dass intellektuelle und akademische Tätigkeiten entwertet werden und handwerkliche Berufe plötzlich als zukunftssicher gelten. Und man täusche sich nicht: Die gerne geäußerte Behauptung, dass es sich bei KI lediglich um ein Werkzeug handle, das unsere Kreativität befördern werde, führt in die Irre. Es geht schon darum, vieles autonomen Systemen zu überlassen, ohne unser Zutun. Es stimmt: Noch können wir Ergebnisse der KI akzeptieren oder verwerfen. Aber wie lange noch?
Diese Entwicklung berührt unmittelbar das Selbstverständnis des Menschen. Wie groß ist unsere Bereitschaft, unsere ästhetischen Bedürfnisse durch künstlich erzeugte Kunst zu befriedigen? Entspricht unserer degenerierten Vernunft ein degeneriertes ästhetisches Wahrnehmungsvermögen? Viele Kulturschaffende setzen darauf, dass nur menschengemachte Kunst jenen sinnlichen und emotionalen Mehrwert abwirft, der allein die Existenz von Kunstwerken rechtfertigt.
Möglich, dass dies ein frommer Wunsch bleibt. Zumindest in Forsters prophetischer Geschichte werden die Menschen durchaus zu ihrer Zufriedenheit ausschließlich mit Literatur und Musik versorgt, die von Maschinen hervorgebracht wird. Die Kapseln, in denen die Bewohner dieser Maschinenwelt eingeschlossen sind, gleichen jenen Safe Spaces, nach denen sich eine junge, woke Generation angeblich sehnt. [] Es bleibt die Hoffnung, dass für manche Menschen das Etikett "Made by Humans" zur begehrten Kennzeichnung für exquisite und teure Werke wird. [ ]
Keine Frage: Viele Versprechungen, die sich an die KI knüpfen, sind verlockend. Wer kann dem Ruf nach einem bequemeren Leben, das neue Freiheitsräume eröffnen wird, widerstehen? Alles wird schnell, sauber und hoffentlich korrekt erledigt, ein Universum von Applikationen, Programmen, Algorithmen, Sensoren, Kameras und Endgeräten suggeriert stete Verbesserungen unseres Lebens.
Die Leichtigkeit, mit der wir Tätigkeiten und Entscheidungen, die lange zu den sinnstiftenden Faktoren eines menschlichen Lebens gezählt wurden, an Maschinen delegieren, verblüfft dann doch. Am Ende müssen wir uns mit einem unangenehmen Gedanken konfrontieren lassen: Die fröhliche Übereinstimmung mit dem digitalen Weltgeist, trotz aller Warnungen und Bedenken, gründet in einem tiefen Misstrauen dem Menschen gegenüber.
Denn ein wesentlicher, meist übersehener oder verdrängter Aspekt der Digitalisierung und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz besteht darin, uns von Menschen fernzuhalten. [] Wir haben, so könnte man es zugespitzt formulieren, den Computer und die KI erfunden, weil der Mensch dem Menschen ein Ärgernis ist. Wir bevorzugen unsere Maschinen weniger aus Liebe zur Technik, sondern aus Abneigung den Menschen gegenüber.
Diese sind in der Regel unvollkommen, emotional, mit Vorurteilen behaftet, sie werden schnell müde, sind dabei ungeduldig, meist überfordert. In einer Gesellschaft, in der das Burnout zu einer Volkskrankheit werden kann, muss die intelligente Maschine als Erlösung erscheinen.
Die simulierten Kommunikationen und Interaktionen mit Maschinen nehmen zu, die authentischen mit Menschen ab. Zu dumm nur, dass digitale Netze höchst fehleranfällig sind, oft ungeschützt gegen cyberkriminelle Attacken und gezielt eingesetzt werden, um uns zu täuschen. Das Misstrauen nimmt in einer technischen Zivilisation nicht ab, sondern zu. Jede E-Mail kann eine Falle sein, jedes realistische Foto eine Fälschung.
Die künstliche Intelligenz ist auch sonst nicht ohne Tücken. Wenn uns der Algorithmus unserer Bank einen Kredit verweigert, weil er aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Daten die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit, die einem Menschen kaum aufgefallen wäre, erkannt hat, sehnen wir uns nach einem Gegenüber, das sich vielleicht hätte überreden lassen.
Auch im Bereich der Rekrutierung von Personal wächst das Misstrauen gegen Algorithmen, deren Entscheidungskriterien undurchsichtig sind. Dazu kommt, dass die Vorurteile der Programmierer sich in der Verfahrensweise der KI widerspiegeln. Von automatisierten Systemen getroffene Entscheidungen entlasten jedoch die Verantwortungsträger - wer wollte einem Computer widersprechen?
Denkbar, dass es gar nicht die Effizienzsteigerung ist, die in vielen Bereichen den Einsatz von Maschinen rechtfertigt, sondern die Möglichkeit, sich elegant aus jener Verantwortung zu stehlen, die erwachsenen Menschen zukommt. Die Arbeit mit künstlicher Intelligenz setzt ein gerütteltes Maß an Selbstinfantilisierung voraus, oder, um es mit Immanuel Kant zu formulieren: eine neue Form der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Unsere Unduldsamkeit gegenüber den Menschen wächst mit dem intensivierten Umgang mit Maschinen. Zunehmend messen wir den Menschen an den Möglichkeiten der Maschine, und in vielen Belangen schneidet unsere Spezies ja tatsächlich schlecht ab -nicht nur beim Schachspiel. Aber was besagt das?
Die beliebte Talkrundenfrage, ob uns denn die Maschinen in naher Zukunft in jeder Hinsicht übertreffen werden, unterliegt einem angekränkelten Selbstbewusstsein. Mehr souveräne Distanz täte not. Eine kluge
Technikpolitik könnte versuchen, einen Wettlauf zwischen Mensch und Maschine zu vermeiden. Dafür müsste man sich darüber klar werden, was Sache des Menschen ist, und bei welchen Tätigkeiten man deshalb auf den Einsatz von Maschinen aus freien Stücken verzichtet, auch wenn es technische Optionen dafür gäbe.
Es wäre ein Leichtes gewesen, Programme wie ChatGPT aus dem Bildungsbereich zu verbannen, schlicht mit dem Hinweis, dass Lehrer nicht daran interessiert sind zu erfahren, was Maschinen schreiben können. Dass man darüber erst gar nicht diskutieren durfte, zeigt nur, wie sehr wir sofort bereit sind, angeblich hoch geschätzte Werte wie den einer "eigenständigen Leistung" aufzugeben, wenn die Maschine es will.
Selbstverständlich ist es einfacher, bequemer und gilt als fortschrittlich, einem Schüler zu konzedieren, dass er imstande war, ein Programm für sich arbeiten zu lassen, als sich mit den unzulänglichen Elaboraten eines Pubertierenden herumzuschlagen. Die Situation, dass ein Lehrer ChatGPT einsetzt, um eine Arbeit zu korrigieren und zu bewerten, die ein Schüler mit ChatGPT erstellt hat, ist keine Satire, sondern Realität. Und wieder gilt: Menschen sind mühsam. Wie schön, dass es Maschinen gibt.
Was nun? Lange vor der Erfindung des Computers, aber schon in der Frühzeit der Elektrifizierung, hat Friedrich Nietzsche zu unserer Frage Entscheidendes angemerkt. In der Vorrede zur "Fröhlichen Wissenschaft" fand dieser umstrittene Philosoph zu einer eindringlichen Formulierung: "Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivir-und Registrir-Apparate mit kalt gestellten Eingeweiden, - wir müssen beständig unsre Gedanken aus unsrem Schmerz gebären und mütterlich ihnen Alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängniss in uns haben."
Klarer ist die Differenz von Mensch und Maschine selten ausgesprochen worden.
Gerade die moderne KI, die riesige Datenmengen registrieren und verarbeiten kann, die Texte schlicht aufgrund von Wahrscheinlichkeiten berechnet, gleicht einem nietzscheanischen Objektivierapparat, ohne jede subjektive Leidenschaft.
Unsere Liebe zu Maschinen, machen wir uns nichts vor, speist sich in erster Linie aus einer Mischung aus Angst und Verachtung gegenüber einem Wesen, das seine Gedanken aus einem Schmerz gebären muss. Die Maschine erlaubt die schmerzfreie Produktion von Gütern und Gedanken, ohne Qual, aber auch ohne Lust.
Wenn wir dies wollen, so sollen wir es bekommen. Wir können dann nur hoffen, dass unsere Maschine, anders als in Forsters Vision, niemals zum Stillstand kommt.
Mit einem wird man in unserer schönen neuen Welt rechnen müssen: dass es auch in ihr Menschen geben wird, denen ihre Leidenschaft, ihre Unzulänglichkeit und ihre eruptive Kreativität wichtiger sein wird als die Anbetung jener digital quäkenden Frösche, die wir mit dem Prädikat der artifiziellen Intelligenz zu Unrecht geadelt haben.